


In seinem Blog beschreibt Jamal Tuschick die Vorteile von Differenz und die Chancen kultureller Vielfalt. Es stellt sich die Frage, wie die Literatur rückwärtsgewandten Tendenzen entgegenwirken kann. Hat die Literatur eine unmittelbare gesellschaftliche Relevanz? Wie werden Selbst- und Fremdbilder durch Literarisierung beeinflusst? – Tuschicks Textland Blog wird ständig aktualisiert.

Aus einem mit Kopfsteinpflaster verniedlichten Oval ragt eine Stele. Ein Protegé von Therese hat das Werk verbrochen. Der Künstler ist in der weiten Welt vollkommen unbekannt.
mehr

Er besprach sich mit der Großmutter, die noch nicht Vierzig war und keine Gelegenheit bekommen hatte, vor lauter Daseinsverdruss fett zu werden. Im Grunde ihres Herzens war sie die übertrieben starke Minderjährige geblieben, die einem zurückhaltenden Jungen anvertraut worden war. Der Junge hatte bis zu seinem unnatürlichen Tod keinen Eifer, aber einen tiefen Ernst gezeigt. Die Großmutter riet Luciano, seine Familie als Scherenschleifer zu ernähren.
mehr

Die Konvergenztheorie erwartete eine Annäherung der beiden deutschen Staaten als einer Angelegenheit bürgerlichen Behagens. Sie ging von Konsumgemeinschaften aus. Abstimmungen in der Warenwelt sollten die ideologische Differenz vermindern. Christoph Heins „Fremder Freund“ („Drachenblut“) zeigt die DDR als fortgeschrittene, zugleich lethargische Gesellschaft.
mehr

Jahrzehnte ist die Tochter einer russischen Zwangsarbeiterin, die ihren Vater nie gesehen hat, landfahrerisch unterwegs, eine Nomadin des Unheils, die sich in Kleingärtner-Kolonien einnistet und die Unbeholfenheit randständiger Jugendlicher nutzt, um sich mit drakonischer Fürsorge eine Gefolgschaft zu sichern. Ihre Mündel verwendet sie auch zuhälterisch. Sie vermietet sie an Drücker- und Putzkolonnenführer.
mehr

Jeden Abend untersucht sie ihre Töchter. In den Achselhöhlen und im Schambereich fahndet sie nach den Verursacherinnen von Hirnhautentzündungen. Die Angst vor Frühsommer-Meningoenzephalitis sitzt tief im mütterlichen Fürsorgekörper. Sie mischt sich mit diffusen und konkreten Befürchtungen und einer ewigen Hinterkopf-Litanei.
mehr

Der Vater der Marquise akzeptiert den russischen Rittmeister als Bräutigam. Die Mutter reibt sich die Hände. Sie lässt den Grafen aus dem Gästebett holen. Der Angeforderte beeilt sich zu erscheinen und mit den leidenschaftlichsten Bekundungen seine Bereitschaft zu beglaubigen, das Urteil des Prüfungsregimes nicht anzufechten.
mehr

Umgehend entledigt sich der eigenmächtige Gast seiner Reisegarderobe. Er legt seine Galauniform an und rauscht ab zum Gouverneur, wo er den Rest des hellen Tages verbringt. Sein Gebaren versetzt Juliettas Familie in „Unruhe“. Der Forstmeister schildert sich als Zeuge eines Coups. Nach seinen Beobachtungen sind die sozialen Manöver des Grafen vorbedacht, eben so wie bei einem in die Tat umgesetzten Plan.
mehr

Ein von den Toten wieder auferstandener Rittmeister hält mit dubioser Dringlichkeit um die Hand der Marquise von O. an. Jene Julietta kam ebenso dubios in andere Umstände. Das ist im Augenblick der Ereignisse noch nicht offiziell. Der Skandal steht noch aus.
mehr

Julietta versucht ihrer Mutter klarzumachen, dass sie schwanger ist, ohne eine Ahnung, wie das passieren konnte. Die schöne junge Witwe hatte schon seit Ewigkeiten keinen Sex mehr. Heinrich von Kleist verdreht die verkrampfte Zwiesprache. Den gründlich düpierten Hausherrn macht er zum ahnungslosen Schlusspunktsetzer.
mehr

Heinrich von Kleist wählte zur Unterhaltung des Publikums ein historisches Wimpernschlagereignis. Die zaristische Streitmacht marschiert ihrer Verdrängung entgegen. Kleist wollte genau den Punkt setzen. In einem Augenblick politischer Folgenlosigkeit erleidet das Individuum sein Schicksal, ohne sich mit einer geschichtsmächtigen Marke schmücken zu können. Die von Kleist heraufbeschworene Szene wird von einer grotesken Unterströmung im Fluss gehalten.
mehr

Den an einen äußeren Rand der Entscheidungsfreiheit gedrängten Kommandanten der angegriffenen Zitadelle treibt keine Hoffnung mehr an. Juliettas Vater ergibt sich nur deshalb nicht, weil er den Eroberern den Großmut des Pardons nicht zutraut. Mit „sinkenden Kräften“ zieht er sich auf eine letzte Linie zurück. Nun tritt der Russe, von dem wir schon so viel gehört haben, vom Kampfgeist glühend, vor seine Leute und fordert ...
mehr

Gletscherschmelzen treiben Pandemien an. Achtundzwanzig bis eben unbekannte Virus-Gruppen fanden Wissenschaftler im Tauwasser. Dazu kommen steinalte Spielarten von Pocken, Spanischer Grippe und Beulenpest.
mehr

„Eben als die russischen Truppen, unter einem heftigen Haubitzenspiel, von außen eindrangen, fing der linke Flügel des Kommandantenhauses Feuer und nötigte die Frauen, ihn zu verlassen.“
mehr

In einem späten Augenblick des 18. Jahrhunderts stürmen russische Truppen eine oberitalienische Zitadelle. Sie tragen die historische Flüchtigkeit eines Sieges davon, von dem nur die Leidtragenden Notiz nehmen. Das Missverhältnis von blutigem Getöse und politischer Wirkung löst Unbehagen im Themenpark der Peinlichkeit aus. Der folgenlos aufschäumende Betrieb wirkt abstoßend. Heinrich von Kleist spekuliert auf den Effekt, indem er den militärischen Radau dem weiteren Novellengeschehen mit viel Liebe zum Detail vorsetzt.
mehr
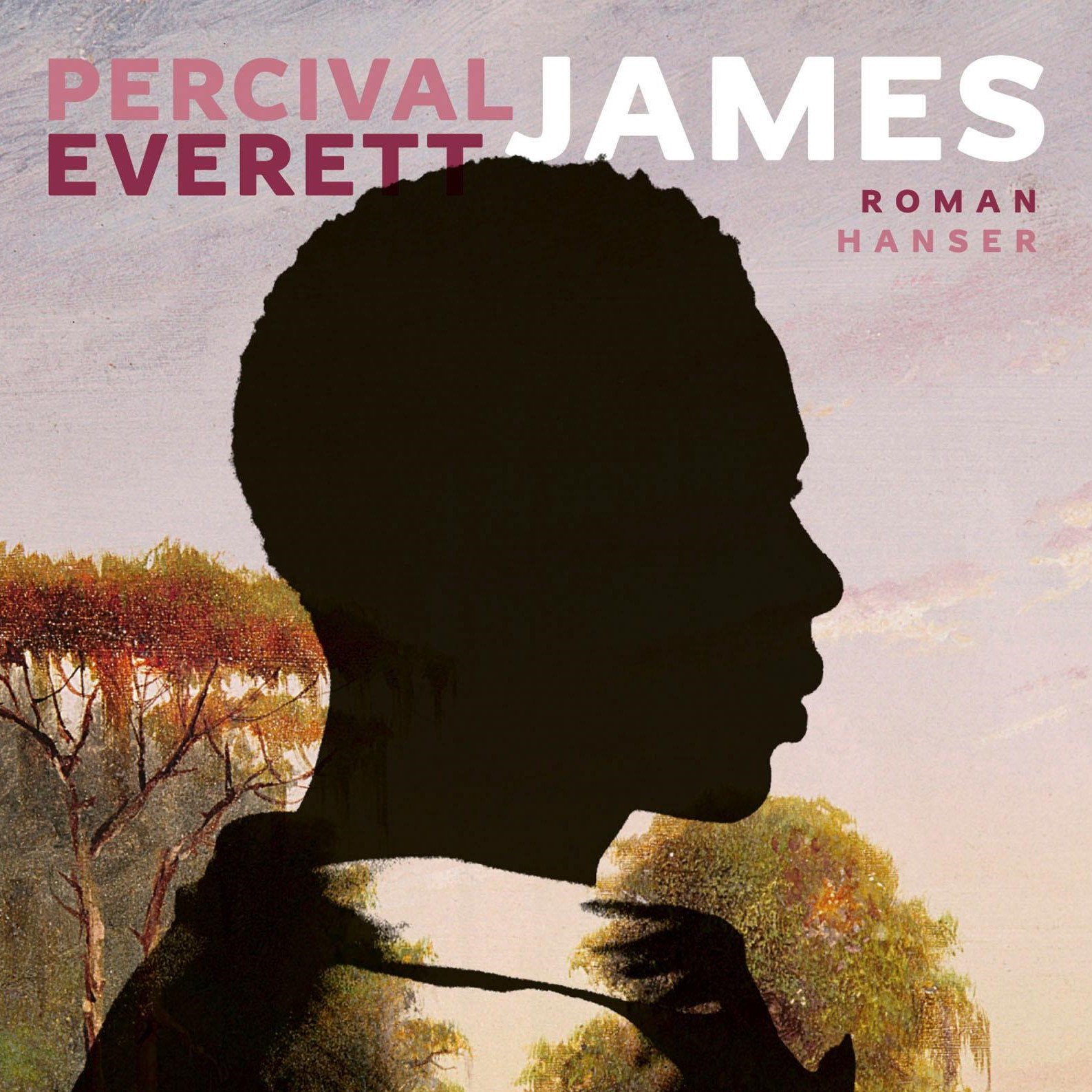
„Dass die tiefste kulturelle Revolution durch den Einzug der Marginalisierten in die Repräsentation ausgelöst wurde - in der Kunst, der Malerei, der Literatur, überall in den modernen Künsten, in der Politik und im sozialen Leben im Allgemeinen. Unser Leben wurde durch den Kampf der Marginalisierten um Repräsentation verändert.“ Die Feststellung von Stuart Hall gibt Percival Everetts Roman die Richtung vor.
mehr

Meine Eltern erwarten nicht viel von mir. Zumal gemessen an dem, was ich erben werde. Trotzdem fällt es mir jedes Mal schwer, keine Ausreden zu gebrauchen und meinen wenigen Verpflichtungen ihnen gegenüber nachzukommen. Früher war mir kein Vorwand zu durchsichtig: ich fürchtete die Blößen nicht. Doch jetzt erscheint jede Lüge wie ein Frevel.
mehr
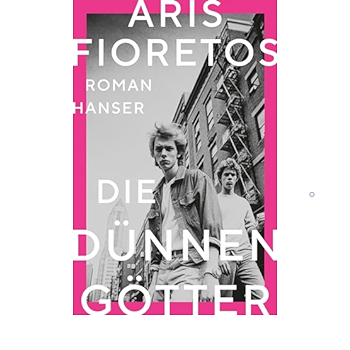
Der aus dem kleinstädtischen Delaware gebürtige Timothy ‚Tim‘ Middler wählt als angehender Rockstar den nom d‘artiste Ache Middle. Das unterschlagene r nimmt den angestammten Platz schließlich wieder ein. Im Vollbesitz seiner Mittel nennt sich der Künstler als nicht mehr ganz junger Mann Ache Middler. Ache verliert seinen Zwillingsbruder, mit dem ihn nicht viel verband, außer manchmal eine rasende, jedoch vollkommen aussichtslose Nähe.
mehr
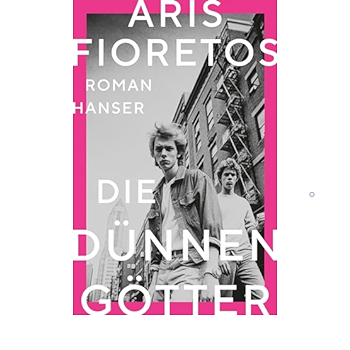
Ihre Songs sollen klingen wie „freigelegte Nerven“. Doch wenn Tim Middler aka Ache Middle singt, klingt es eher so „als würde mich jemand würgen“. Ache und seine Mitstreiter fühlen sich als „Rimbauds Erben“. Ihre Performance erinnert an „bösartige Chorknaben“. Doch schon die erste Besprechung des Debütkonzerts ist eine „lodernde Huldigung“. Die Rezensentin kennt die Innen- und Kehrseiten der Newcomer-Band. Trish Kelly liebt Ache. Vielleicht verleiht ihr das prophetische Gaben.
mehr

Die Redundanz des Vitalen … evolutionäre Ladenhüter und Evergreens … erotisches Junkfood. Entscheidend ist doch, was passiert, wenn man sich eine Woche lang nicht die Haare gewaschen hat. Wie gut kann man sich nach zehn gemeinsamen Stunden im Auto noch riechen. Wie sehr kann man sich dann noch leiden, beziehungsweise wie sehr leidet man dann.
mehr

Amitava Kumar beschreibt eine soziale Evolution. Die Angst der Hirsche gibt nicht nur Pflanzen Raum, sondern auch den Hirschen Anhaltspunkte, wie sie unter verschärften Bedingungen überleben. Die erholten Pappelbestände des Yellowstone Parks rufen Biber auf den Plan, die da weitermachen, wo die Hirsche aufgehört haben. Sie nehmen freigewordene Plätze ein.
mehr
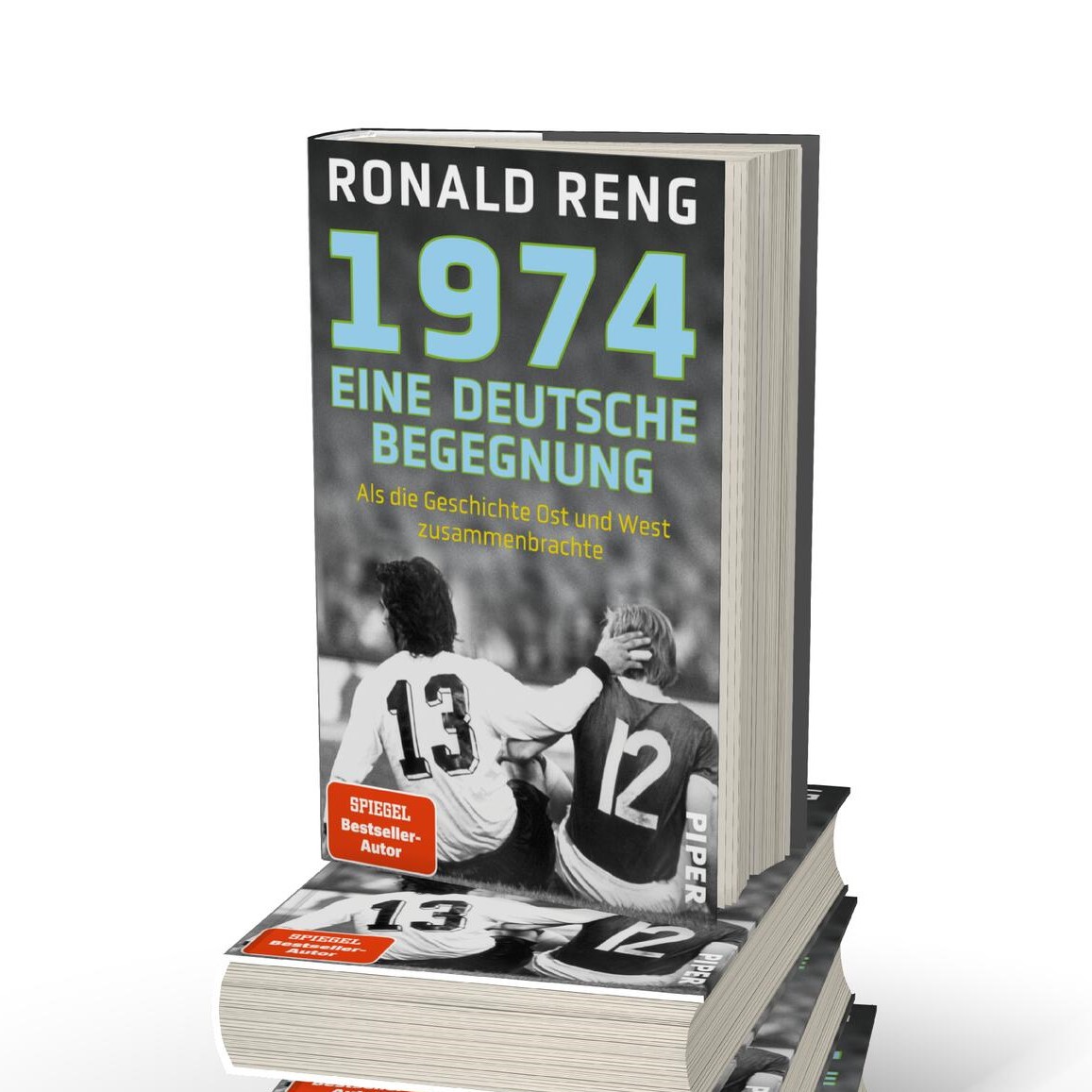
Am 11. September 1973 stürzt General Pinochet in Chile den weltweit ersten demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten. Salvador Allende quittiert den Staatsstreich mit Selbstmord. Pinochet errichtet eine Diktatur, die weltweit Schockwellen der Empörung auslöst. Zur Signatur der Pinochet-Pression werden in Straflager umgewandelte Fußballstadien. Viele Regimegegner fliehen in die DDR. Neun Monate und elf Tage nach dem Putsch spielt die chilenische Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadium vor 17.400 Zuschauern gegen Australien.
mehr
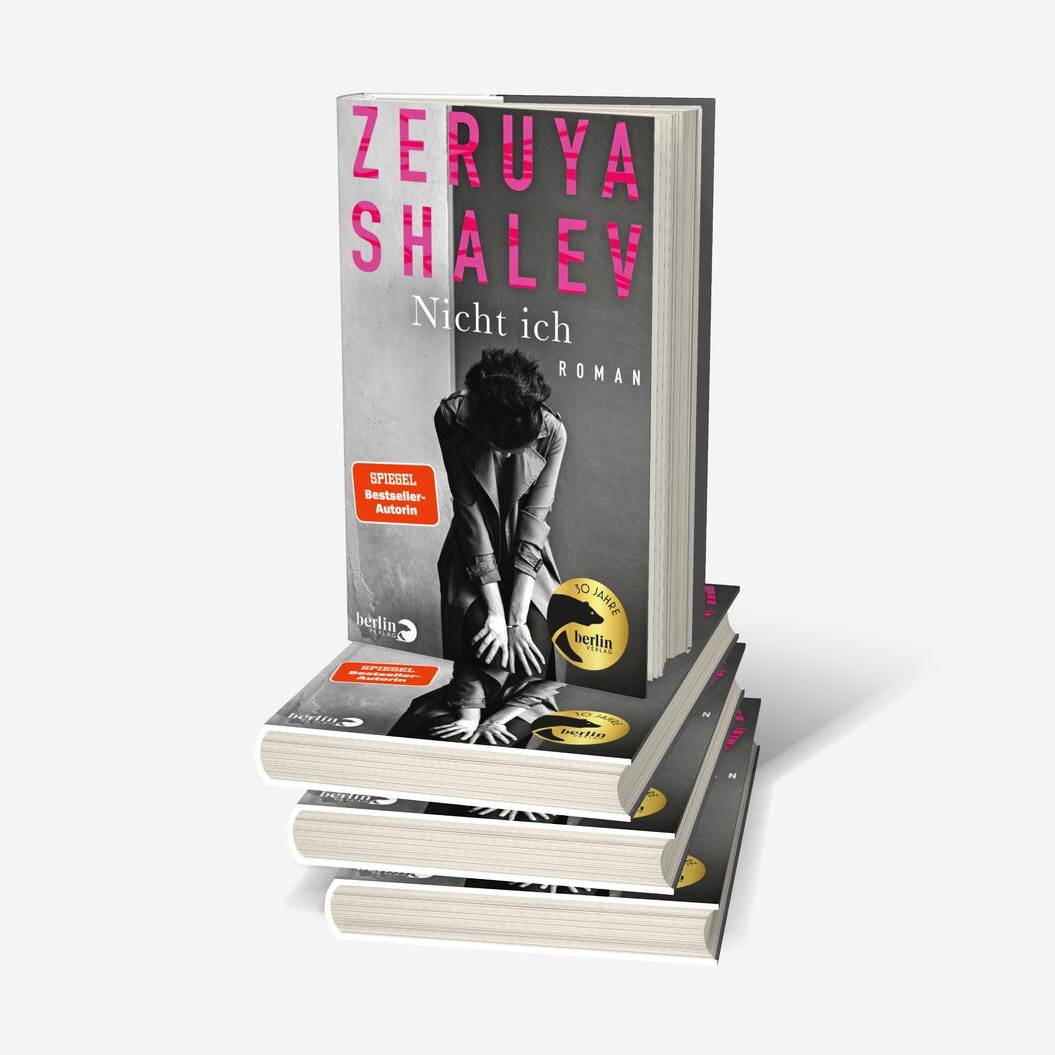
„Ich kann nicht beschreiben, wie wichtig mir dieser Sieg war, mir, die ich noch bei keinem Spiel gesiegt und die ich schon so viel Scheiße gefressen hatte.“
mehr
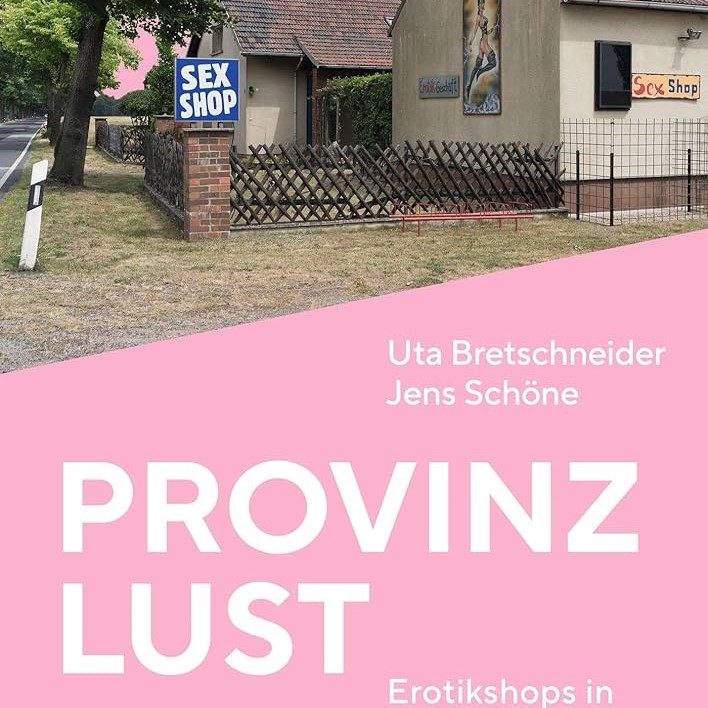
Die Autor:innen haben vollkommen recht, ihr Thema für bahnbrechend und beinah schon touristisch wegweisend zu halten. Bretschneider und Schöne liefern ihrer These großartige Belege. Sie entdecken das Sensationelle knapp über den Bodenwellen von Land- und Dorfstraßen. Sie haben auch im Westen und in ostdeutschen Großstädten recherchiert, die schönsten Geschichten verbinden sich aber mit Schauplätzen in Brandenburg und Sachsen, die wie halbwegs aufgegebene Vorposten einer kränkelnden Zivilisation dem unbefangenen Durchreisenden das Gefühl einer Geisterbahnfahrt geben.
mehr
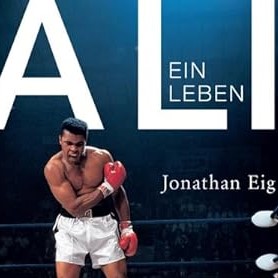
Am 25. Februar 1964 verliert Sonny Liston in der Miami Beach Convention Hall den Weltmeistertitel im Schwergewicht an einen Olympiasieger von 1960. Muhammad Ali (1942 - 2016) heißt noch Cassius Clay. Gern wäre er der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten geworden. Den Rekord hält Floyd Patterson, der 1956 im Alter von einundzwanzig Jahren den halbgreisen Archie Moore schlug. Erst dreißig Jahre später wird ein zwanzigjähriger Herausforderer Pattersons Rekord brechen.
mehr
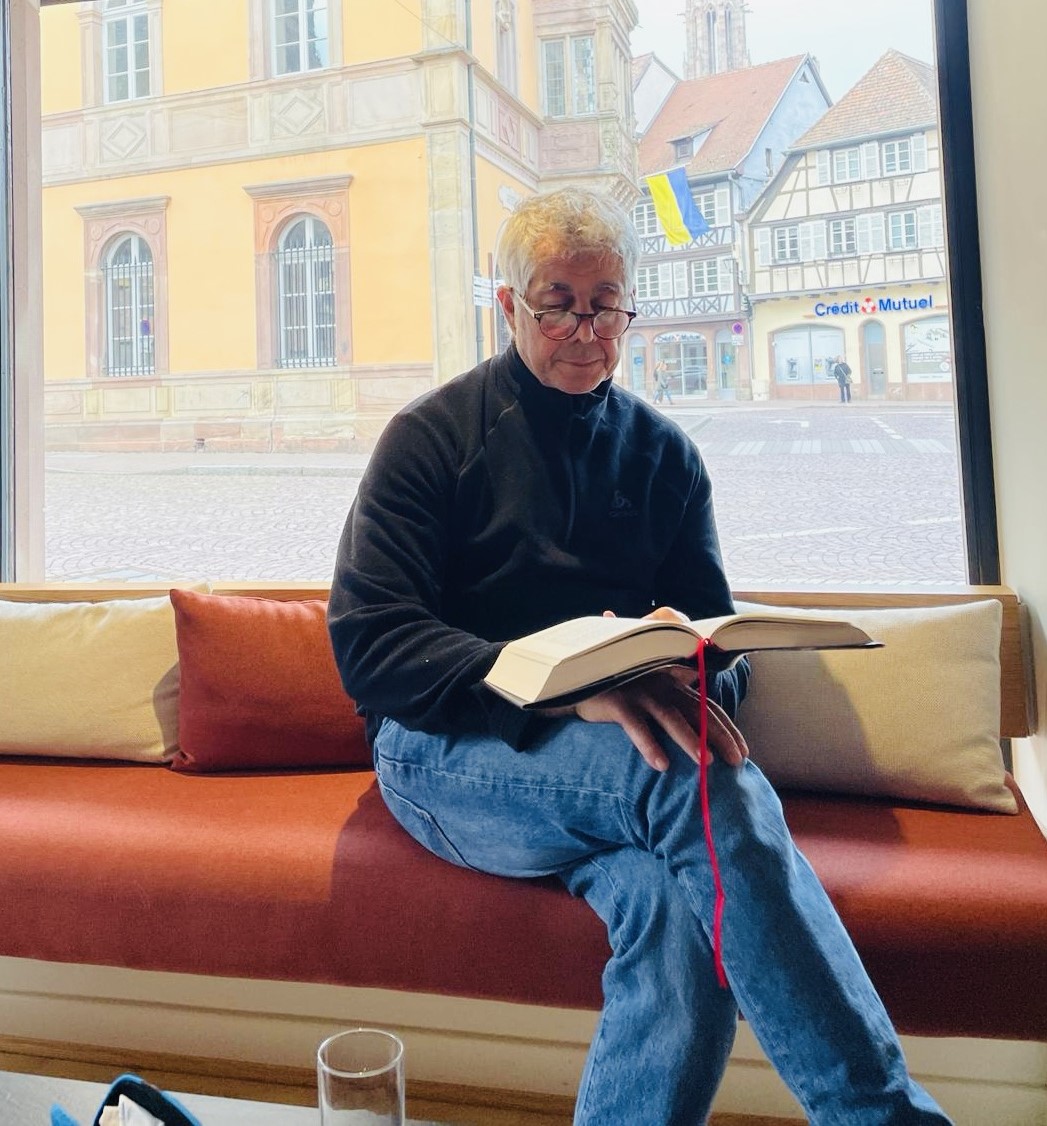
Ich verstand nicht, warum mein Bruder nicht arbeitete. Rolf hatte das Recht aus der Reihe zu tanzen. Ihm gehörte ein Zugang zu den mütterlichen Abteilungen. Mich fügte man in den betrieblichen Baukasten wie einen Gegenstand ein. Auf mich ließ sich zurückgreifen. Zwei Fragen drängten sich vor. Was unterschied mich von meinem angeblich schwermütigen und hochbegabten Bruder und warum widerstand mein Vater nicht seinem Vater?
mehr

Täglich schließt Keno die Kreuzworträtsellücken seiner Oma am gravitätischen Schreibtisch im Großraumwohnzimmer. Stille könnte einen Moment der inneren Einkehr begünstigen. Doch brüllt der Maximalfernseher von morgens bis abends, während so gut wie keine Sendung Betty die seelisch so notwendige Zustimmung gestattet. Vertrauenswürdig erscheinen ihr nur autoritär auftretende Männer, die sie ...
mehr

Erst zwangen „körperliche Einbußen“ Betty zu immer längeren Pausen. Inzwischen unterbricht die Hofherrin nur noch selten die Ruhephasen. Tagsüber ist sie zu schwach für beinah jede Beschäftigung und nachts kann sie nicht schlafen. Als das Ohr seiner Oma kennt Keno alle Nuancen.
mehr

Der Himmel seiner Kindheit war eine Reverenz starker Empfindungen. In der Wüste wurde jede Regung des Gemüts einem Gemeinschaftsdienst zugeführt. Nur für Ideale gab es einen Markt. Man hatte zu glühen. Doktor Mansour erlöste sich davon in Frankfurt am Main, während Kommilitonen einen bewaffneten Kampf gegen ihren Staat erwogen. In den besetzten Häusern des Westends nannte man ihn Kalaschnikow, da er sich mit Maschinenpistolen bereits auskannte als deutsche Studenten waffentechnisch noch in der Steinzeit lebten.
mehr

Den gesellschaftlichen Verwerfungen zum Trotz glückt Marianne eine tadellose Kindheit und Jugend. Sie absolviert das Höhere-Tochter-Programm. Einmal gesteht sie ihre Faszination für Prinz Pfahl - Kazıklı Bey. So nannten die Osmanen den rumänischen Aristokraten Graf Dracula aka Fürst Vlad der Pfähler.
mehr
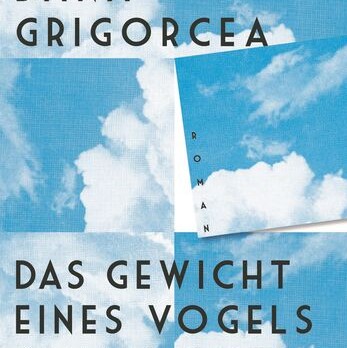
Eine Person, deren Weltläufigkeit das Polyglotte entbehrt, scheint gleichwohl alles zu begreifen, was man ihr auf Italienisch, Deutsch, Englisch und Französisch vorträgt. Noch erstaunlicher ist die Fähigkeit, mit einem „fröhlichen Wortsalat“ dem anspruchsvollen Publikum zufriedenstellende Entgegnungen zu liefern.
mehr

Bei uns daheim am Küchentisch hieß es stets: Türken können so was nicht. Das ist der Lase im Großvater. Doch auf dem Schauplatz der Erfolgsgeschichte gab es sonst keinen, der wusste, dass es Lasen überhaupt gab.
mehr

Aus der Vorstadt am Rosenthaler Tor kam nichts Gutes nach bürgerlichen Maßstäben. Ringvereine entstanden außerhalb der Ringmauer. Bald nach Neunundachtzig wurde das angestammte „Hauptquartier des Pöbels“ schick in einer überraschenden Wende nach der Wende. Die Gentrifizierung schob das Rotlichtmilieu vor sich her. Die Flurbereinigung erfolgte nach Schema F.
mehr

Mit Containern, Stein- und Schutthaufen wurde eine Kreuzung aus dem Verkehr gezogen. Die Baustelle sah aus wie ein Feldlager. Goya und Gunda liefen durch Gassen einer Budenstadt, an deren Jahrmarktsrändern ein Dorf aus gestapelten Blechschachteln lag. Auf Trampelpfaden gelangte man dahin und hinein über verwinkelte Treppen, die an Rundstiegen alter Häuser erinnerten.
mehr

In der Hochzeit der Afrika-Expeditionen und der spekulativen Ethnologie befasste sich der Journalist Henry Mayhew (1812 - 1887) mit der Armutsarchaik vor der eigenen Haustür. Er trieb Völkerkunde in den Gassen von London und …
mehr

Erratische Felsen. Bizarre Treibgutassemblagen. Die Tiefsee der Metaphorik. Ron markiert den Mythensüchtigen. Er strapaziert die Sirenen in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Aileen gibt die paradox vor dem Meer sich ängstigende Schaumgeborene im Stil der Venus von Botticelli. Die kunstgeschichtlichen Echos wirken mechanisch. Jeder ergreifende Blick und alle erotischen Degustationen werden zu Stichwörtern in einer mangelhaften Performance.
mehr

Zunächst halten sich Sympathie und Reserve die Waage in dem Abhängigkeitsverhältnis. Die Abhängige muss durch ein Nadelöhr, um auf die universitäre Speck- und Sonnenseite zu gelangen. Fragt man Miriam, dann entsprechen ihre Beiträge einer einzigen Einladung. Manche Momente deuten sogar eine keimende Freundschaft an, obwohl die Ältere weiß, wie trügerisch das alles ist.
mehr

Betty räuspert sich furios in ihrem futuristischen Fernsehsessel. Somnambul verschiebt sie die Brille auf dem Nasenrücken. Die Fernbedienung entgleitet der Sitzfläche und landet auf dem Teppich. Bettys Kopf sinkt unbequem auf einen Sesselwulst. Kenos Oma wird gleich mit einem steifen Nacken aus ihrem komatösen Nickerchen erwachen.
mehr
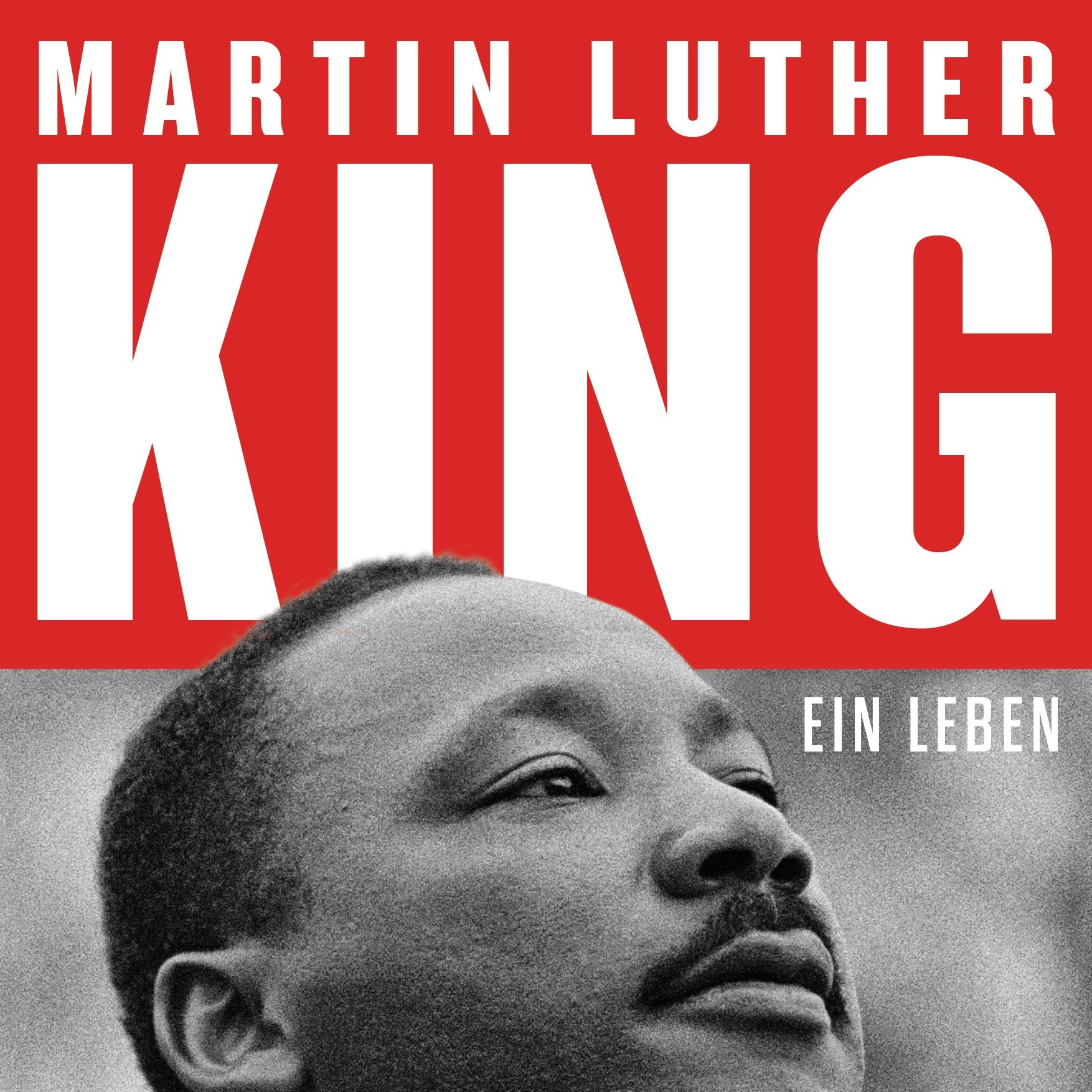
Sein Anlauf währt zehn Jahre. So lange übt James Meredith die staatsmännische Attitüde, mit der er in die Geschichte eingehen will. Zugleich soll ihn die gravitätische Pose vor direkten Übergriffen bewahren. Er orientiert sich an einem Heerführer, der sich von seiner Truppe absetzte, um nach einer Eroberung dem Publikum das Schauspiel eines solistischen Einzugs zu gewähren.
mehr
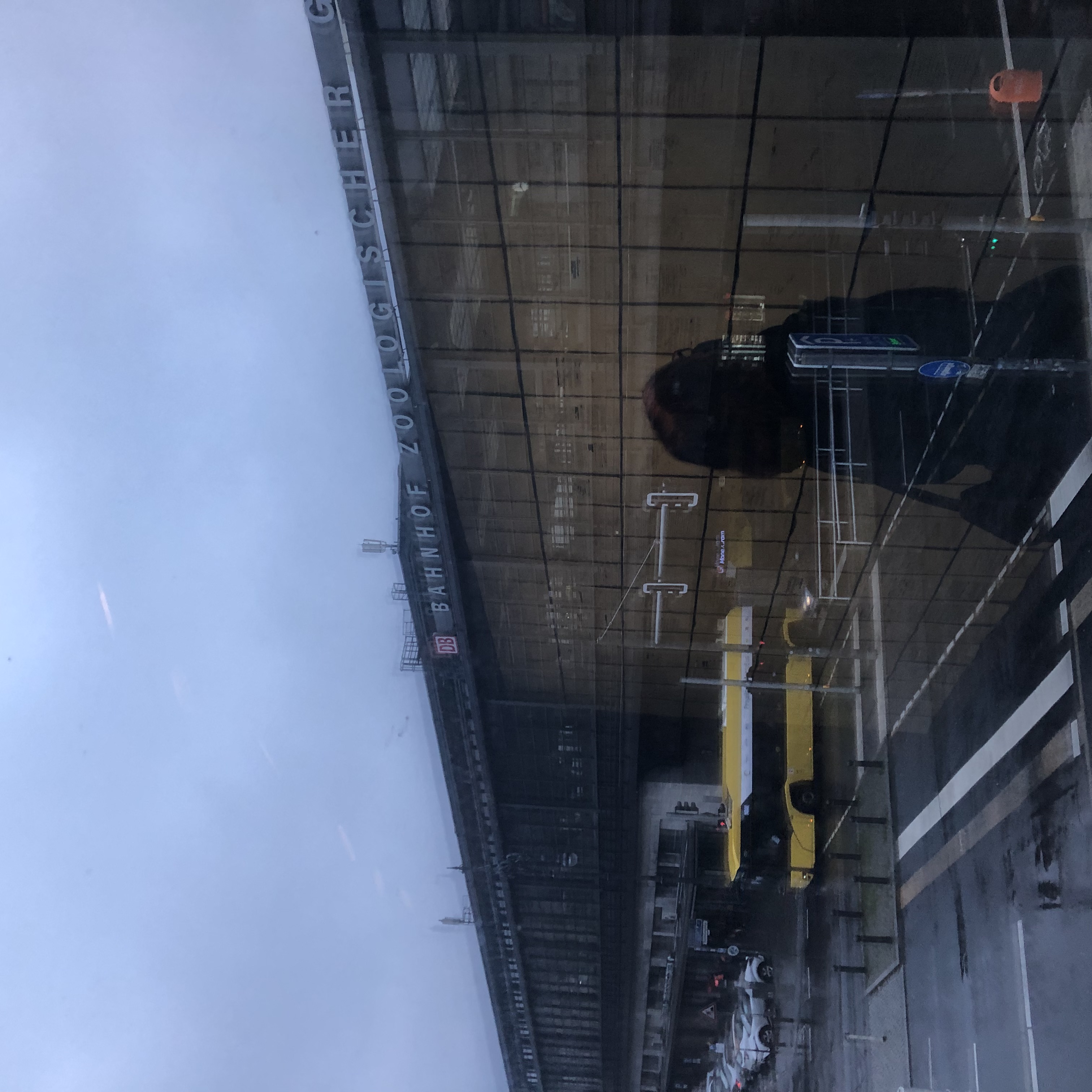
Demnächst flippt die Republik aus. Eine bleierne Zeit liegt in den letzten Zügen. Die Adenauer-Restauration hat ausgedient. Die Ehe der Premium-Kolumnistin Ulrike Meinhof und des hanseatisch-smarten Publizisten Klaus Rainer Röhl ist ein Politikum. Stefan Aust beschreibt die beiden als „linkes Erfolgspaar mit Eigenheim und Urlaubsreisen nach Sylt“.
mehr

Keno stromert seiner Oma Betty hinterher über den Friedhof von Ö … Er lauscht dem Gemurmel seiner Vorfahren. Vom Rascheln der Blätter fühlt er sich ins Gebet genommen. Keno ist vorerst der letzte männliche Nachkomme einer schwäbischen Dynastie von Schmieden. Kein Familienname kommt in dieser Gegend häufiger vor als Schäufele. Betty ist eine geborene Schäufele. Das bedeutet hier viel. Schäufeles wurden in Ö … schon unter die Erde gebracht, als der Friedhof noch gar nicht existierte.
mehr

Jedem Spatzen-Pieps entnimmt Anton philosophische Prisen. Schopenhauer definiert Genialität, als „die Fähigkeit, sich rein anschauend zu verhalten“. Elegisch gestützt auf eine Forke, präsentiert sich der kaum alphabetisierte Millionär im blütenweißen Seidensticker Hemd, mit schlohweißer Mähne.
mehr
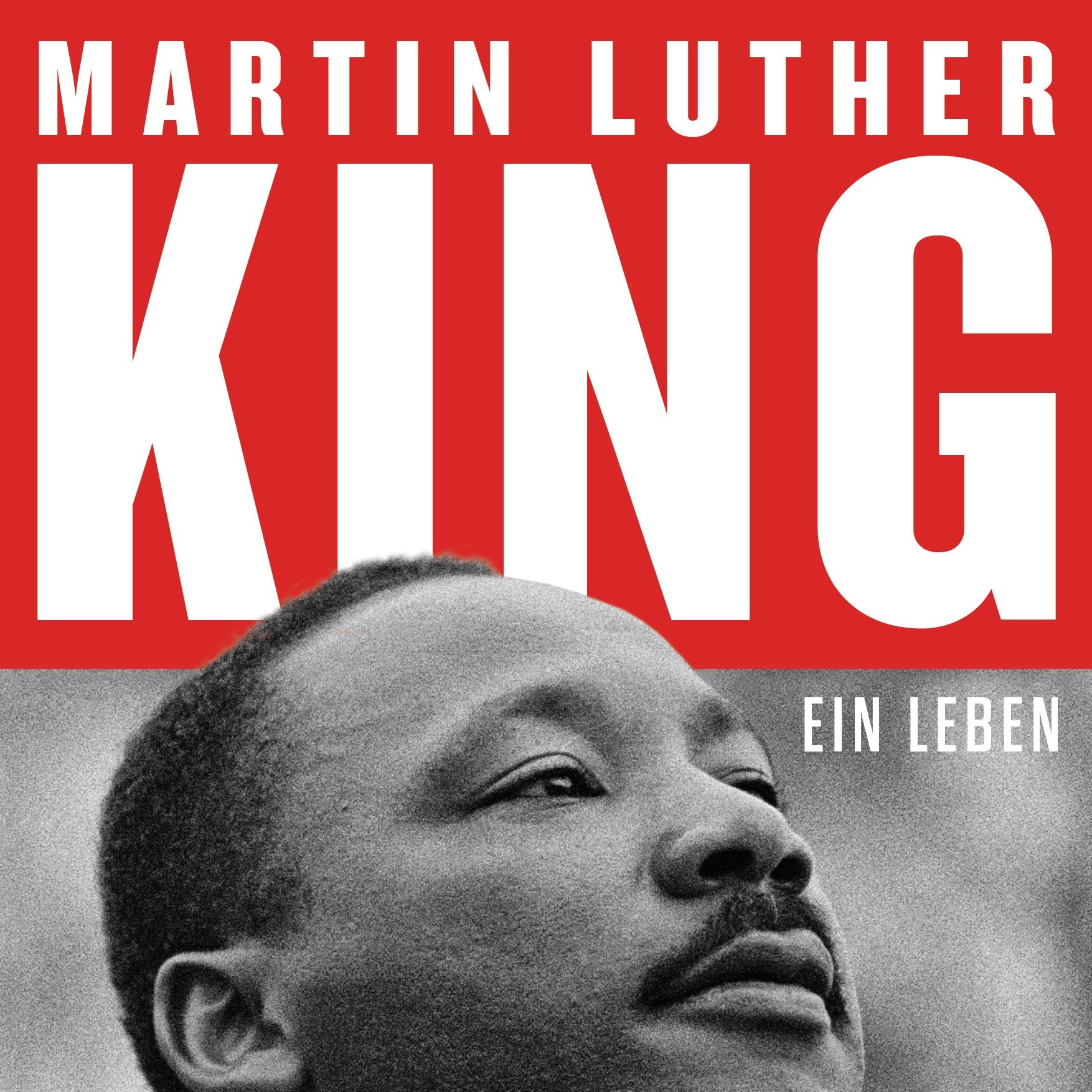
Das Wesen jeder feudalen und aller bürgerlichen Ordnung ist Repräsentation. Nach Stuart Hall ergibt sich im 20. Jahrhundert „eine kulturelle Revolution mit dem Einzug der Marginalisierten in die Repräsentation“.
mehr

In den 1960/70er Jahren verzweifelten die Kommunen am Bedarf und besserte im Containerstil nach. Die Kinderrepublik Westdeutschland platzte aus allen Nähten. Jeder Hort war überfüllt. Überall bildeten sich Schlangen. Pensionierte Handarbeitslehrerinnen wurden reaktiviert, um in den Freigehegen der Bildungsreform die Grenzen ihrer Leidensfähigkeit kennenzulernen. Das war egal, hatten doch die Zukunftsfähigen die beste Zukunft aller Zeiten vor Augen. Die Renten waren sicher und das Gesundheitswesen war kostenlos.
mehr

Am Ziel ihrer Träume angekommen wähnt sich die schwäbische Backpackerin Doris Steinbrecher, als sie auf Honolulu einen traumhaften Luxus-Retreat entdeckt. Als Schwangerschaftsvertretung für eine Yogalehrerin dockt sie an. Bald darauf wird sie selbst schwanger - von einem greisen kenianischen Guru, der die Geburt seines Sohnes nicht mehr erlebt. Keno wächst in einem Regime uferloser Weiblichkeit und in einer Riesenkrippe auf. Ein Dutzend lediger Mütter managt den spirituellen Hotspot.
mehr
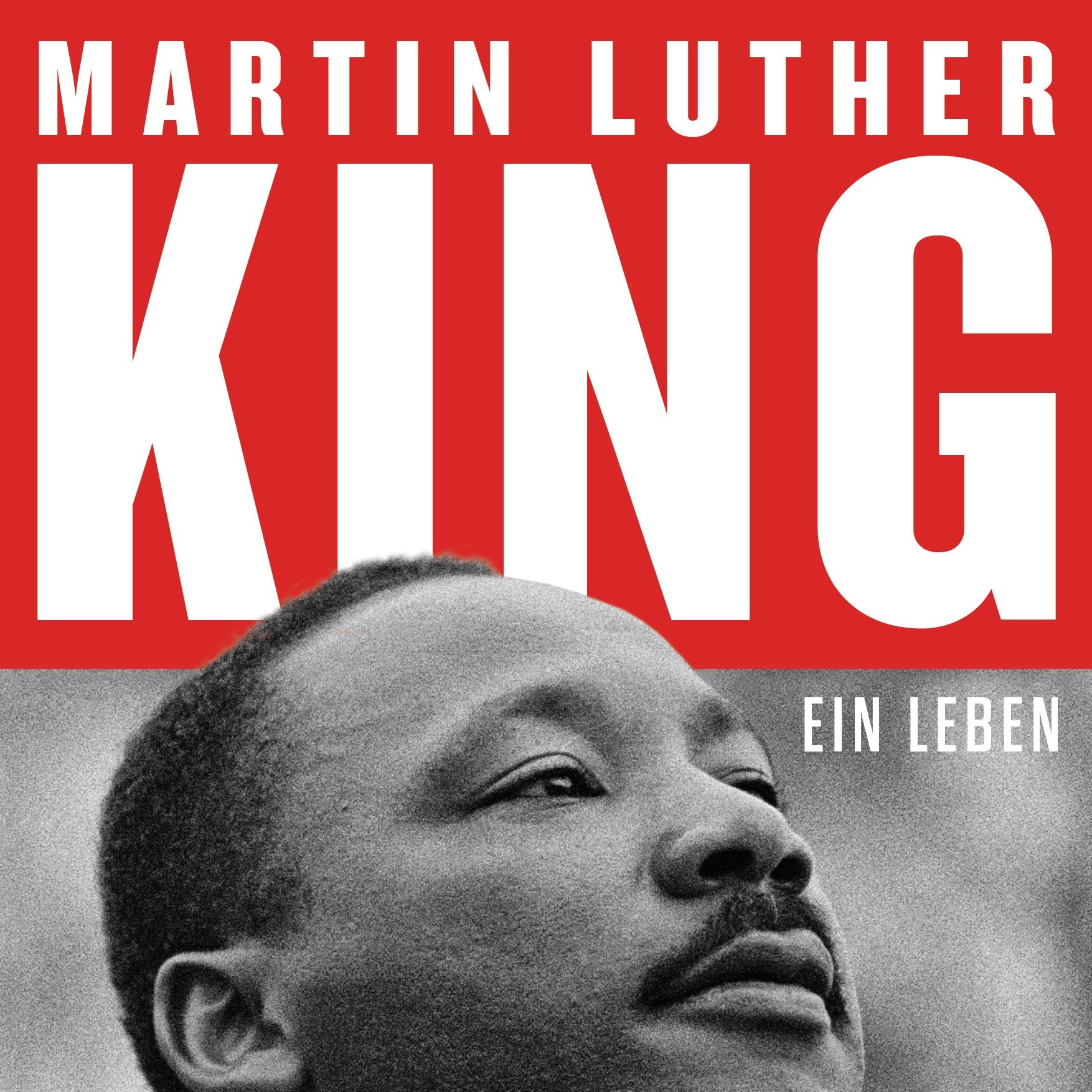
Die Weigerung der Afroamerikanerin Rosa Parks, ihren Platz im Bus einem Weißen zu überlassen führte erst zu ihrer Festnahme und dann zu einem Boykott der Busse. Der schwarze „Busboykott von Montgomery“ startete 1955 das Civil Rights Movement. Ein Motor dieser Bewegung war die „Southern Christian Leadership Conference“ (SCLC). Deren charismatischer Führer, ein Baptistenprediger aus Atlanta namens Martin Luther King, wurde 1964 Friedensnobelpreisträger.
mehr

Anton Steinbrechers Auftritt verspricht großspurige Gutsherrlichkeit. Wer käme auf die Idee, dass dieser schneeweiß ergraute Langhaarige in seinen butterweichen Reitstiefeln kein studierter Grandseigneur ist, sondern ein Elektriker mit fünfjähriger Volksschulbildung.
mehr
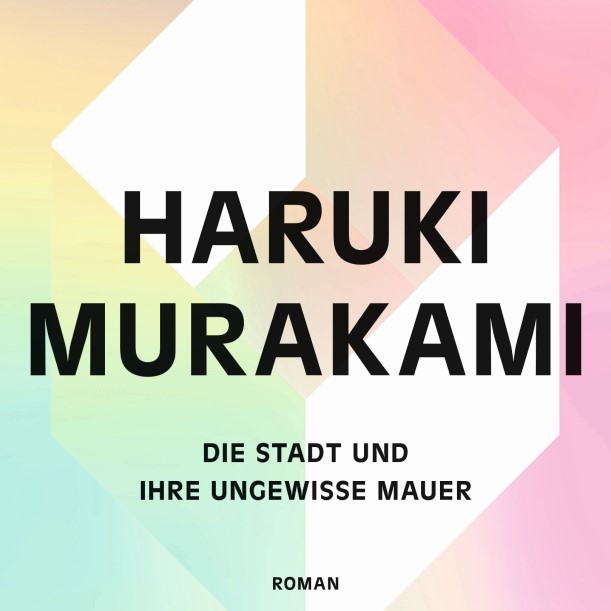
Im Zentrum der gemeinsam ausgestalteten Fiktion steht eine Stadt, gesäumt von einer acht Meter hohen Mauer. Ein Fluss teilt sie. Seine Ufer sind paradiesische Auen. Gehörnte Fabelwesen weiden von früh bis spät vor den Toren. Die menschlichen Bewohner sind Internierte. „Wer die Stadt betritt, darf keinen Schatten haben, doch wer keinen Schatten hat, darf die Stadt nie mehr verlassen.“
mehr

Die Königin von Saba hätte den Laufsteg bis ganz nach oben beschreiten können. Sie ging lieber mit der Bagage aus, mit Jungen, die es fertigbrachten auf einem Klo über ihrer Scheiße einzuschlafen. Die Väter waren nichts. Die Mütter waren die Mütter, was soll man da noch sagen.
mehr

Gruffydd begleitet den Jäger Yayan zu einem See im Norden von New South Wales. Die Lebensweise seines Führers erscheint ihm gemütlich. Gruffydd schreibt: „Fast alles unterwirft Y. seinem Belieben. Das Beschwerliche überträgt er seiner Frau.“
mehr

Vor Schmerz kurz vor dem furiosen Irrsinn rudert Murat im Schweiß. Annalena hält er für den letzten Lichtblick seines Lebens. Er hat sich selbst eingeliefert, der Welt schon fremd im Schlafanzug.
Annalena hat ein feines Gesicht und eine gleichgültige Art. Ihr Leben beginnt nach der Arbeit. Sie erzählt davon.
mehr

Die Patienten separieren sich an ihrem Tisch, wo sie ihre Krankengeschichten durchhecheln von den frühen Symptomen über das Stadium der Ungläubigkeit nach den Diagnosen, den vergeblichen und den hilfreichen Operationen bis zu den ersten und den sich daran anschließenden Erlebnissen der Invalidität, die sie zu Kennern der Materie und der Wartezimmer gemacht haben, so wie zu Spezialisten der Fernsehprogramme, zu gewieften Zeitungslesern und umsichtigen, jede Veränderung ihrer Umgebung skeptisch aufnehmenden Spaziergängern. Alle Patienten teilen die Erfahrung ...
mehr

Heinrich Tremper sah aus wie Heinrich George und trat auch so auf. Der Braubacher Gastwirt hatte einen Sohn, der ihm nach Berlin davonlief, da Bonvivant studierte und den Boulevard brutalistisch aufmischte. Will Tremper (1928 - 1998) verfügte über die Reflexe eines Boxers und das sanguinische Temperament einer Balinesischen Tempeltänzerin. Fit hielt er sich mit Getränken.
mehr

Das Habsburger Reich erwehrte sich der Pest erfolgreich mit einer Befestigung seiner Außengrenzen: einer Sperrzone von Kroatien bis Moldawien. Das Osmanische Reich stellte es mit militärischen Mitteln unter Quarantäne.
mehr

In ihrer Blütezeit übertraf Tenochtitlan alle anderen Städte Amerikas an Größe und Pracht. Wie „Dorftölpel“ staunten die Konquistadoren unter der Führung von Hernán Cortés 1519 über Avenuen und Kanäle zwischen den Einschüchterungsmonumenten in der Kapitale des Aztekenreichs. Paris, damals Europas bedeutendste Metropole, war kleiner und weniger glanzvoll.
mehr

Montagnachmittag kommen die Patienten zu Grete, Fünfzigjährige, die Wasser trinken. Hinter ihnen liegen Ehen und Krankheiten, an denen man sterben kann, und das Gefühl der Unverwüstbarkeit. Die Männer waren früher gut beieinander, man ahnt es noch. Sie bekleideten Posten. Sie sind nun ausgesteuert. Das sagen sie so. Sie arbeiten nicht mehr, abgesehen von Willi, der Taxi fährt, weil er das braucht. Willi erfüllt besondere Aufgaben in der Gemeinschaft.
mehr

Die ersten Abriegelungen erscheinen in ihren Übertragungen wie Dreharbeiten zu Filmen, die erschrecken sollen. Dann wird die Mailänder Modewoche abgesagt. Eine Flugzeugträgerin der italienischen Wirtschaft läuft nicht aus.
mehr

Scherzend passierten Ordonnanzen vom Wind bewegte Gehängte im gestreckten Galopp. Der aus Ysgubor-y-coed/Cardiganshire gebürtige Llewelyn verzog sich, begleitet lediglich von zwei im ozeanischen Stil skarifizierte Spitzbuben Richtung Wales. Ein paar hundert Jahre später reist ein Nachfahre des Verlierers um die halbe Welt nach Australien. Substanzlos jung ist dieser Lord Gruffydd of the Marches. Er tritt als Journalist auf.
mehr

Beim Abendessen in Kings Haus lernt Pechstein den Walfahrer und Robbenschlächter Mayhew Folger kennen. Ihm wird es 1808 gelingen, Pitcairn wieder einmal zu entdecken und den einzigen weißen Überlebenden einer Mordserie, den auf Blutfesten bis zum Wahnsinn gläubig gewordenen John Adams, im Kreis seiner Liebsten zu treffen.
mehr

Ich las eben, dass von zwölf Kauffahrten vor 1612 acht unglücklich verliefen. Dennoch ergab sich ein durchschnittlicher Gewinn von zweihundert Prozent. Dabei kamen zum kauf- und seemännisch-regulären Gelingen illegale Erwerbungen. Raub und Diebstahl zu Lande und auf See bestanden gleichmäßig neben geschäftsförmigen Abwicklungen und wurden ordentlich vermerkt. Die irrwitzig hohe Ausfallrate bei Seeleuten war egal.
mehr
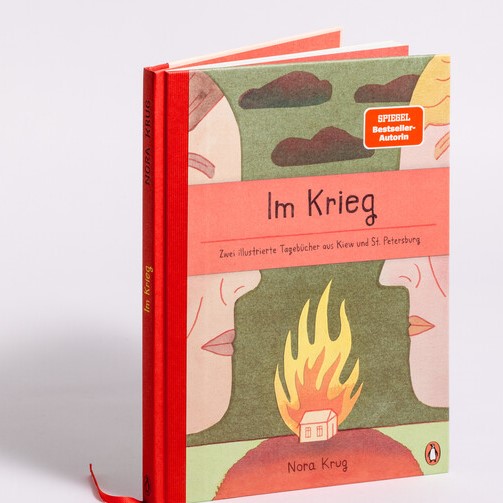
„Jahrzehntelang hat die Welt das revisionistische russische Narrativ geduldet, dadurch indirekt Russlands expansionistische Politik und genozidale Vorgehensweise unterstützt und damit das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine untergraben.“
mehr

Noch halten viele Leute Corona für etwas, dass nur die anderen kriegen. Westliche Experten stufen das Corona-Risiko in ihren Ländern als „mäßig“ ein. Gemeinsam mit dem Rest der freien Welt kritisieren sie die Chinesen. Aus China erreichen uns Bilder von gespenstisch leeren Straßen. Wir wissen natürlich, da ist alles gefiltert und von der Partei geklärt, vor allem jedoch auf Asien beschränkt ...
mehr

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts karikieren drei gleichzeitig waltende Päpste das christliche Weltbild. Die Anarchie von oben eliminiert Sicherungen und Stabilisatoren der Herrschaft. Sie zerstört das Fundament der mittelalterlichen Gesellschaft. Die ritterliche Gefolgschaftstreue verliert ihre grandiose Dimension. Die Scholle verliert ihre Bindungskraft für die Leibeigenen. Das Patriziat verliert seine Sperr- und Riegelfunktionen.
mehr

Die schottischen Neumieterinnen beschimpfen ihre Besucher auf dem Balkon. Sie haben einen Hampelmann mit Strapon (Anschnalldildo) an ihrer Balkonbrüstung aufgehängt. Wayne hört die ratlose Entrüstung junger Männer, eben waren sie noch obenauf. Die Wohnung ist an sich zu klein für vier Rabaukinnen. Die Spiele-Entwicklerinnen machen die Nacht zum Tag im Treppenhaus. Sie gießen Gin in die Gemeinschaftstopfpflanzen. Sprotte kichert auf ihrem Horchposten, der Engländer schaltet sich ein, Wayne versteht kein Wort.
mehr
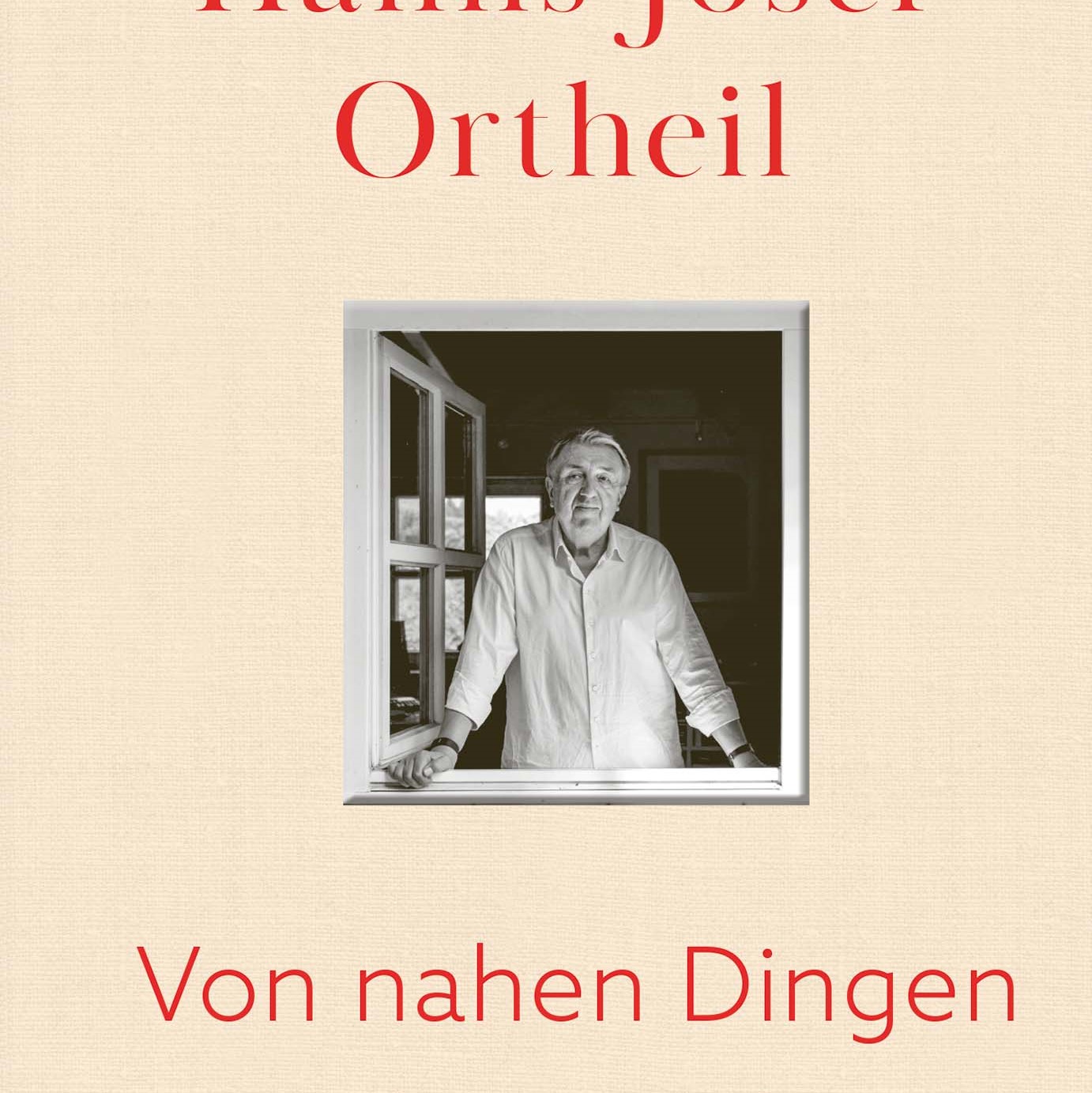
„Von nahen Dingen und Menschen“ betitelt eine Glossensammlung. Dreh- und Angelpunkt der ausgebauten Notizen ist die Pandemie ab Februar 2020. Ortheil beschreibt die Impfeuphorie im Freundeskreis nach einer Zeit der bangen Separation. Er rezensiert die Manier der Sportberichterstattung und kritisiert den häufig unsinnigen Gebrauch des Wortes „definitiv“.
mehr

Karolin hat die Schublade entdeckt, in der Wayne Streichholzschachteln versammelt. Karolin hält Streichhölzer für Gebrauchsgegenstände.
mehr

„Wer kennt das nicht: Ein wichtiger Termin steht bevor, aber vor lauter Aufregung bringen Sie keinen klaren Gedanken zusammen. Die Botenstoffe im Körper sind falsch eingestellt, statt sympathisch und kompetent kommen Sie gestresst und fahrig herüber, und so hilft nur ein falsches Lächeln. Oder gibt es einen anderen Ausweg? Was, wenn es eine Methode gibt, die Ihnen zielgerichtet erlaubt, gewisse Stimmungen herzustellen? Was, wenn wir Ängste, Aufregung, Lustlosigkeit einfach überwinden könnten, um unsere beste Leistung abzurufen?“
mehr

Antigone studiert noch. Sie ist als Schwangerschaftsvertretung mit von der Partie. Für sie sind Nudeln manchmal schon das Beste, was ein Abend bieten kann. Manchmal langweilt sich in der Gesellschaft älterer Schwadroneure und merkt wohl, wie verschwenderisch sie ihr Leben ausgibt.
mehr

Wenden wir uns kurz dem aus Lübeck gebürtigen Ex-Handball-Halbprofi und Arzt Gerkan B. zu. Zu Hause erwartet Gerkan die Unternehmerin Dara R. gestiefelt und gespornt für einen Ausritt im Offroader. Das Paar lebt im Urlaubsparadies Meckpomm. Im lautlosen Faktencheck vergleicht Gerkan die Arzthelferin Angelika mit Alena, einer Assistentin seiner Frau. Im Osten heißen die Arzthelferinnen Schwestern.
mehr
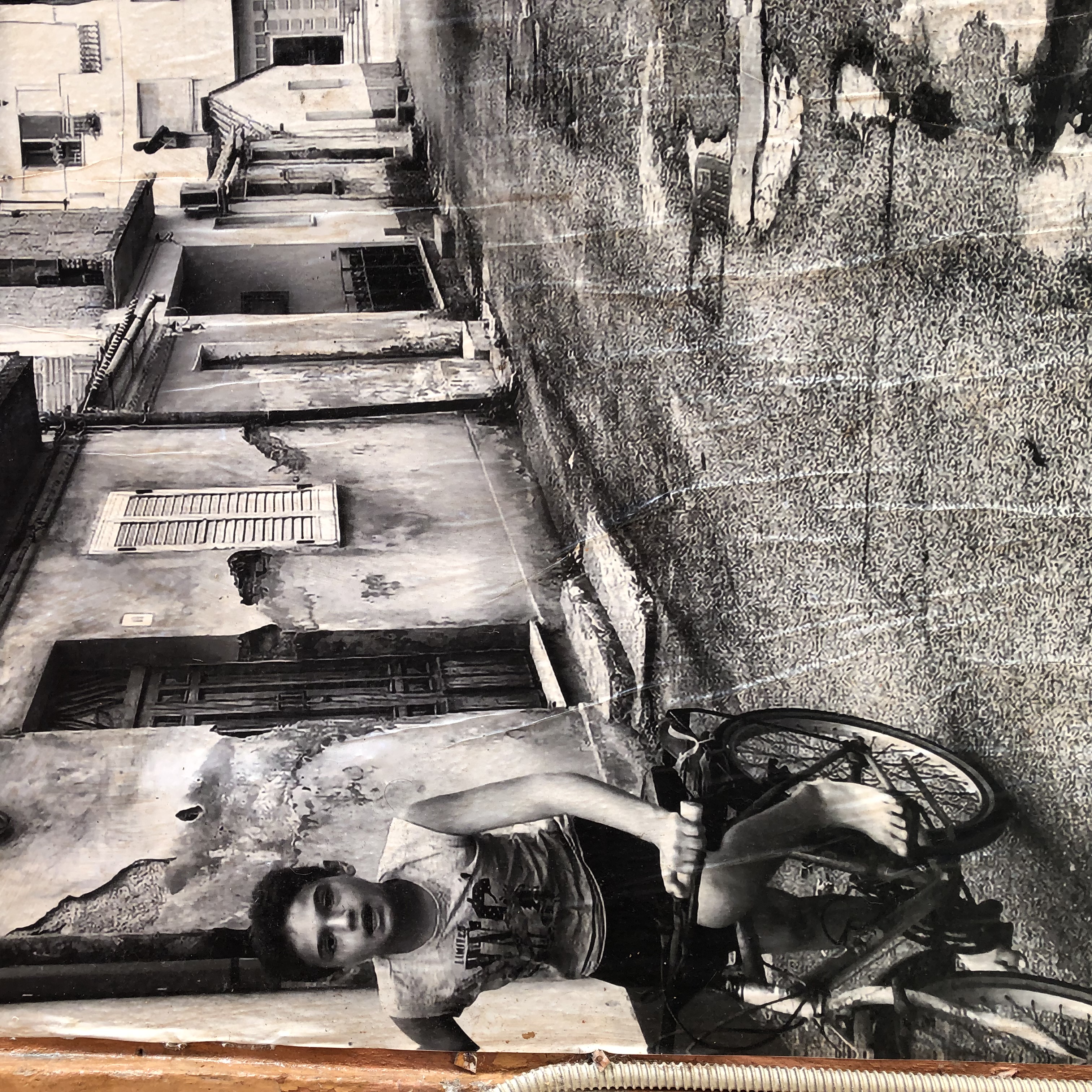
Der Gegenwind stemmt Hartmut fast von der Maschine. Er erlebt einen fadenscheinigen Moment der Freiheit. Das ist natürlich lächerlich. Spielarten der bürgerlichen Lebensangst und Selbstentfremdung lassen sich aus den Introspektionen des häuslichen Selbst gewinnen. Das ist wie Keschern im Aquarium; man hat alles in einer Pfütze.
mehr
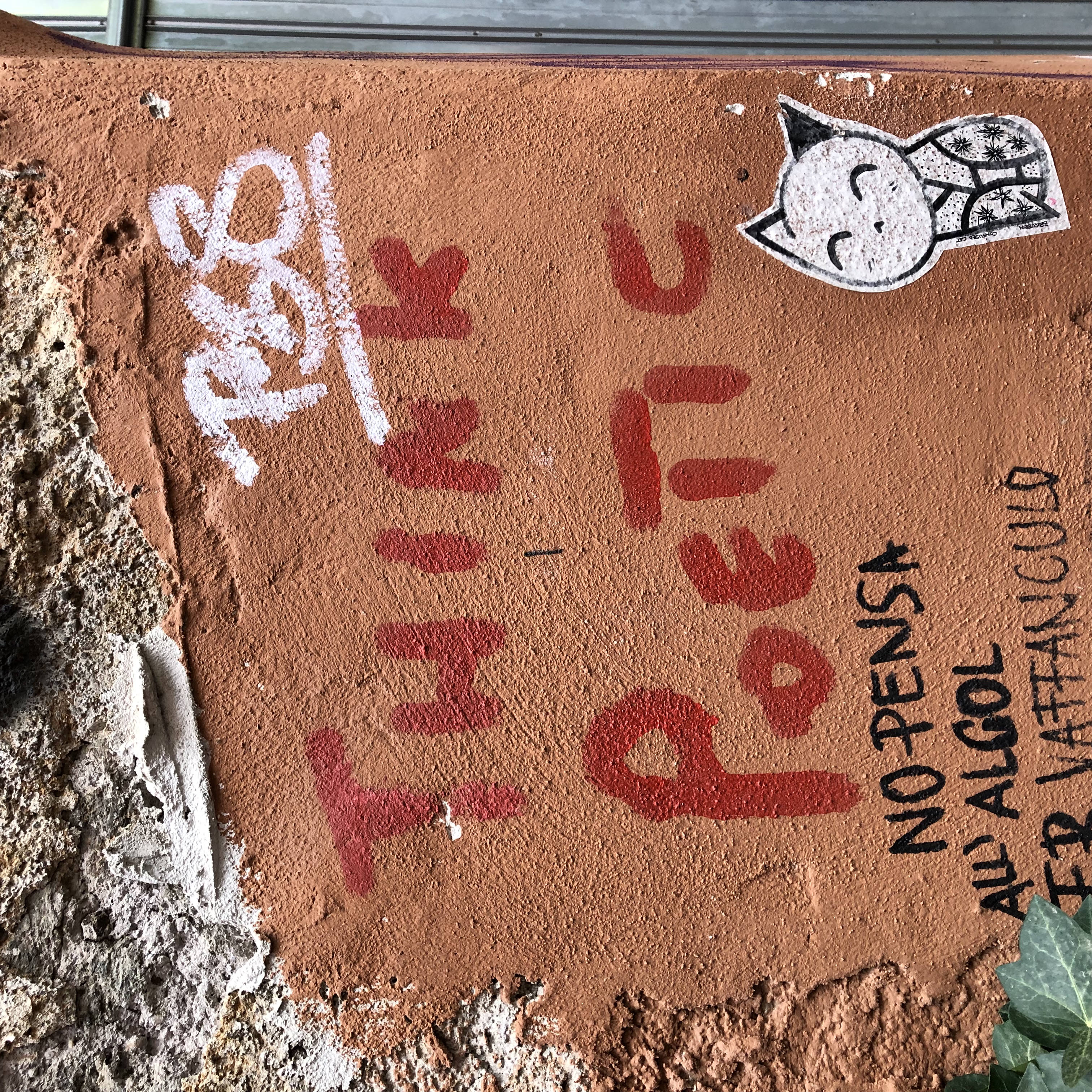
Wayne kaufte sie 1982 für fünfzig Mark. Ankauf von privat. Die Hausfrau erklärte umständlich, warum sie sich von dem guten Stück zu trennen bereit war. Sie hatte sich mit einer modernen Maschine ausgestattet und wollte mitfühlend eine junge Familie mit der alten Maschine versorgt wissen. Einkleiden und bekochen waren für sie zwei Seiten einer Medaille.
mehr

Schade um den schönen Durst sagte man in Waynes Kindheit, wenn einer „ein Cola“ bestellte oder, was noch zweifelhafter war, Zitronensprudel. In Pilsstuben hatte man Pils zu trinken, aus Nullzweilitergläsern, mit abnehmender Trinkgeschwindigkeit. Allein die ersten drei waren im Nu zu leeren, anderenfalls ergaben sich Nachfragen, etwa, ob man „vorgetrunken“ habe. Das folgte einem strikten Reglement.
mehr
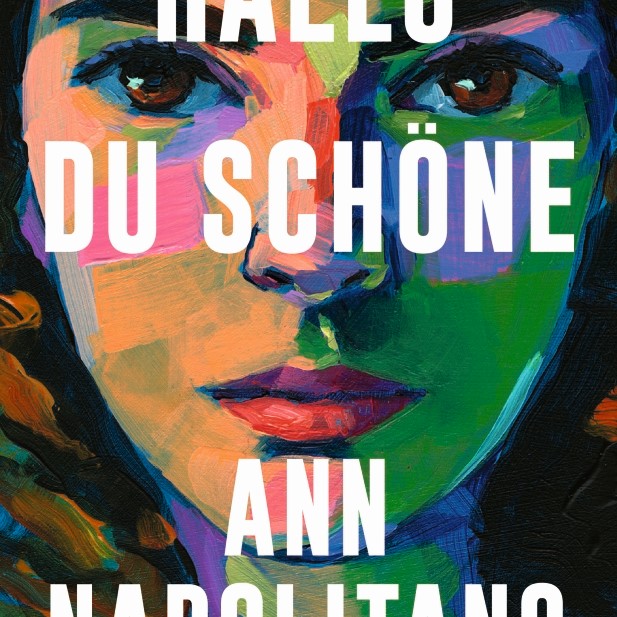
Julia entscheidet sich für William. Kurz wähnen sich beide am Ziel ihrer Träume. Dann erkennt jeder seinen Irrtum.
mehr

Wayne lebt auf dem Grund eines ozeanischen Beckens, auf einer vor hundertfünfzig Millionen Jahren gesunkenen Scholle. Das Nordend war die längste Zeit ein namenloses Flussbett, bis der Main und die einst amazonasbreite Nidda es freigaben. An Khans Kiosk hängt ein Bembel in seinem grünen Kranz. Das ist ein Sakrileg. Der Kranz ist das Zeichen selbst kelternder Wirte.
mehr

Für dauerhaft gelten kurze Fristen. Wer zwölf Monate durchgehalten hat, kriegt einen Traditionswimpel ins Fenster gestellt, das ist Karolins fünfte Einnahmequelle. Als Malteserengel gibt sie am Cityring Methadon ab und nimmt Urinproben an. Sie wacht über die Dinosaurier im Senckenberg Museum, hilft im Steinweg Seniorenstift, jobbt in der Burggaststätte und ...
mehr

Karolins Mutter animiert ihren Mann zum Jodeln. Karolins Ziehvater kann die Registrierkasse in Money jodeln. Karolins jüngste Halbschwester ist zum zweiten Mal schwanger. Das wird weiter nicht erwähnt und gilt als heikles Thema. Was heißt, weiter nicht erwähnt. Karolins Mutter hat kein anderes Thema und muss sich ständig auf die Zunge beißen, weil ihre Älteste noch kinderlos ist.
mehr

Wenn Karolin genug hat von einem Abend, sagt sie: „Wir sind müde“, egal, ob Wayne müde ist. Sie merkt sich die Geschichten der Dinge nicht, die sich im Museum versammeln. Einen ausrangierten zur Dekoration abgestiegenen Bembel hat sie wieder in Dienst gestellt. Jede Veränderung, die nicht auf seinem Mist gewachsen ist, findet Wayne verkehrt. Nie würde er den Kleiderbügel belasten, der aus der Zeit stammt, als die Familie eine Gaststätte mit Pension betrieb. Lange existierte der Bügel gesondert von der Garderobe.
mehr
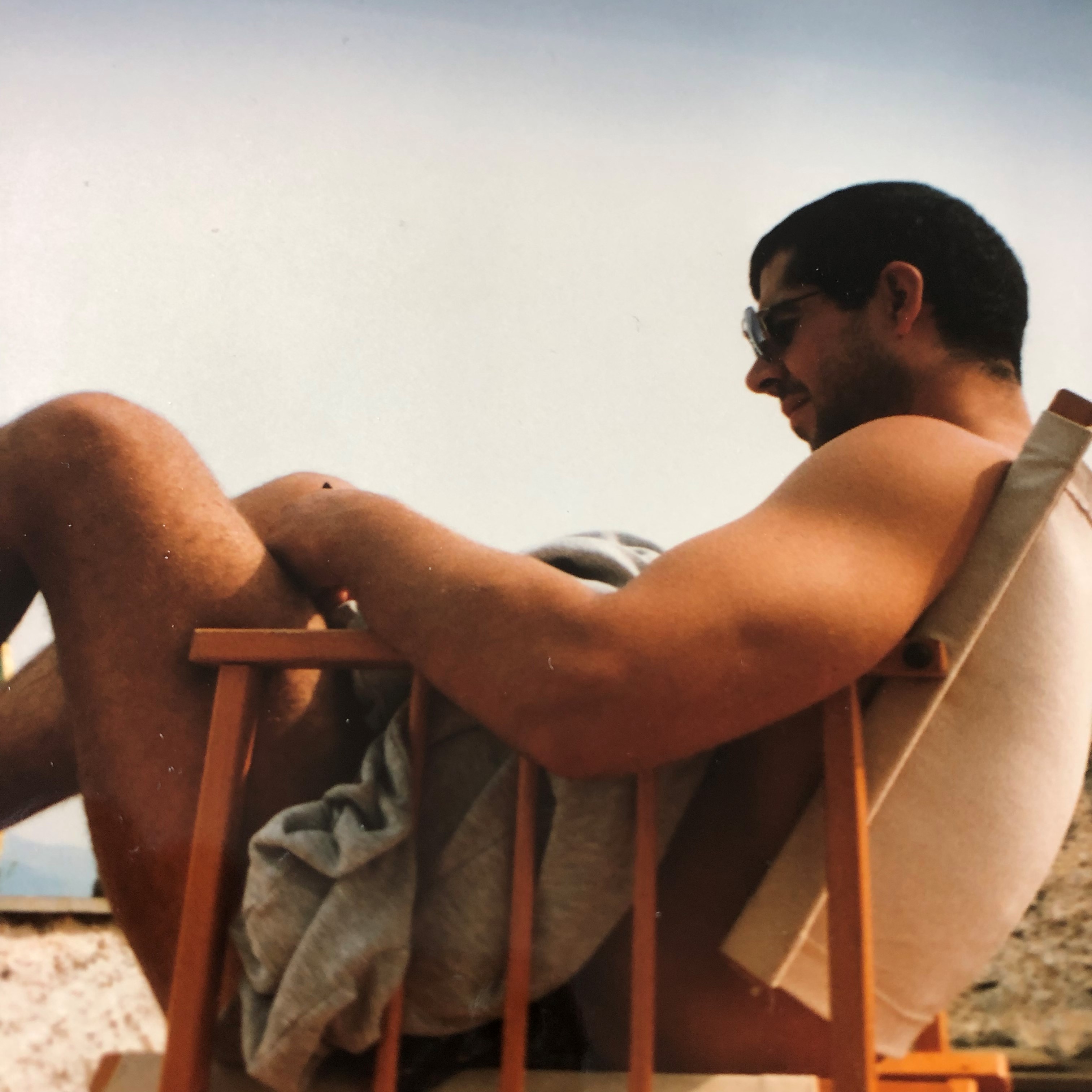
Wayne bläst einer Kerze das Licht aus. Funzelgemütlichkeit ist stets verdächtig. Sie führt direkt einen Gulag studentenblöder Lebensart. Wayne findet auch die Tischdecke zweifelhaft. Er findet, dass Karolin vorhin zu viel von der Aldi-Lasagne gegessen hat. Plötzlich fällt Wanne ein, dass Karolin nach der ersten gemeinsamen Nacht einen Aidstest von ihm ...
mehr
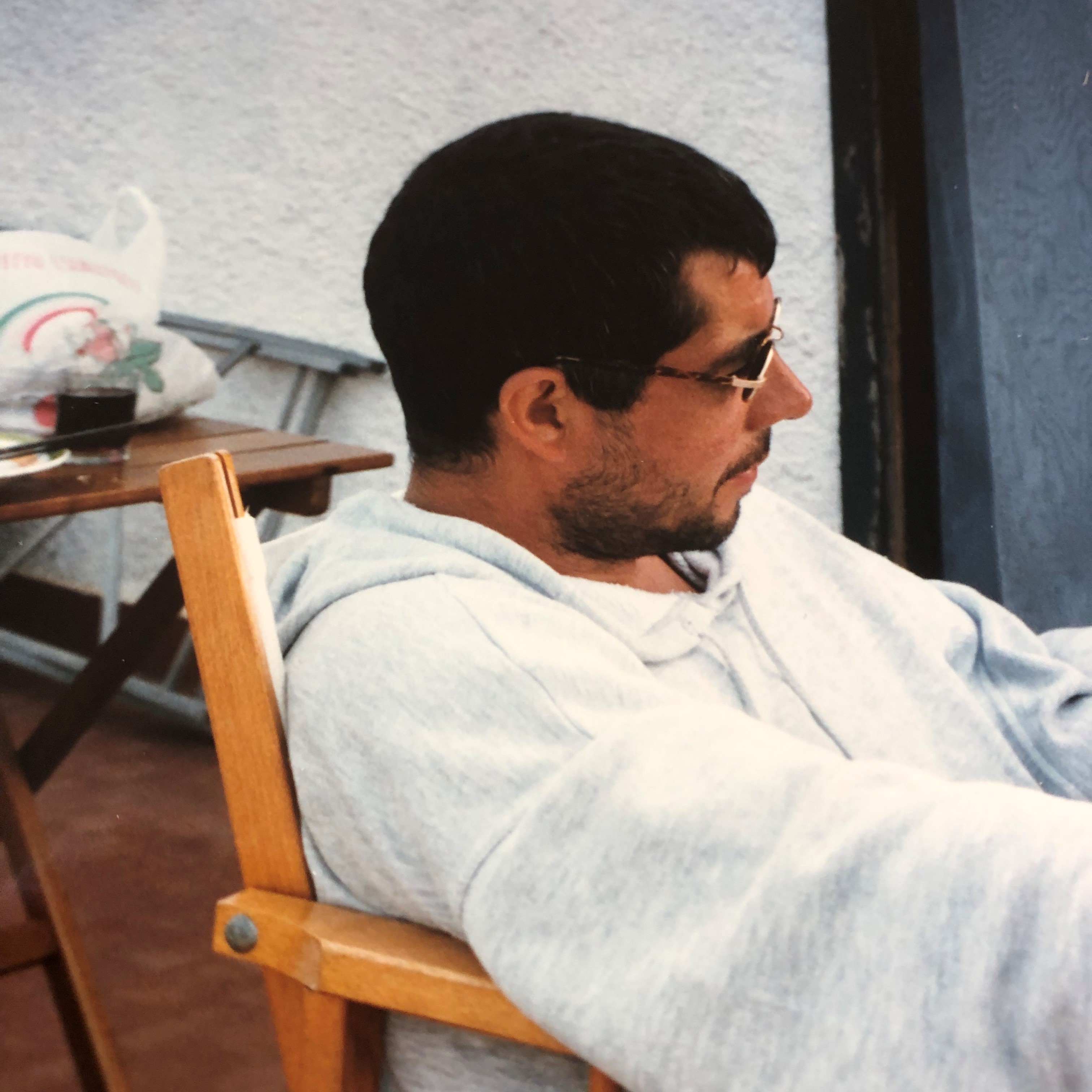
„Man stumpft ab“, führt eine Schauspielerin aus. Die Figur ist ein Kampfresultat, aber was, um alles in der Welt, macht man mit müder Haut. Der Haut ist das Kampfgeschehen doch Jacke wie Hose, die könnte sich auch an ein gelasseneres Skelett hängen, so evolutionär indifferent ist die Haut zu ihrem Glück.
mehr

Wayne sitzt in einer unterirdischen Kabine vor zerfledderten Magazinen. Sein Vater starb im Bürgerhospital, gewiss wäre er gern früher gestorben, mit mehr Mark in den Knochen. Eine verhärmte Frau, von der Wayne noch nie gehört hatte, hielt an seinem Bett aus bis zum Schluss. Die Sexszenen helfen kaum, die Hefte wurden Wayne von einem weiblichen Alberich im Kittel der Unantastbarkeit zur Verfügung gestellt. Vor der Tür lauern Gespenster. Karolin ist im Kinderladen.
mehr

Karolin fällt ein Ball vor die Füße, sie spielt Wayne ungeschickt an. Kinder holen sich den Ball zurück, mit Blicken, die deutlich zeigen, wie sehr sie an der Welt zweifeln, angesichts solcher Erwachsener. Karolin sagt etwas zu ihrer Entschuldigung, das sollte sie lassen.
mehr

Mandelstam ist ein weicher Fels und Knapp-vorbei-Mann bei allen Hauptrollen, die im alten Nordend zu vergeben waren. Alt in der Perspektive von Vierzigjährigen. An der Vergangenheitsform lässt sich nicht rütteln. In der Gegenwart dieser Geschichte sind alle Verfehlungen endgültig.
mehr

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in Frankfurt am Main - wie in anderen deutschen Städten auch - zu Kooperationen zwischen eingesessenen und amerikanischen Gangstern, die als GIs ins Land gekommen waren. Über Nacht entmachteten die überseeischen Sieger die alten Gebietsfürsten. Das Frankfurter Nordend übernahmen mexikanische Kalifornier.
mehr

Die Verachtung schoss mit der Muttermilch auf das weiche Ziel des Säuglings. Sie wohnte mit den Leuten zusammen wie Schwamm im Gebälk. Sie saß fest im Sattel der Verhältnisse, die ganz natürlich nach Gärung rochen und nach Fremden, die sich willkommener fühlen sollten als der Sohn. Auch der Vater des Königs hieß Michael. Man nannte ihn Diamant-Michel ...
mehr

Der König spricht vom Notstand „in der Latrine“. Die Ansprache trieft vor Verachtung für das kleine Licht im Klo der armen Leute. Königlicher Dünnschiss bekäme jederzeit eine Audienz in den gediegenen Verhältnissen des ersten Stocks. Da sagt kein Namensschild den Bewohner an. Dass weiß man, wer da wohnt, es sei denn, man weiß gar nichts.
mehr

Das Viktorianische Zeitalter entmündigte Frauen. In Michigan scheiterte Sarah bei dem Versuch, als Frau allein zu leben. In der Konsequenz dieser Erfahrung präsentierte sie sich als Mann. Interessant ist, wie einfach das war. Sarah schnitt ihr Haar, band die Brüste ab und zog Hosen an. Maskuline Attribute in der Preisklasse eines billigen Anstrichs garantierten Bewegungsfreiheit.
mehr

Pedro de Mendozas war Oberschenk der spanischen Krone. Er konnte seine eigene Flotte auf den Grund des Meeres schicken, ohne Pleite zu gehen. Am 24. August 1534 spuckte Mendoza zum letzten Mal in das Hafenbecken von Sevilla. Er startete mit vierzehn „stolzen Gallionen“ (Pero Vaz de Caminha) und hundertfünfzig Deutschen (und Holländern) an Bord. Insgesamt brachte Mendoza zweiundsiebzig Pferde und die Blüte seines Landes in die Neue Welt ...
mehr

Viel zu viel Milch ist in dem Milchkaffee, den Hans Hegemann persönlich schäumt, noch verquollen vom Feierabend, der vorhin erst zu Ende gegangen ist. Die Frühschicht schon wieder zu spät. Der launisch-mürrische Hinweis darauf, läuft auf die Vorformulierung einer Kündigung hinaus, in vorsichtiger Vorläufigkeit.
mehr

Alexander von Humboldt sah, wie ein erdgeschichtlicher Hochofen rasend schnell den eigenen Krater vom Schnee befreite.
„In dunkelroter Gluth erhob sich die Feuersäule des aufsprühenden Schlackenregens zu gewaltiger Höhe. Der Berg empörte sich so furchtbar, dass man seine Beschwerde (im kolumbianischen) Honda vernahm“ - eine Entfernung von achthundert Kilometer in der Luftlinie.
mehr

Beim Frühstück auf dem Balkon memoriert Wayne eine Phase, in der er im Bademantel seine Nachtasyle abgeklapperte. Das war verrückt, denkt er. Wenn man Geld hat, werden einem die Erscheinungen des Wahnsinns als Grillen ausgelegt. Unter ihm kreuzt die neue Erzieherin auf. Sie sucht ihr Feuerzeug ...
mehr

Die Tänzer schwelgen auf einer sinnlos betonierten Fläche. Ein Einkaufswagen wird über den Platz geschoben. Wayne träumt von einer Diktatur der Bäume. Die Sorgfalt der Abstände. Vor Jahrhunderten in Reihen gepflanzt und jetzt stehen sie ganz groß da.
mehr

Müßiggänger bleiben vor der Kneipe hängen. Der Ire könnte als Sizilianer alten Schlags besetzt werden. Immer wieder gerät Jim in sagenhafte Schwierigkeiten, dann finden im Nordend Verfolgungsjagden statt. Jim räumt Stühle und Schirme ...
mehr

Opa sitzt die Restzeit ohne Freude an seiner Weitsicht ab und kommt lediglich zum Sterben nach Hause. Bis zum Schluss erwartet er von den Nachkommen Unterwerfung und Einsicht in ihre Unzulänglichkeit. Beim Streuselkuchen nach der Beerdigung sagt Vater: „Gut, dass er tot ist.“
mehr

Eines Abends versteinerte Oves Frau bei der Anhörung einer Liebeserklärung ihres Mannes, die nicht für sie bestimmt war. Sie brach sofort auf und wurde im Auto von einem Herzschlag tödlich getroffen. Am nächsten Tag stand Ove mit einem Koffer bei Nanna vor der Tür.
mehr

Ove war verheiratet und Vorsitzender des Festausschusses, Frankensteins drittwichtigstem Zusammenschluss. Er warb offensiv um Nanna, sie ging so weit, sich mit mir zu beraten und ich ging so weit, sie zu ermutigen. Sie ging dann unter Aufsicht fremd. Meine Eifersucht brachte mich fast um.
mehr

Im Sauerland gab es zwei Kinder und eine an Dennis nicht mehr interessierte Angela. Der Ex-Major zeigte Familienfotos. Höhepunkte der Kollektion waren - nach der Rammstein-Ästhetik inszenierte - Modellaufnahmen der Ex-Ehefrau. Sie stammten von einem Friseur, der sich auf häusliche Erotik spezialisiert hatte.
mehr

Alima und Said sind viel zu höflich, um mir meine Provinzialität vor Augen zu führen. Said ist in England zur Schule gegangen. Er liebt den englischen Nebel und die Zauberstimmungen keltischer Landschaften. Er hat schon früh gelernt, alles für vorläufig zu halten. Ich flüchte vor meinen Allgemeinplätzen in die Rolle des guten Zuhörers.
mehr

Die Familie ist in G... so aufgeschlagen, als wäre in Berlin kein Platz mehr gewesen. Sie hat nichts mitgebracht, was vor Ort zählt. Hanna fühlt sich trotz entzündeter Existenzzahnhälse großstädtisch überlegen. Das fasziniert mich.
mehr

Auf Nebenwegen und Friedhöfen, vor mythischen Wasserhäuschen und Höhleneintrittsstellen beschwören die Eingeschweißten die Gesetze ihrer Gemeinschaft. Wayne riecht Rauch. Rauch im Sommer bedeutet, der König verbrennt illegal Kram im Kamin der Burg.
mehr

Ein Vierteljahrhundert nahm Vater keinen Tag Urlaub. Darauf war er stolz. Nachts goss er Aluminiumformen. So versicherte er sich gegen eine instabile Stromversorgung, die tagsüber drohte. Die Trafostation am Ende der Straße war ein Schwachpunkt. Stets bot sie sich dazu an, der nächsten Katastrophe den Weg zu ebnen. Stromausfall war die Höchststrafe. Die Station stand in einer Fertiggarage und war modellhaft für das ...
mehr


Auf dem Grund einer Tiefkühltruhe, die ich 2005 vor ihrer Verschrottung enteiste, lagerten Erdbeeren, die 1971 unter Koteletts von 1980 und einem Beutel mit Geschmeide eingefroren worden waren. Meinen Eltern war es unmöglich, etwas wegzuschmeißen. Es wurde alles verarbeitet und aufgehoben. So entstanden Saftflaschenkolonien, auf die der Staub von Jahrzehnten sank.
mehr
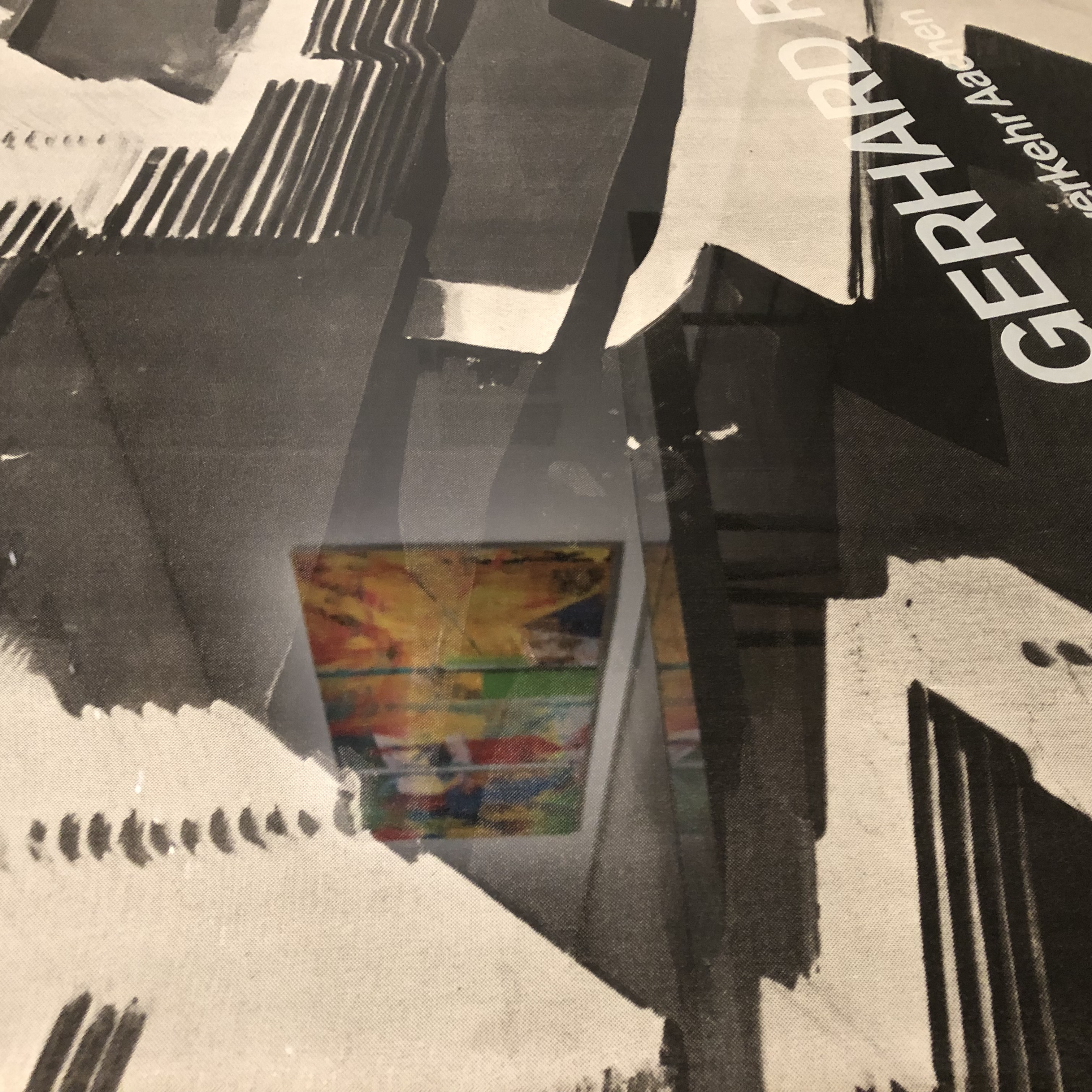
Das Herrenzimmer, in dem ein Kamin bis heute nicht fertig gemauert ist, konnte stromfrei geschaltet werden. Ein rotes Licht zeigt das futuristisch an. Seit über dreißig Jahren wird die Wohnung als Lager genutzt, Staub begräbt den Schick einer anderen Zeit. Die Stromsperre funktioniert noch. Der Geist des alten Zauberers materialisiert sich im illuminierten Schalter.
mehr

Honoka Yukishiro Sensei unterrichtet in einem Wolkentheater. Um ihr Dōjō zu erreichen, muss man sich von einem Hubschrauber abseilen. Die Meisterin erscheint dem geblendeten Auditorium wie eine melancholisch in die Jahre gekommene Prinzessin. Alles ist Fluidum, Sendung, Zen - archaisch und aristokratisch.
mehr

Azita G., eine Frankfurterin mit kurdisch-iranischen Wurzeln, ist durch und durch Kampfsportlerin. Sie lebt Budo. Kein Tag ohne Training. Azita erweitert ihr Repertoire in Lehrgängen. Sie ist die Frau in der Highend-Version eines Trainingsanzugs, mit der monströsen Umhängetasche und Jumbowasserflasche, die ihre Wochenenden in Vorstadtturnhallen verbringt ...
mehr

Die Fleisch- und Fischlieferanten treten in urtümlichen Szenen auf. Manchmal kommt ein Jäger mit dem Wildschwein quer auf dem Motorradtank. Es gibt keine städtischen Verblendungen bei der Verarbeitung von Lebensmitteln.
mehr

Ariane schob sich einen Ring auf den rechten Zeigefinger, sie kannte den Namen seines Steins. Es war ein Amethyst.
mehr

Am 28. Januar 1986 endete der NASA-Weltraumflug STS-51-L gleich nach dem Start. Die Raumfähre zerbrach in einem Bild. Ein vielfach gewundener Explosionsschweif mäanderte über den Himmel. Das hatte die Welt noch nicht gesehen. Zu den Opfern des Unglücks zählte Judith Arlene ‚Judy‘ Resnik, deren Eltern aus der Ukraine nach Ohio gekommen waren.
mehr

Die Niederlande rivalisierten mit den Supermächten Spanien und Portugal und waren doch selbst spanischer Herrschaft unterworfen. Niederländer rückten in den Kolonien nach und auf. Sie profitierten vom lateinischen Despotismus, der ganze Völker in die Halsstarrigkeit trieb und sie zugleich empfänglich machte für angenehmere Umgangsformen.
mehr

Die ungenaue Küstenlinie Australiens wurde noch auf Karten des 17. Jahrhunderts neuholländisch genannt. Die Niederlande rivalisierten mit den Supermächten Spanien und Portugal und waren doch selbst spanischer Herrschaft unterworfen. Niederländer rückten in den Kolonien nach und auf. Sie profitierten vom lateinischen Despotismus, der ganze Völker in die Halsstarrigkeit trieb und sie zugleich empfänglich machte für angenehmere Umgangsformen.
mehr

1813 stellt Napoléon in Dresden seinen Egoismus über französische Interessen. Er erklärt sich in der Gesellschaft des Fürsten Metternich. Anders als ein geborener Fürst, dessen Rang am unglücklichen Ausgang einer Schlacht keinen Schaden nehme, so Napoléon, dürfe er (als Sohn des Glücks) nicht verlieren.
mehr

„Banalitäten feierlich gesagt, einfache Vorgänge barock dargestellt.“ - In einem Feuilleton von 1929 analysiert Kurt Tucholsky das Genre der Sexschmonzette. Der Kritiker stellt eine „Betrachtung mit dem Spazierstock“ darüber an, „wie man es nicht machen soll“. Er scheidet „geniale Psychopathen“ von jenen Laumännern, deren „erhitzte Impotenz“ schwüle Niederschläge zeitigt.
mehr

Im August 1793 fällt Toulon von der Revolution ab und übergibt sich royalen Kräften. Eine britisch-spanische Allianz zieht vor der Hafenstadt Schiffe zusammen, sie prahlt mit neuntausend Kanonen. Die Bedränger des republikanischen Frankreichs setzen sich mit achtzehntausend Mann hinter respektablen Mauern fest.
mehr

„Dürfen darf man alles - man muss es nur können.“ Kurt Tucholsky
mehr

Rodrigo Borgia gab seiner Epoche das Gesicht, er war der Renaissancefürst. In der Frage, wie funktioniert Macht, bot sich Borgias Sohn Cesare B. Niccolò Machiavelli als Zentralgestirn der Inspiration an. Was aber geschah der königlichen Kirchenmaus Elisabeth in ihrem Armenhaus England? Wollte sie Querelen vermeiden, brauchte sie eine eigene Route zu den Gewürzinseln und allem, was sagenhaft war im Fernen Osten.
mehr

„Dutzende Male haben Luther und Erasmus die gleichen Gedanken ausgesprochen, aber was bei Erasmus bloß einen feinen … Reiz auf die Geistigen ausübt, eben das gleiche wird bei Luther dank seiner mitreißenden Art sofort Parole, Feldruf, plastische Forderung, und diese Forderungen peitscht er so grimmig wie die biblischen Füchse mit ihren Feuerbränden in die Welt, dass sie das Gewissen der ganzen Menschheit entzünden.“ Stefan Zweig, „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“
mehr
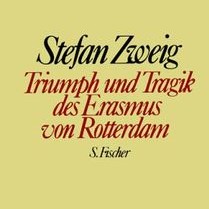
„Niemals würde ich mir um der Wahrheit willen den Kopf abschlagen lassen.“ Erasmus von Rotterdam; zitiert nach Sandra Langereis
mehr

Zum Schluss will er nur noch eine Weltreise machen; ein typisches Seniorending bis heute. Im Juni 1502 erreicht Kolumbus Martinique. Beim letzten Durchgang hatte er „Westindien“ (auf Geheiß des Gouverneurs Francisco de Bobadilla) in Ketten gelegt verlassen.
mehr

Wir alle tragen in uns Informationen, die eines Tages mit anderen Rekordhalterinnen der geologischen Zeit in den Weltraum fliegen werden. Was die Filter der menschlichen Zeit passiert, ist erfolgreich, auch da, wo man den Sinn der Übung nicht begreift.
mehr
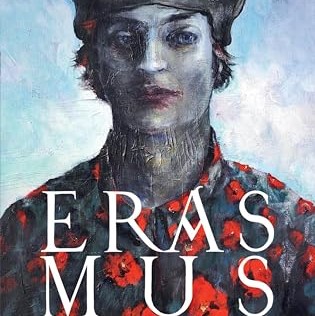
„Denn Humor und Übertreibung bildeten zusammen eine mächtige Waffe, die den eigentlichen Ernst der Sache bagatellisierte.“ Sandra Langereis
mehr
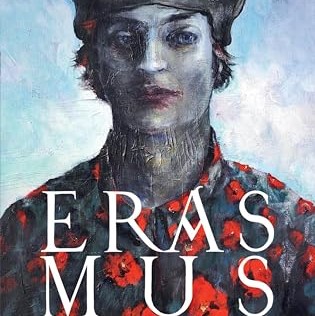
„Die Erfolge der großen Eroberer und Könige sind nichts gegen die Wirkung, die ein einziger großer Gedanke ausübt.“ Egon Friedell
mehr
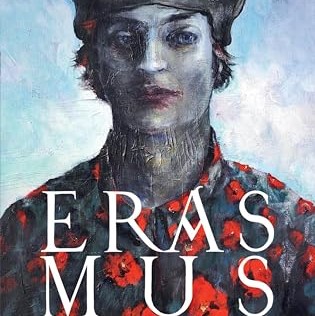
Noch die gelehrtesten Theologen des Mittelalters beschränken sich auf das Studium der Bibel in lateinischer Sprache. Alle berufen sich auf die von Sophronius Eusebius Hieronymus aus dem Griechischen und Hebräischen nicht wort- sondern gedankengetreu übertragene, seit dem Jahr 400 unserer Zeitrechnung verfügbare Vulgata. Erst in der letzten Generation vor Erasmus taucht die Idee einer Notwenigkeit von Quellengenauigkeit auf.
mehr
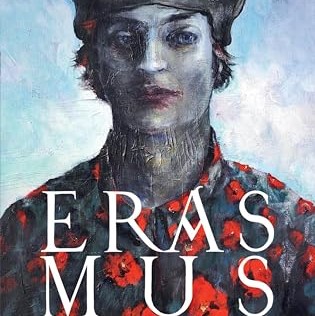
„Kühn und ängstlich, vordringend und doch unentschlossen vor dem letzten Stoß, kämpferisch im Geiste, friedliebend mit dem Herzen, eitel als Literat und tiefdemütig als Mensch, Skeptiker und Idealist, bindet er alle Gegensätze in lockerem Gemenge in sich zusammen.“ Stefan Zweig über Erasmus von Rotterdam
mehr
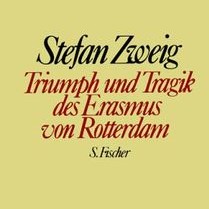
„Denn Verstehen und immer besser Verstehen war die eigentliche Lust dieses merkwürdigen Genius.“ Stefan Zweig über Erasmus von Rotterdam
mehr

Die Reisenden geraten in ein verschneites Gebiet, wo es keine Durchgänge gibt, so sie nicht von Wasserkraft in den Felsen gesprengt wurden. In einer Seilschaft übersteigen Kammschneider und Alfonso Eisfelder. Die Bergsteiger gelangen zum Papallacta-Pass, wo sie in einer Köhlerklause willkommen sind.
mehr

Karl V. hatte seinen Oberschenk Mendoza zum Statthalter der Gegend am Río de la Plata bestimmt, doch bedurfte es weit größerer Gemeinheit, als sie ein schlichter Brutalist wie Mendoza aufbringen konnte, um Paraguay für die ursprüngliche Bevölkerung in eine Strafkolonie zu verwandeln.
mehr

Pedro de Mendozas weiches Fleisch faulte im Fieber. Der Flottenführer erschlug einen Jungen mit dem beinernen Schuhlöffel. Eine kritische Bemerkung kostete einen Bootsmann den Schmerz und die Schmach von fünfzig Hieben. Mendoza ließ Delinquenten zur Abschreckung an Pranger stellen und in den Vorrichtungen auf Deck verrotten. Einen zu geringen Grad der Unterwürfigkeit deutete er als Insubordination. Meutereien beugte man am besten mit durchdachten Erniedrigungen der Mannschaft vor.
mehr
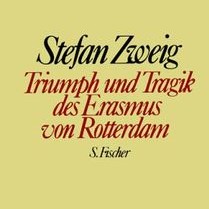
„Die Eltern sterben früh, und begreiflicherweise zeigen die Verwandten größte Eile, den … (Illegitimen) möglichst kostenlos von sich wegzuhalten; glücklicherweise ist die Kirche immer geneigt, einen begabten Knaben an sich zu ziehen. Mit neun Jahren wird der kleine Desiderius (in Wahrheit: ein Unerwünschter) in die Kapitelschule von Deventer geschickt.“ Stefan Zweig, „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“
mehr

Zu jener Zeit wollten alle dahin, wo der Pfeffer wächst - hin zu den Gewürzinseln. Weiterhin richteten sich königliche Erwartungen auf den „Seeweg nach Indien“. Kapitäne erkundeten die südamerikanische Ostküstenlinie. Die monumentale Mündung hieß noch Solís-Fluss, als Sebastian Cabot sie zum Ankerplatz bestimmte.
mehr
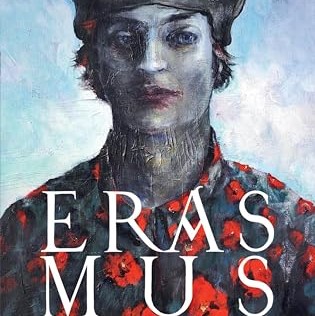
Langereis beginnt ihre Biografie mit der Schilderung einer Expedition, die 1598 im Hafen von Goeree-Overflakkee ihren Anfang nimmt. Die Autorin beschwört den „protestantische(n) Unternehmergeist (und) evangelische(n) Optimismus“ der Rotterdamer Kaufleute Pieter van der Hagen (einem Sklavenhändler) und Johan van der Veeken. Sie vertrauen ihre Investitionen Admiral Jacques Mahu (1564 - 1598) an.
mehr

Vor Anbruch des Tages ließ Kommandant Krömer Boote ausrüsten und besetzen. Er unterstellte die Abordnung dem Kasseler Hauptmann Friedrich von Zierenberg, während die Leute am Strand nicht müde wurden, „Englishmen, come on shore“ zu rufen. Bald stellte sich heraus, dass sie mehr „in einer zivilisierten Sprache nicht zu sagen wussten“.
mehr

Erst verliert Cornelius Kammschneider sein Pferd und dann seinen Stiefelknecht Alfonso Gramci in einem entlegenen Winkel des Oriente von Ecuador. Das ist eine trostlose Gegend. Glücklose Goldgräber vegetieren in aufgegebenen Stollen. Manche sind wilder als „die Wilden“. Vereinzelt erinnern Avocado- und Zimtbäume an Plantagen, die im Goldfieber aufgegeben wurden. Ein Fluss rauscht wie ein Siegeszug durch die versehrte Landschaft.
mehr

Halb tot, doch gut gelaunt erreicht der Kasseler Reiseschriftsteller und Hobbyornithologe Cornelius Kammschneider eine Missionsstation im Oriente von Ecuador. Die jesuitischen Missionare trotzen ihrer von Misstrauen gekrönten Abneigung die notdürftigste Gastfreundschaft ab. Der deutsche Protestant erscheint ihnen verdächtiger als alle „Heiden“, einschließlich der getauften.
mehr
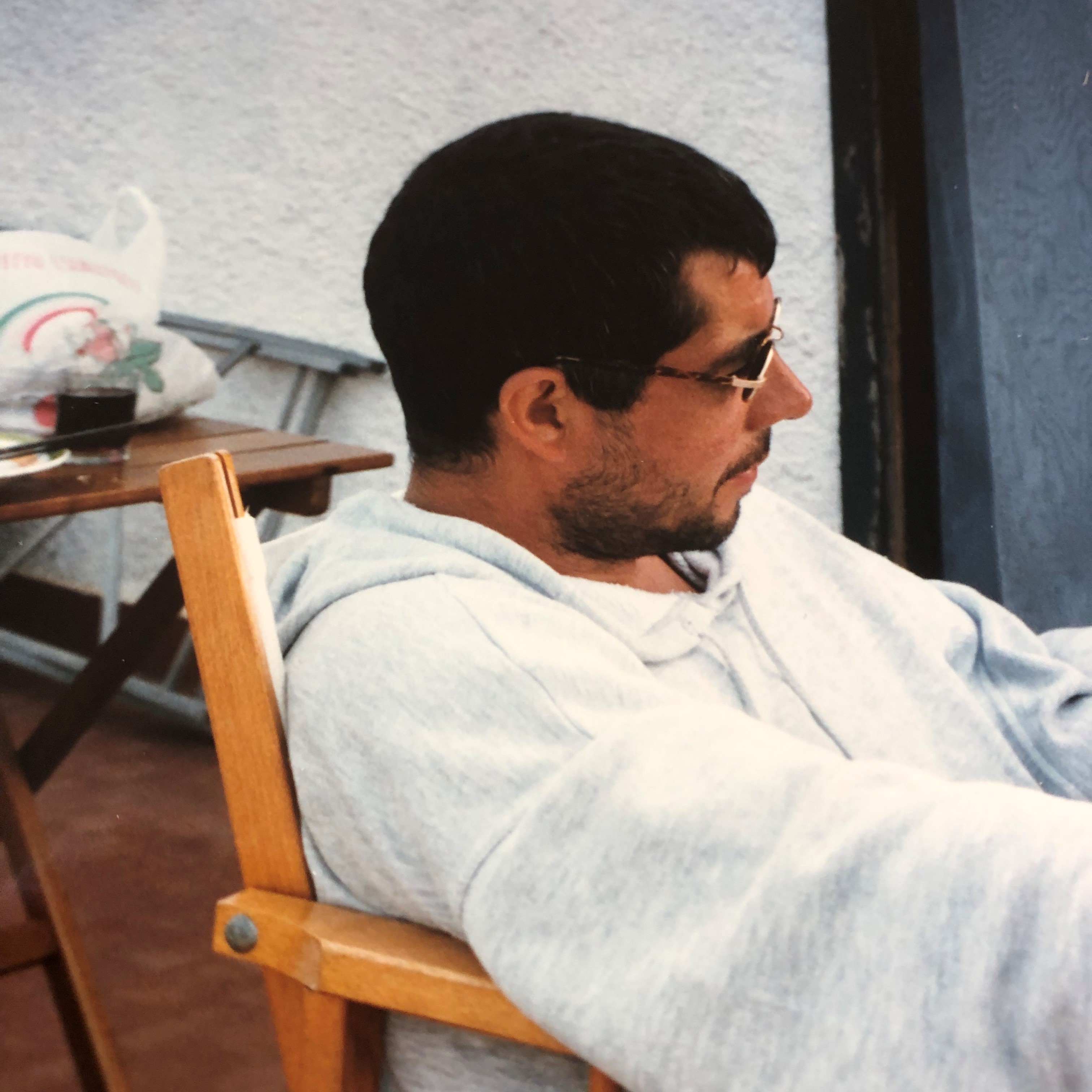
Cornelius Kammschneider erwartet einen Ausbruch des Cotopaxi. Der Krater trägt einen weißen Kragen. Feuer und Schnee treffen auf unwahrscheinliche Weise zusammen. Den Eindruck verstärkt Psilocybin, der Kasseler Dichter und Botaniker hat sich Magic Mushrooms besorgt, gerade fühlt er sich wie auf einer Zeitreise zum Anfang der Schöpfung.
mehr

Vargas steigt auch in der Kirchenhierarchie auf. Endlich dient er dem Bischof von Lima als Consigliere. Das ist ein Superjob mit hohem Stressfaktor. Die Kirche kämpft gegen Kolonisten, die Nicht-Weiße auf eine Stufe mit ihren Maultieren stellen. Vargas beaufsichtigt die Beachtung von Bestimmungen zum Schutz „der I…freiheit und der religiösen Rechte von N…sklaven“. Er legt sich zu Verpesteten ins Bett und erzählt ihnen von der Heiligen Rosa ...
mehr

Der Mörder so vieler stirbt selbst einen gewaltsamen Tod. Im Sommer 1541 unterliegt Francisco Pizarro González seinen Feinden endgültig. An seiner Seite fällt Francisco Martín de Alcántara, ein Halbbruder des Vizekönigs von Neukastilien. Diego de Almagro aka Diego el Mozo, Sohn eines von Pizarro aus dem Verkehr gezogenen Rivalen ...
mehr

Als der normannische Ritter Verlaine, genannt Longue Èpée - Langschwert, in Peru 1538 die Sache des Verlierers Diego de Almagro vertritt, kennt außer ihm kein Europäer die Gepflogenheiten der Bushi (Samurai). Die Wikinger erreichten amerikanische Gestade lange vor Kolumbus; Verlaine strandete bloß ein Vierteljahrhundert vor den ersten altweltlichen „Entdeckern“ auf der japanischen Insel Tanegashima nahe Kagoshima.
mehr

Die Ermordung Atahualpas löst das Inkareich auf. Francisco Pizarro González setzt ein Kind auf den Thron, das bald zu Schaden kommt und für die Farce nicht mehr zur Verfügung steht. Der „Eroberer“ und seine Schergen ziehen eine Blutspur durch Peru. Sie foltern jeden Kaziken, um ganz sicher zu gehen, dass er kein Gold zurückhält.
mehr
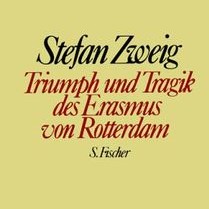
„Der organische Grundfehler des Humanismus war, dass er von oben herab das Volk belehren wollte, statt zu versuchen, es zu verstehen und von ihm zu lernen. Diese akademischen Idealisten glaubten schon zu herrschen, weil ihr Reich weithin reichte, weil sie in allen Ländern, Höfen, Universitäten, Klöstern und Kirchen ihre Diener, Gesandten und Legaten hatten … aber im tiefsten umfasste dies Reich doch nur eine dünne Oberschicht und war schwach verwurzelt mit der Wirklichkeit.“ Stefan Zweig
mehr

Schon spekulieren dynastische Kaufmannsfamilien auf amerikanische Gewinne. Sie rüsten militärisch gestraffte Expeditionen aus. Das Kommando übertragen sie allein ihnen rechenschaftspflichtigen Feldhauptmännern. In ihrer Regie spielen staatenbildende Maßnahmen keine Rolle. Die Interessen der Entrepreneure kollidieren mit den Interessen der Konquistadoren, die offiziell für Gott und Vaterland antreten.
mehr

Die „Eroberer“ müssen ihre Ausflüge selbst finanzieren. Pizarro und seine Brüder sind Verpflichtungen eingegangen, während ihre Haudegen und Laufburschen ohne Besitz und Belastungen an Land kamen. Sie brachten bloß ein Schwert und die Badehose mit.
mehr
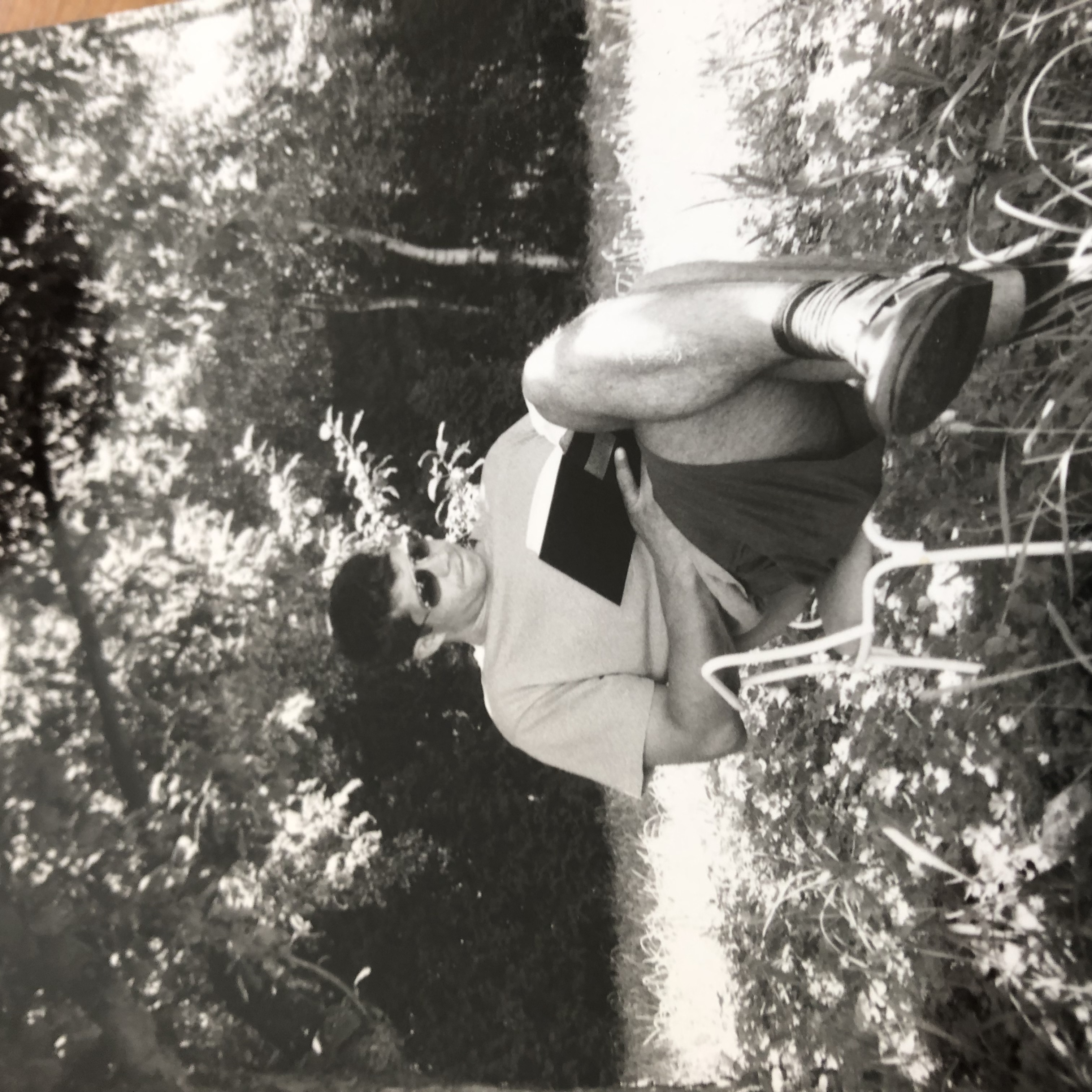
In seiner Erasmusiade „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“ exponiert Stefan Zweig den Gegensatz zwischen der zarten, wenn nicht dürftigen Konstitution des epochalen Gelehrten und den „wilden Kraftnaturen der Renaissance und der Reformation“.
mehr

Pizarro weiß, dass Atahualpas Gefangenschaft die gottkönigliche Autorität untergräbt, man kennt das Phänomen aus Mexiko. Der von Cortés gekidnappte Azteke Moctezuma war von seinen eigenen Leuten gesteinigt worden. Die hatten einem Unfreien schlicht und ergreifend nicht mehr abgenommen, dass er ein Gott ist.
mehr

Wenden wir uns kurz Francisco Pizarro zu, der im Herbst 1531 von einem Grat der peruanischen Westkordilleren auf einem erschöpften Pferd in ein Hochtal absteigt. Sein Ziel ist ein bewehrter Marktplatz. Kein Mann in seinem Gefolge hat mit so starken Befestigungen irgendwo im Nirgendwo (aus der europäischen Perspektive) gerechnet.
mehr
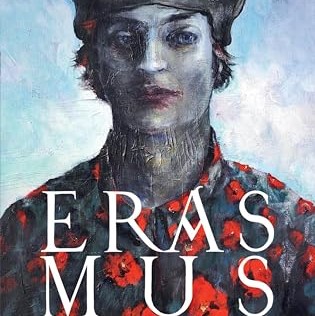
Erasmus kritisiert das „fromme Bibellesen“ im Rahmen blühender Volksfrömmigkeit. Er plädiert für ein Studium der Evangelien „auf der Grundlage humanistischer Kenntnisse“. „(Gut) informierte Gläubige (seien) bessere Christen.“ Seine Ansichten provozieren den Widerspruch jener, die Lektüre mit Gebet gleichsetzen.
mehr

1464 stiftete König Ferdinand von Neapel den Hermelinorden als ritterliche Auszeichnung in Nachahmung eines französischen Vorbildes. Siehe Ordre de l‘hermine. Mit dem Wappentier assoziierte die Renaissance Reinheit, Fruchtbarkeit und Kampfgeist. Die Devise „Malo mori quam foedari - Lieber sterben als (dem Sinn nach) verunstaltet leben“ folgte einer Nobilitierung des Wiesels zur Edelkreatur. So kursierte der von Ferdinand mit dem Hermelinorden geehrte Mailänder Herzog Ludovico Sforza (1452 -1508) als „weißes Hermelin“.
mehr
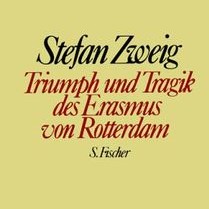
„Im Lateinischen war (Erasmus) … ein zweites Mal geboren worden. Das war die einzige wahre Sprache für Menschen, die sich für ein Schriftstellerleben entschieden.“ Sandra Langereis
mehr
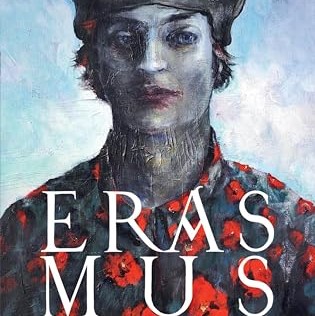
Das bibelfeste Latein und die gotische Handschrift sind Insignien eines besonderen Gottesdienstes. Jahrhundertelang entstehen in den Skriptorien der Klöster Abschriften bedeutender Werke der Christenheit in einer bis auf den letzten Punkt kodifizierten Praxis. Die Kopisten verrichten Frondienste des Geistes.
mehr
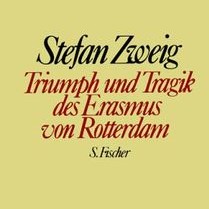
Der Autor verknüpft das europäische Zerwürfnis der Kirchenspaltung mit dem Aufbruch nach Amerika. Für den Autor beweist der Kolonialismus die altweltliche Zukunftsfähigkeit um 1600.
mehr
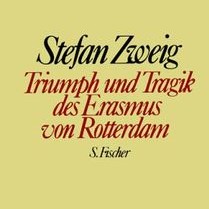
„Das Bewusstsein, dass unsere Worte die ganze Welt auf einmal erreichen können, ist ein Impuls, der unbewusst die Art und Weise beeinflusst, wie wir uns ausdrücken, und ein Reichtum, den nur die größten Giganten des Geistes ungestraft ertragen können.“ Johan Huizinga
mehr
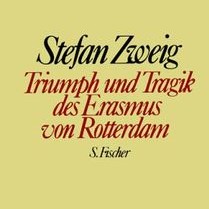
„Die Geschichte aber ist ungerecht gegen die Besiegten. Sie liebt nicht sehr die Menschen des Maßes, die Vermittelnden und Versöhnenden, die Menschen der Menschlichkeit. Die Leidenschaftlichen sind ihre Lieblinge, die Maßlosen, die wilden Abenteurer des Geistes und der Tat.“ Stefan Zweig über Erasmus von Rotterdam
mehr
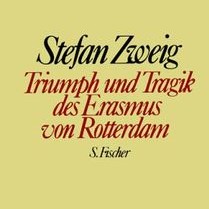
„Wenn Sie, meine Herren, (...) das unzählbare Gewirre der Sterblichen vom Monde herab sehen könnten, so würd es Sie dünken, Sie sehen Heere von Mücken oder Schnaken, die sich untereinander erzanken, bekriegen, belauern, berauben, spielen, Mutwillen treiben, geboren werden, fallen, sterben.“ Erasmus von Rotterdam
mehr
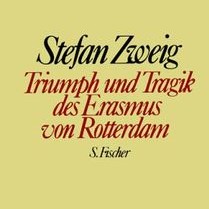
“Knowing is not enough.” Bruce Lee
mehr
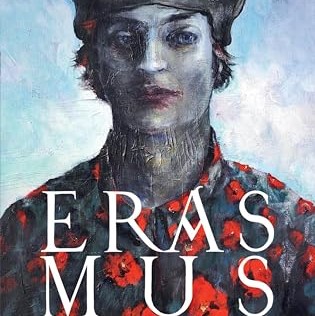
Ist es statthaft, Stefan Zweigs Anverwandlung „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“ einzuordnen als kongeniale Vorzeichnung der atmenden Biografie von Sandra Langereis? Zweig schildert seinen Helden als „übernationales“ Genie. Er assoziiert mit dem Weltmann die Heimatlosigkeit einer - nach den Margen der Erasmus-Epoche - unordentlichen Herkunft.
mehr
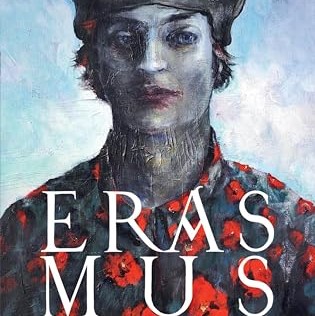
Erasmus Desiderius (ca. 1466 in Rotterdam - 1536 in Basel) wächst in Gouda auf. Als unehelicher Sohn eines Priesters und dessen Haushälterin entbehrt er die zunfttaugliche Ehrbarkeit in einem burgundischen Winkel des Heiligen Römischen Reichs. Die sozialen Aussichten des zukünftigen Fürstenerziehers sind erst einmal lausig.
mehr
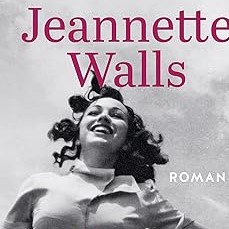
In Sallie pulsiert eine wilde Lebensfreude. Sie tobt als menschlicher Wirbelwind durch die Gegend. Die Vorzüge einer ländlich-ungebundenen, vom Wohlstand überkronten Kindheit genießt sie in vollen Zügen, bis zu dem Tag, als sie mit ihrem Halbbruder Eddie eine Spritztour im Bollerwagen unternimmt und in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt wird.
mehr

Ich werde nie vergessen, wie Tante Erika Omas Bedenken vom Tisch fegte, aufgehellt vom mitgebrachten Likör, dem sie ausdauernd zusprach. Ich sehe Oma noch mit hochgezogener Oberlippe hasenherzig nippen. Erika kippte. Sie schloss den Vorgang ab, indem sie sich mit dem Handrücken tatkräftig über den Mund fuhr.
mehr
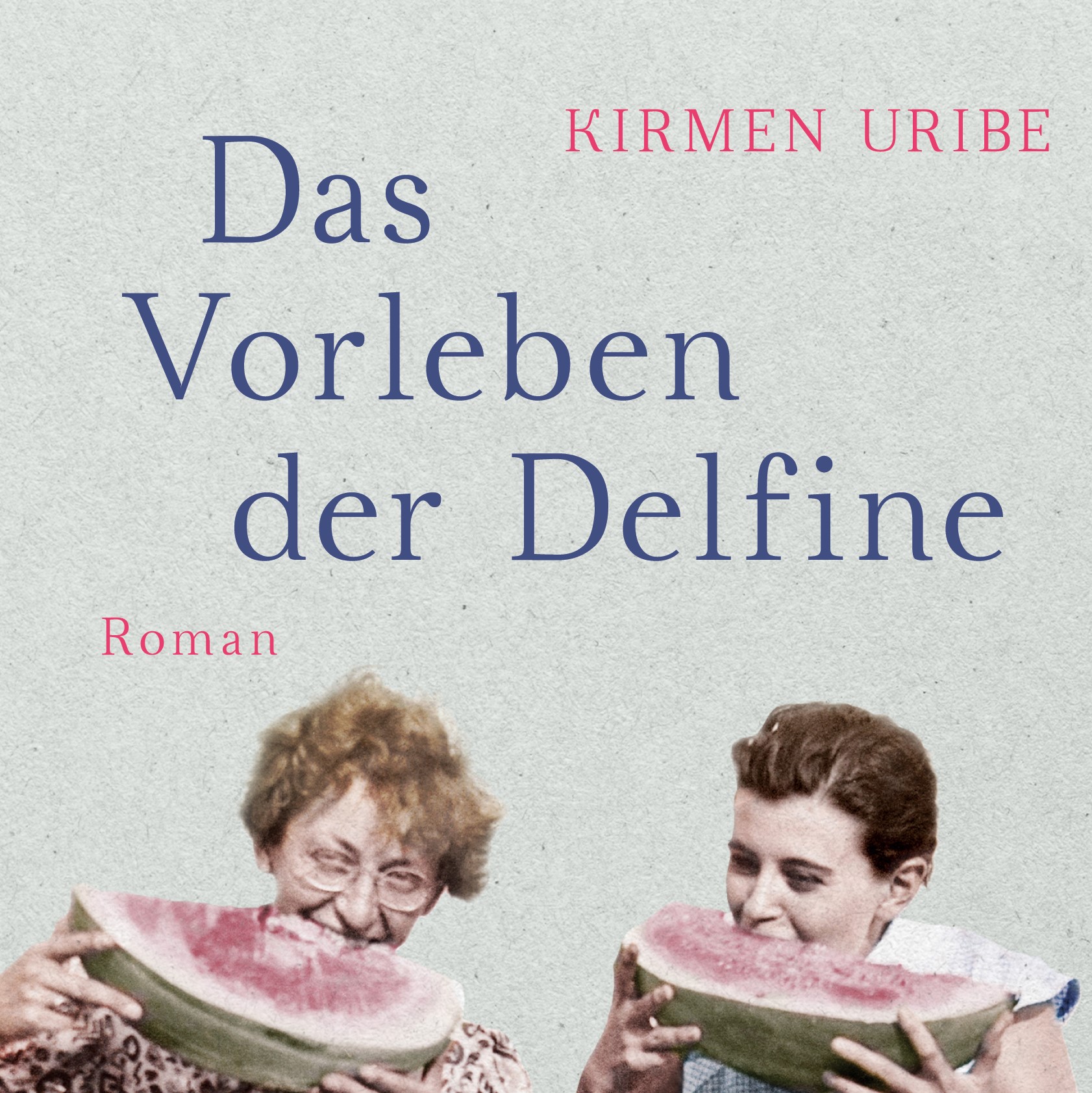
Mit der Absicht, einen Roman über Rosika Schwimmer zu schreiben, sichtete Kirmen Uribe Archivkisten im Rose Main Reading Room der New York Public Library - und zwar als Stipendiat dieser Einrichtung. Rief ihn jemand an, zog er sich mit seinem Smartphone in eine antike Holzzelle am Fuß einer Marmortreppe zurück. Ihrer Funktion beraubter, zu Attrappen degradierter Ex-Telefonkabinen boten hinter Schwingtüren nostalgische Rückzugsräume.
mehr
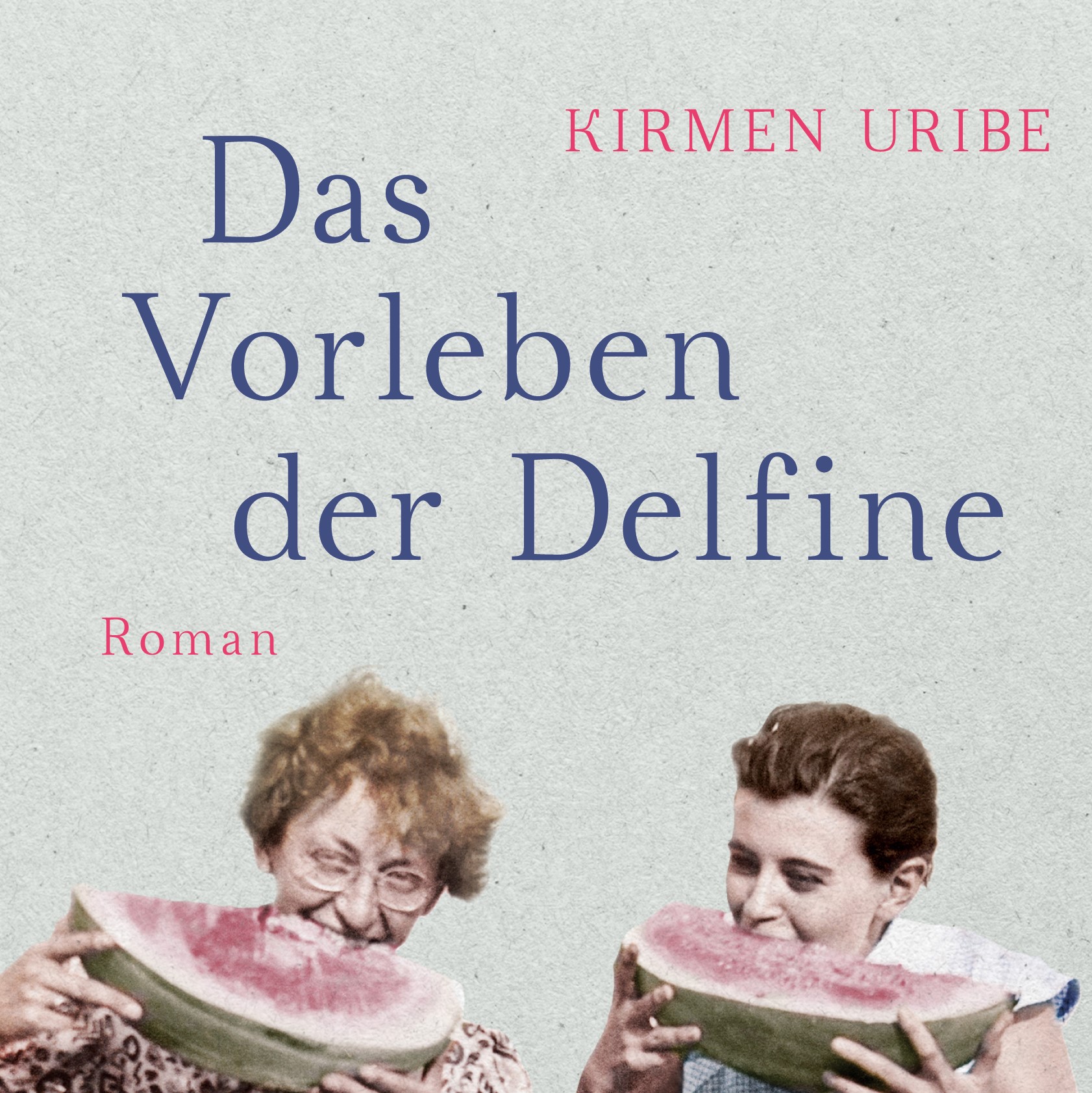
„Jede Vorstellung (einer Migrantin von der ursprünglichen Heimat) … verwandelt sich in eine Beschwörung … und schließlich in Fiktion.“ Auf diese Erfahrung bewegt sich Rosika Schwimmer im Januar 1920 als blinde Passagierin zu. Unter einer Plane versteckt, reist die zur Fahndung ausgeschriebene, weltberühmte Aktivistin in Eiseskälte mit einem Donaudampfer von Budapest nach Wien. Sie flieht vor ...
mehr
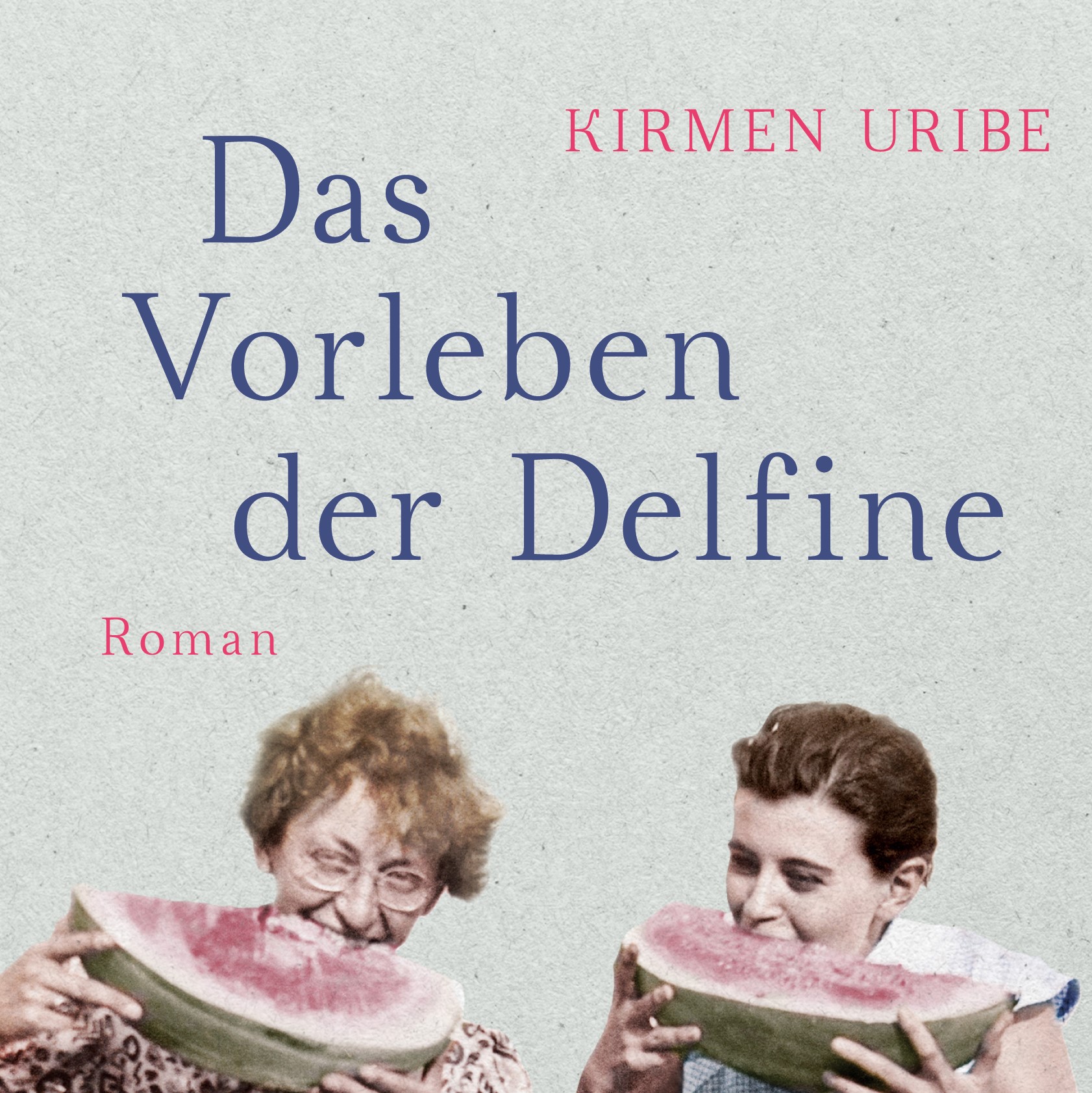
„Schließlich ihre perfekt gezeichneten Lippen, wie die Umrisse eines spitzen Zirkuszelts im Halbdunkel einer Morgendämmerung.“ So beschreibt der Erzähler den Anblick seiner schlafenden Frau.
mehr
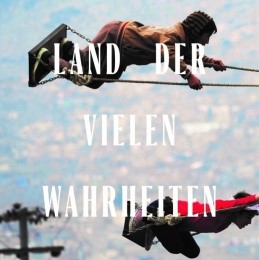
“The Arabs had marked their tents out in white so that they would stand out. He asked them why. ‘We want them to bomb as. We want to die.’” Alex Strick van Linschoten, Felix Kuehn, “Enemy We Created: The Myth of the Taliban-Al Qaeda Merger in Afghanistan”
mehr
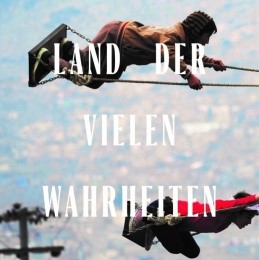
„Es gab nur zwei Regeln. Der Gewinner nimmt alles. Und nichts währt ewig.“
mehr
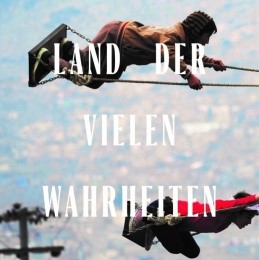
„Die Märtyrer waren in Baschirs Geschichten präsenter als die Lebenden. Sie kehrten in den Heldensagen wieder. Manchmal sprach Baschir über sie, als weilten sie noch unter ihnen.“
mehr
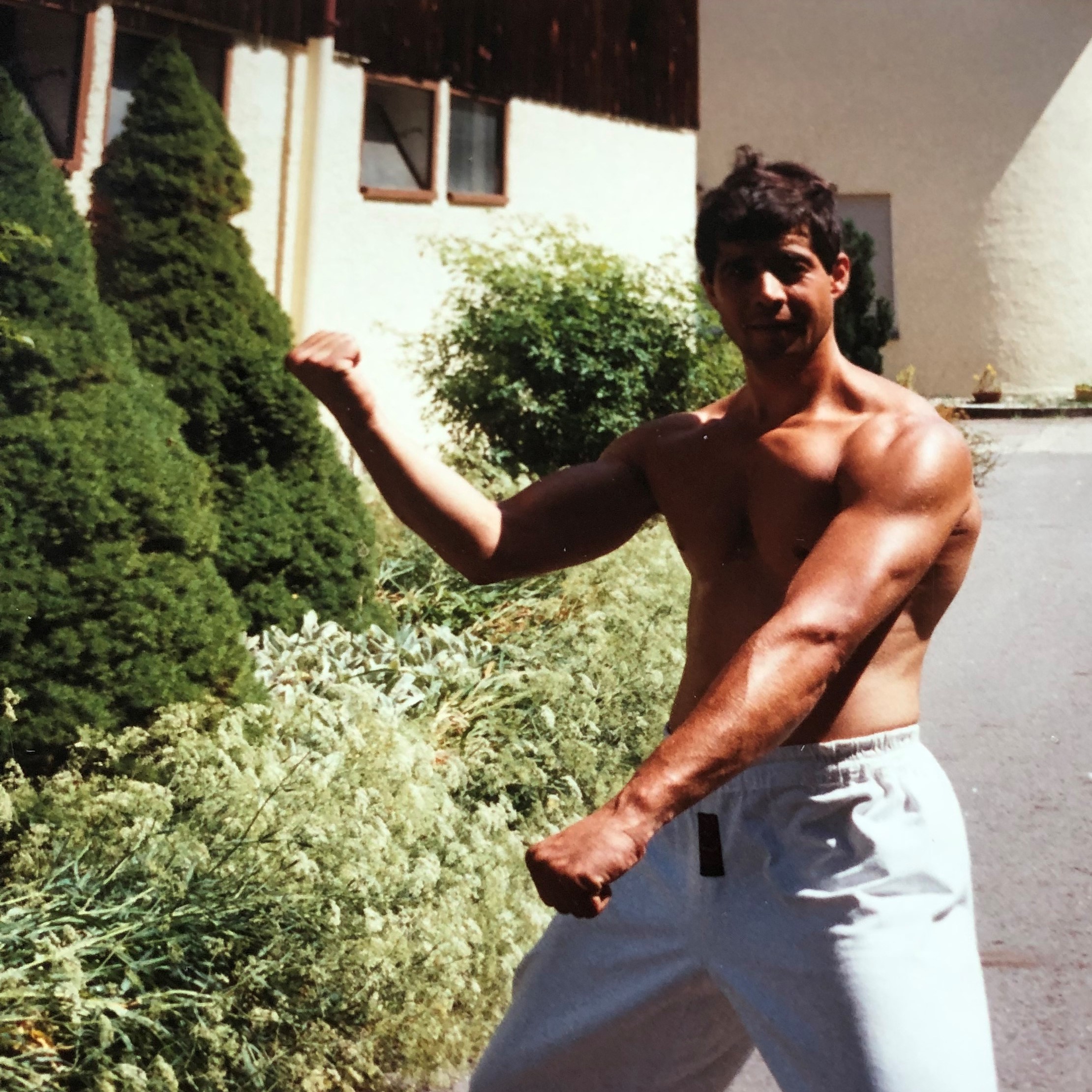
Until the 19th century you only had to insult someone in order to be able to legally kill him in a duel. This as an extreme example of contraction compulsion.
mehr

Intelligence is intent. As soon as the connection between your intention and your center of equilibrium is disrupted, you no longer act intelligently. You can't use your intelligence if the balance center is shaken. Jamal Tuschick
mehr
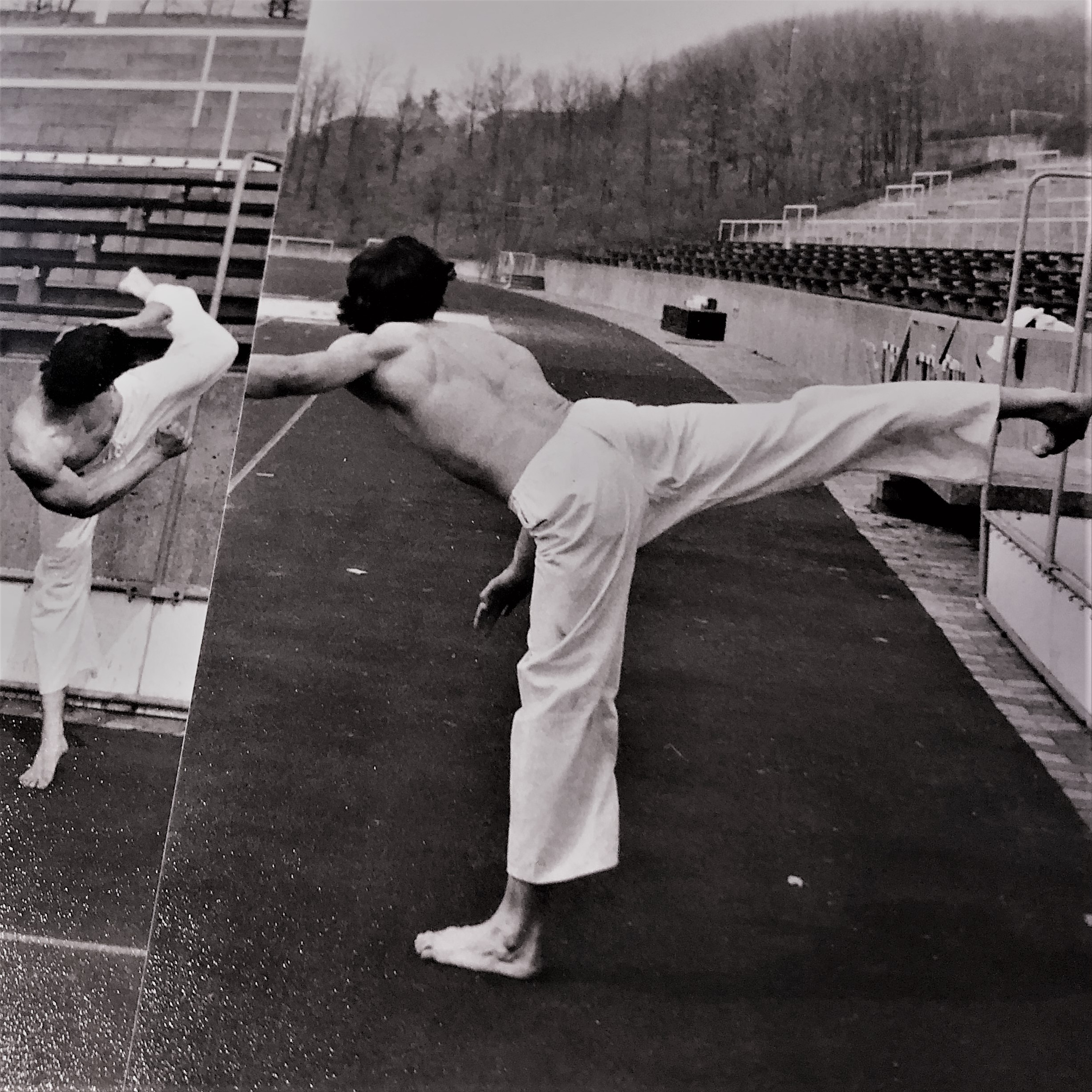
„Mystery creates wonder and wonder is the basis of man’s desire to understand”. Neil Armstrong
mehr
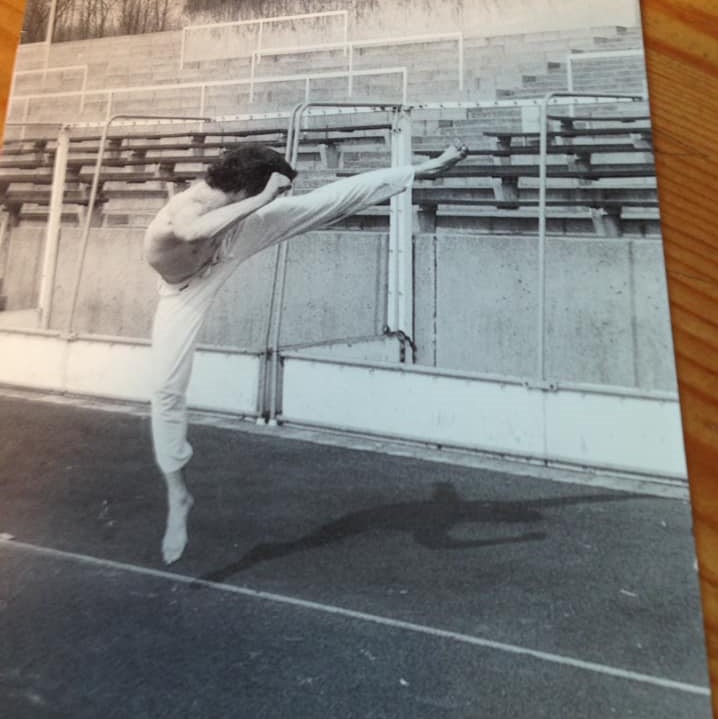
Das Paar zählte zum In-vitro-Jetset. Wartelisten umging es mit Geld. Der Vorgang vollzog sich in einer Sphäre, in der viel Geld erst einmal wenig bedeutet. Geld erfüllt nur die leichteste Zugangsvoraussetzung. Wichtiger sind Beziehungen.
mehr
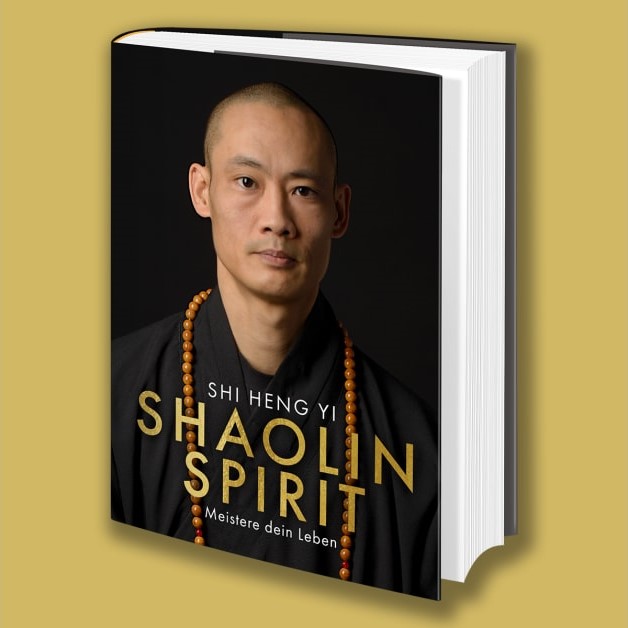
„Das Geschenk des Lebens besteht darin, sich als Gestalter und nicht als Opfer … zu begreifen.“ Shi Heng Yi
mehr
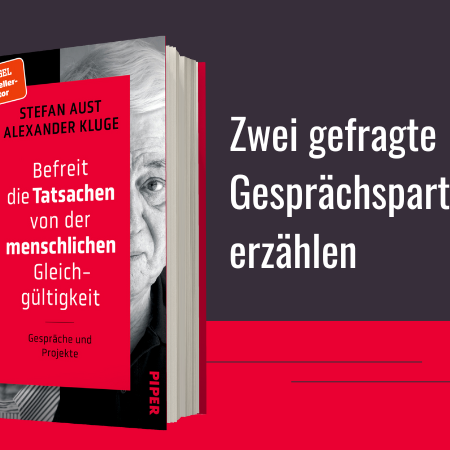
„Auf jede Überforderung hin suchen Menschen nach einer Erzählung.“ Alexander Kluge
mehr
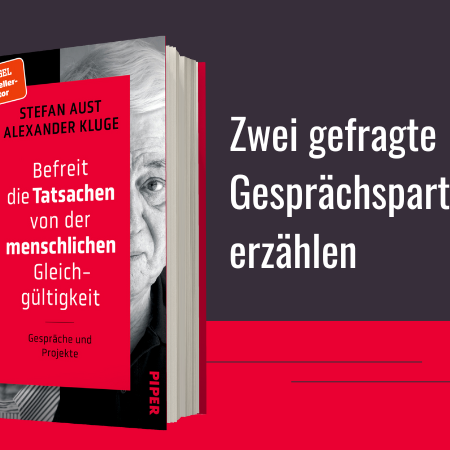
„Als die Russen aus Afghanistan abgezogen sind, weil sie den Krieg gegen die Taliban dort nicht gewinnen konnten, hat das den Untergang der Sowjetunion eingeleitet. Als die Amerikaner sich zurückgezogen haben aus Afghanistan, haben die Russen gedacht: Die sind auch nicht stärker als wir. Das hat sicher bei den Überlegungen von Putin, in die Ukraine einzufallen, eine Rolle gespielt.“ Stefan Aust
mehr
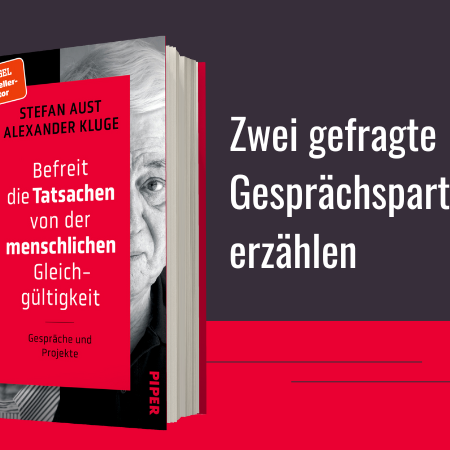
„Karin Mölling hat mir von einem Element in unserem Erbgut erzählt. Das ist ein über fünf Millionen Jahre altes Virus. Das ist übergelaufen zu den Vorfahren von uns, als wir noch nicht Menschen waren. Es sitzt in uns und verteidigt uns immer noch wütend und träumend gegen Gefahren von Bakterien und Viren von vor fünf Millionen Jahren. Die Gegner unserer Vorfahren, die hier abgewehrt werden, gibt es längst nicht mehr. Wenn wir mit diesem Urvirus und Überläufer, der wie ein Hugenotte nach Preußen in unser Erbgut überlief, sprechen könnten, hätten wir vermutlich Zugang zu einem Universalimpfstoff.“ Alexander Kluge
mehr
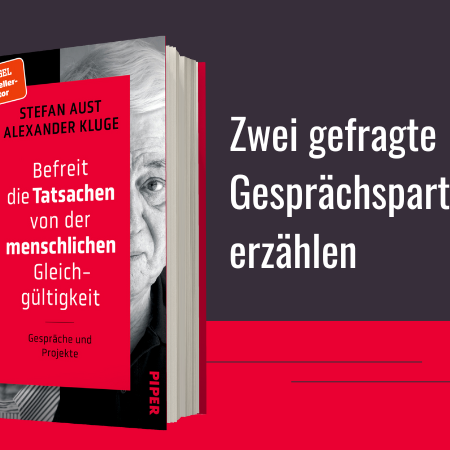
„Weil das geklappt hat, denkt man, es ist perfekt gewesen. In Wirklichkeit war das eine improvisierte Angelegenheit.“ Stefan Aust über die Ermordung der Begleiter von Hanns Martin Schleyer „in einem Blutrausch“.
mehr
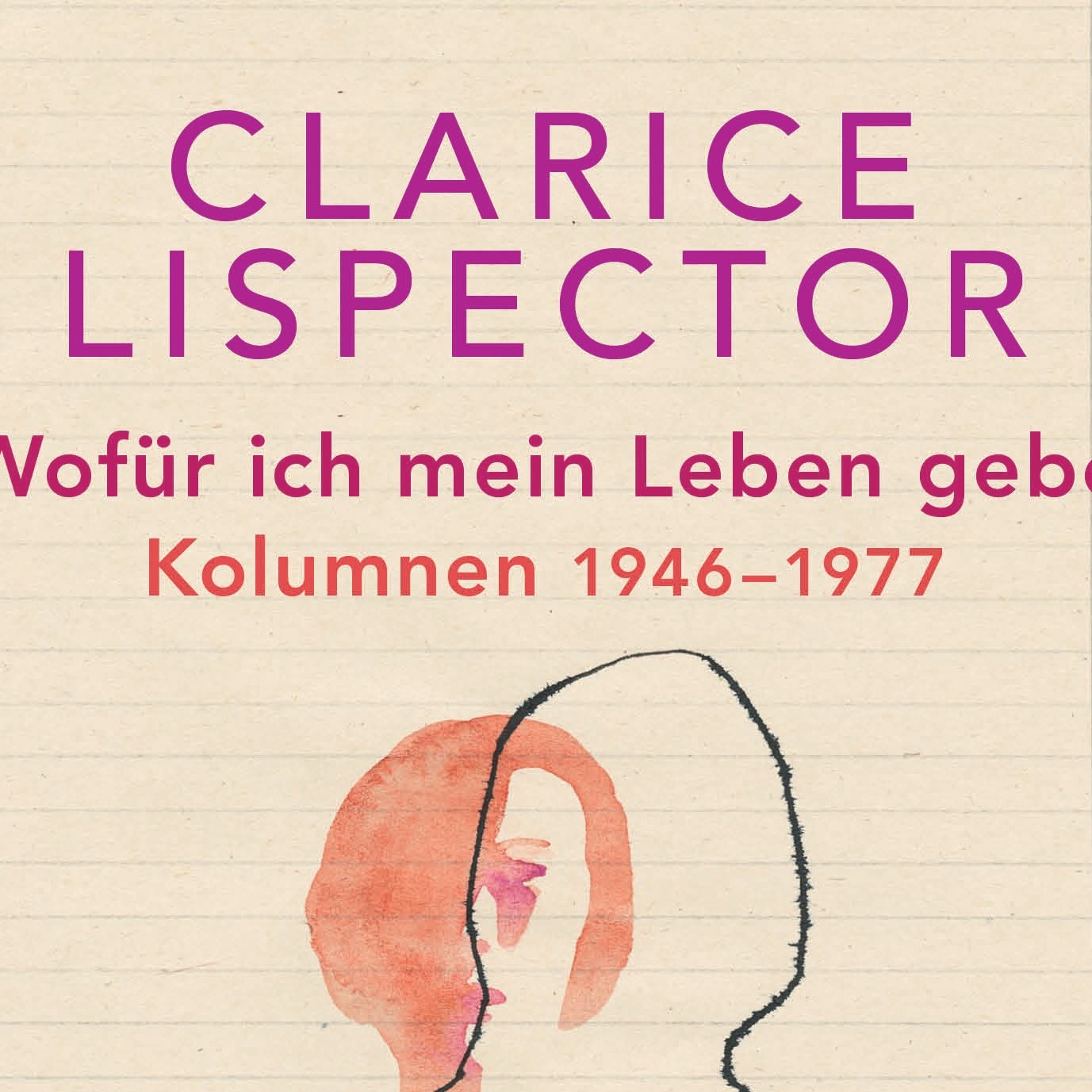
In Lispectors literarischen Kolumnen (mondän publiziert im Jornal do brasil) dominiert das Episodische, Flüchtige, Vergebliche. Die Miniaturen entsprechen einem portugiesischen und brasilianischen Genre: der Crônica. In „Unsterbliche Liebe“ bekennt die Autorin ein von Skrupeln belastetes Verhältnis zu den poetischen, wohl auch dem Erwerbsdruck geschuldeten Glossen.
mehr
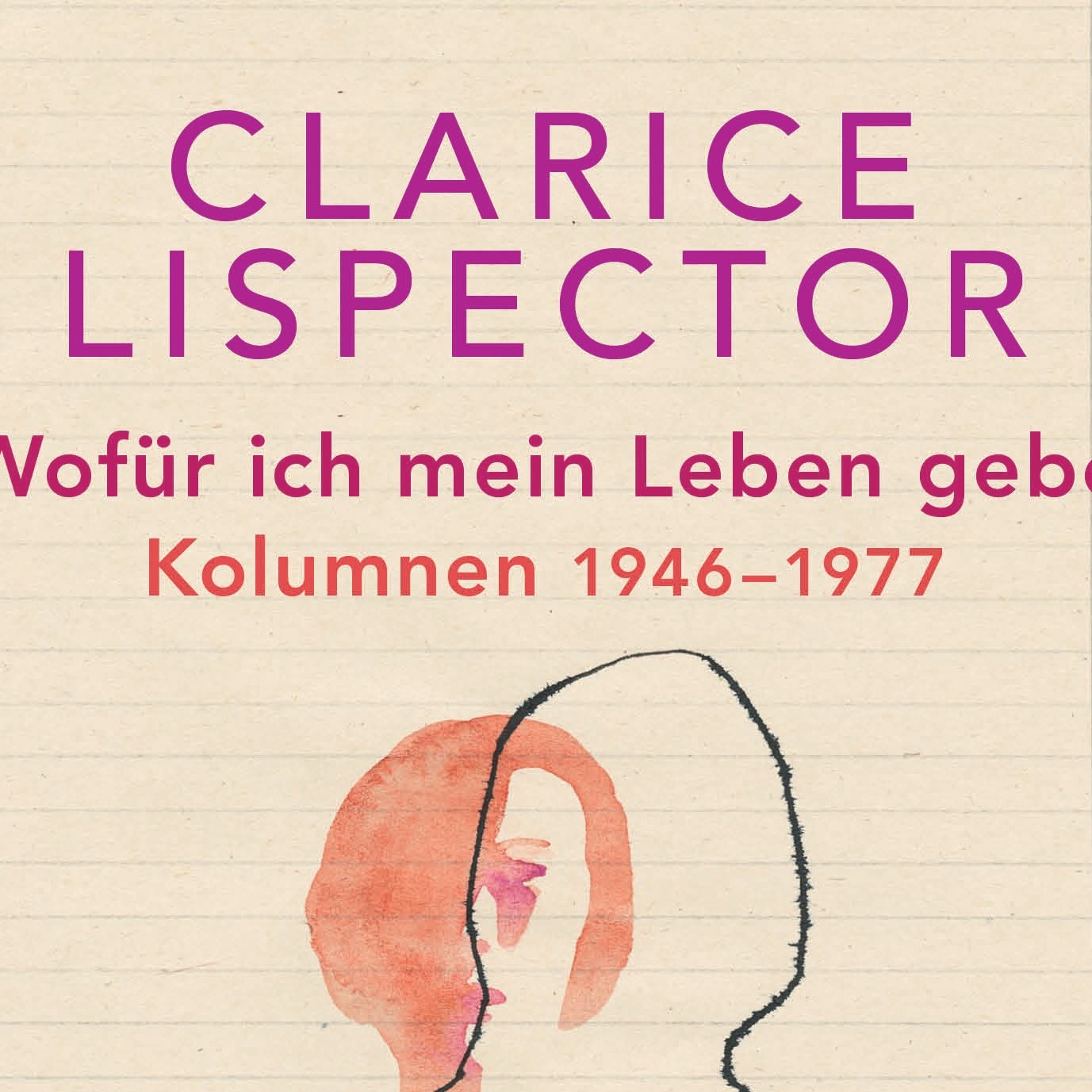
Sie „stirbt für den Duft von Wildrosen“. Sie träumt von einem Fisch, der „aus seinen Kleidern schlüpft“. Sie verliert sich in einem „scharlachroten Sonnenuntergang (und in) hellsichtiger Schlaflosigkeit“. Sie feiert ihren eigenwilligen Gebrauch von Satzzeichen. Sie schwelgt und schweift aus. Sie erspürt und ertastet. Beschwörend spricht sie von der Liebe. Bewohnt fühlt sie sich von einem ebenso wilden wie zärtlichen Rappen. Gleichzeitig bedenkt sie die strukturelle Vernichtung der indigenen Bevölkerung Brasiliens. Sie fragt: „Wohin mit dem betagten Kleinbürger?“ Was begreifen Säuglinge von der Welt in ihren Wiegen?
mehr
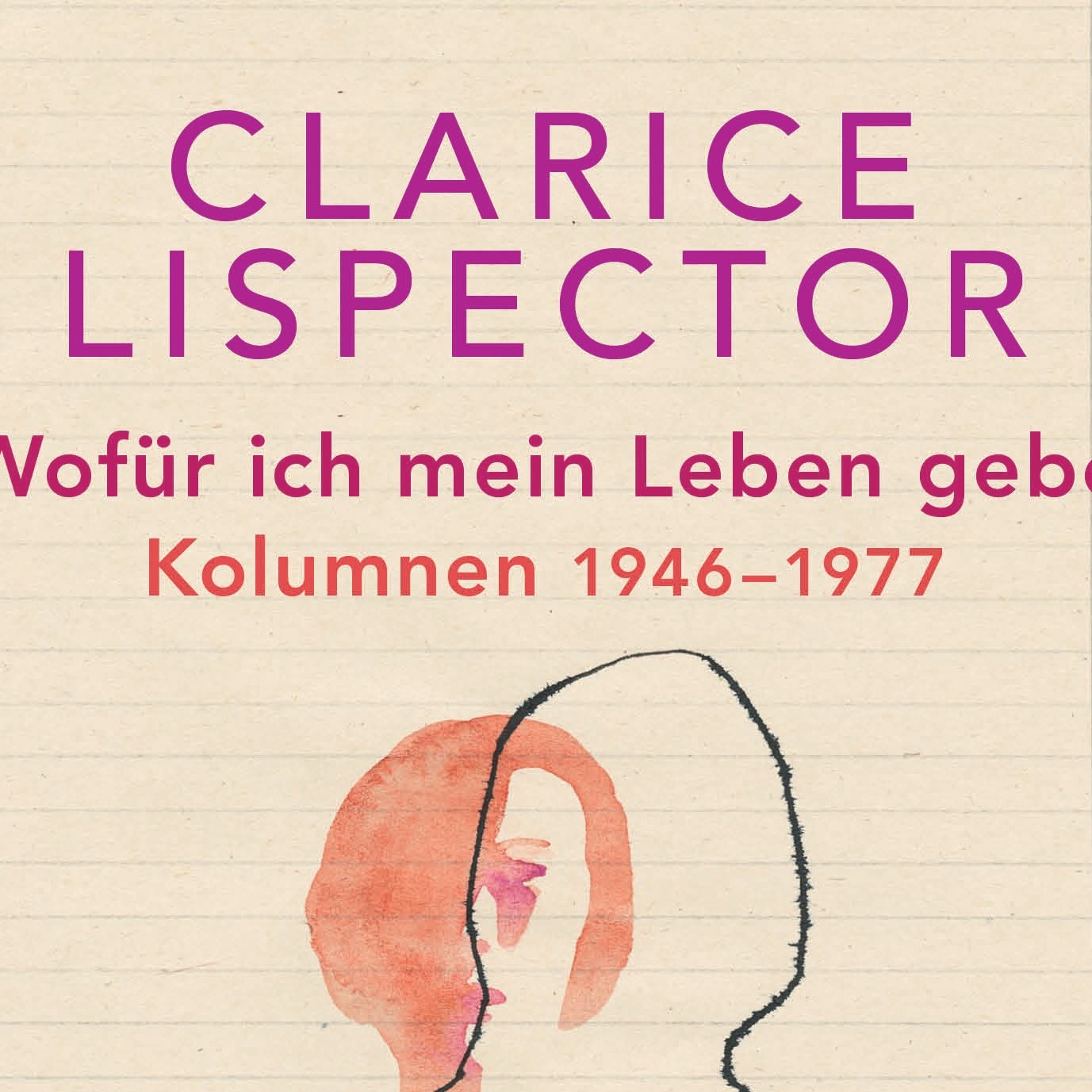
„Jetzt eine Bitte (an den Setzer): Sehen Sie davon ab, mich zu verbessern. Die Interpunktion ist der Atem des Satzes, und meine Sätze atmen so.“
mehr
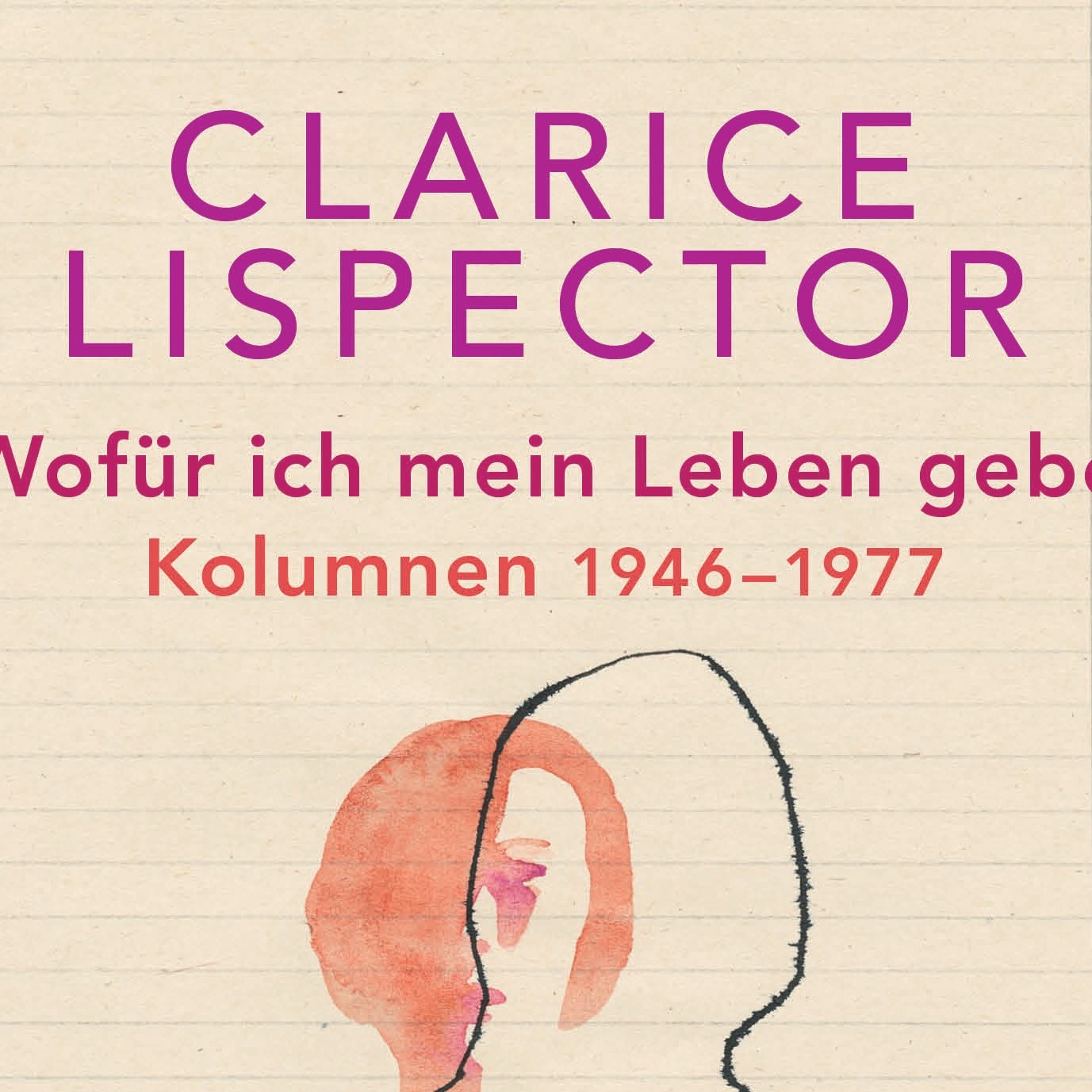
In Lispectors literarischen Kolumnen (mondän publiziert im Jornal do brasil) dominiert das Episodische, Flüchtige, Vergebliche. Die Miniaturen entsprechen einem portugiesischen und brasilianischen Genre: der Crônica. In „Unsterbliche Liebe“ bekennt die Autorin ein von Skrupeln belastetes Verhältnis zu den poetischen, wohl auch dem Erwerbsdruck geschuldeten Glossen.
mehr
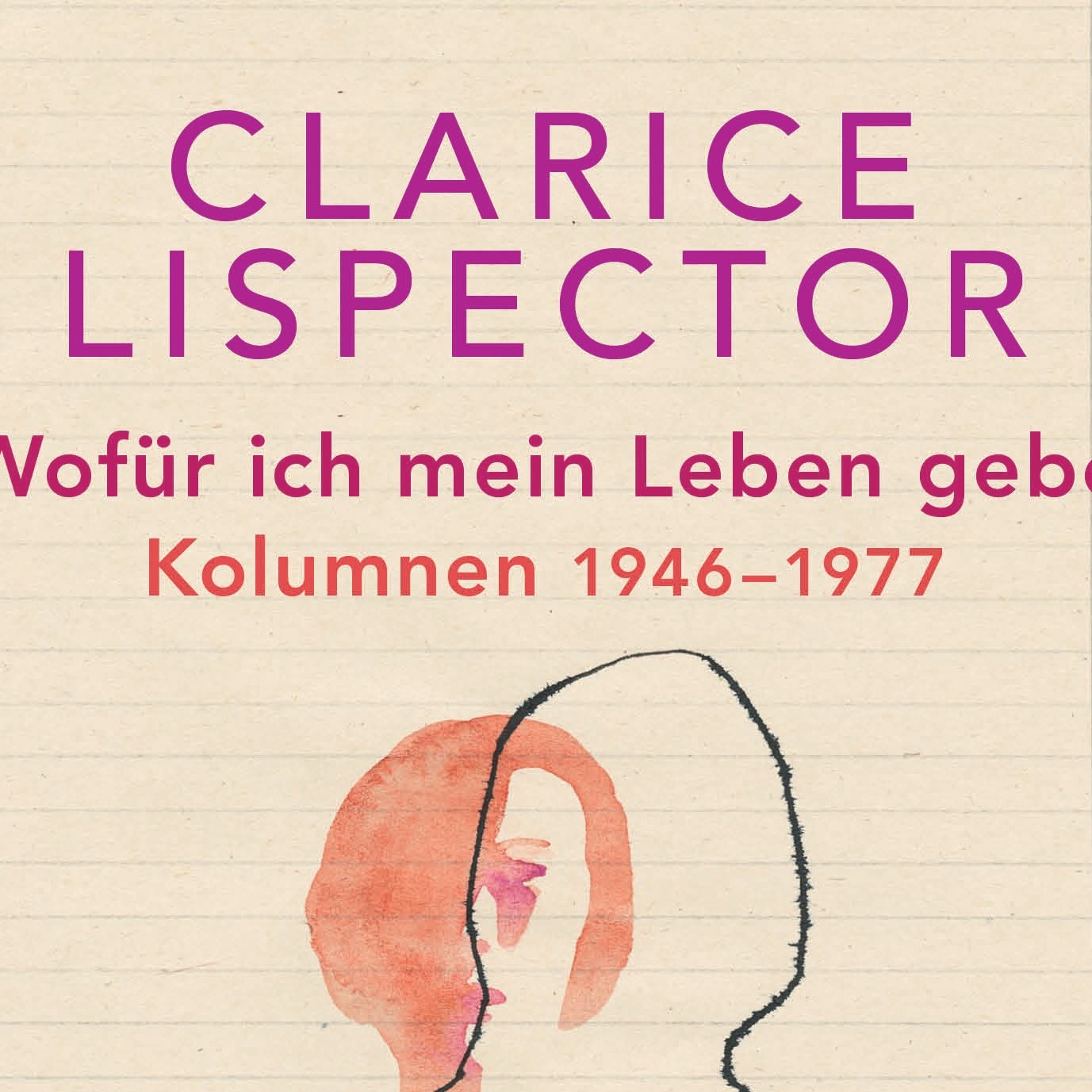
„Wir haben Kathedralen errichtet und sind dann draußen geblieben, weil wir fürchteten, die von uns selbst errichteten Kathedralen könnten sich als Fallen erweisen.“
mehr
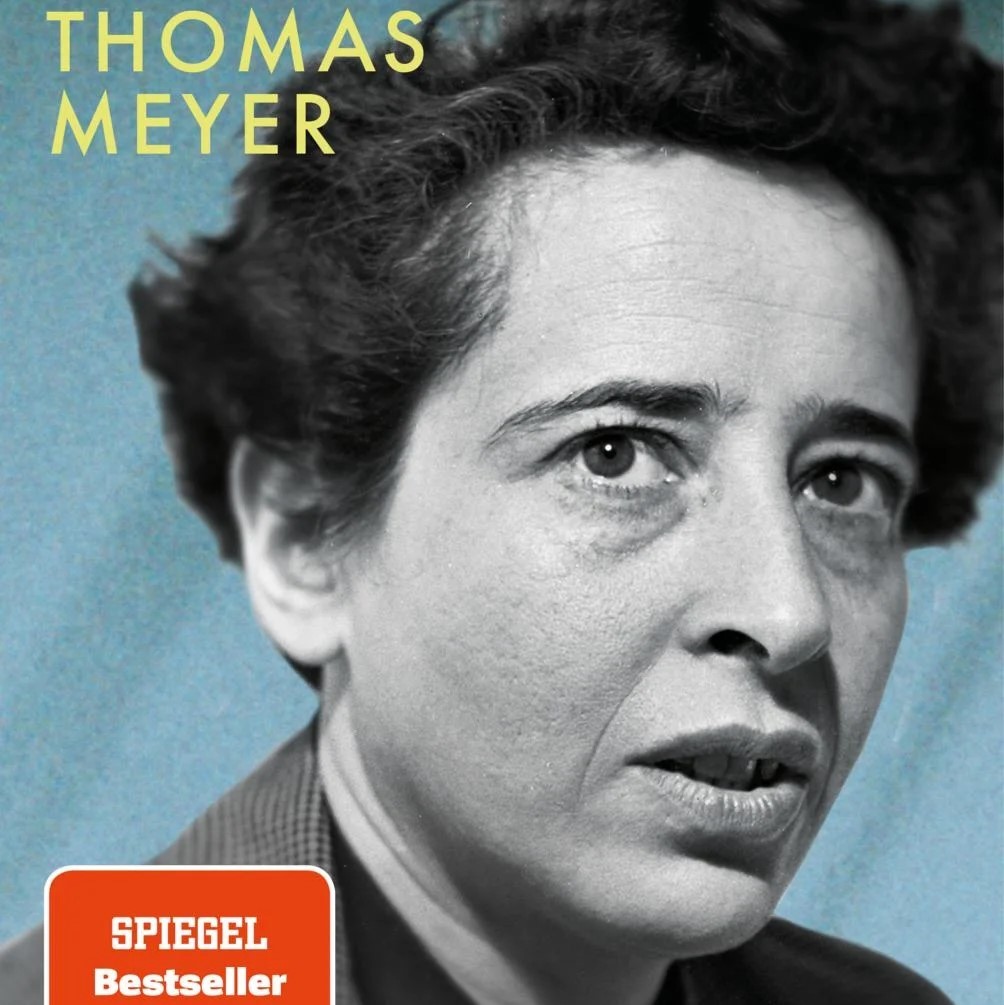
„Wo Tatsachen konsequent durch Lügen und Totalfiktionen ersetzt werden, stellt sich heraus, dass es einen Ersatz für die Wahrheit nicht gibt. Denn das Resultat ist keineswegs, dass die Lüge nun als wahr akzeptiert und die Wahrheit als Lüge diffamiert wird, sondern dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird.“ Hannah Arendt
mehr
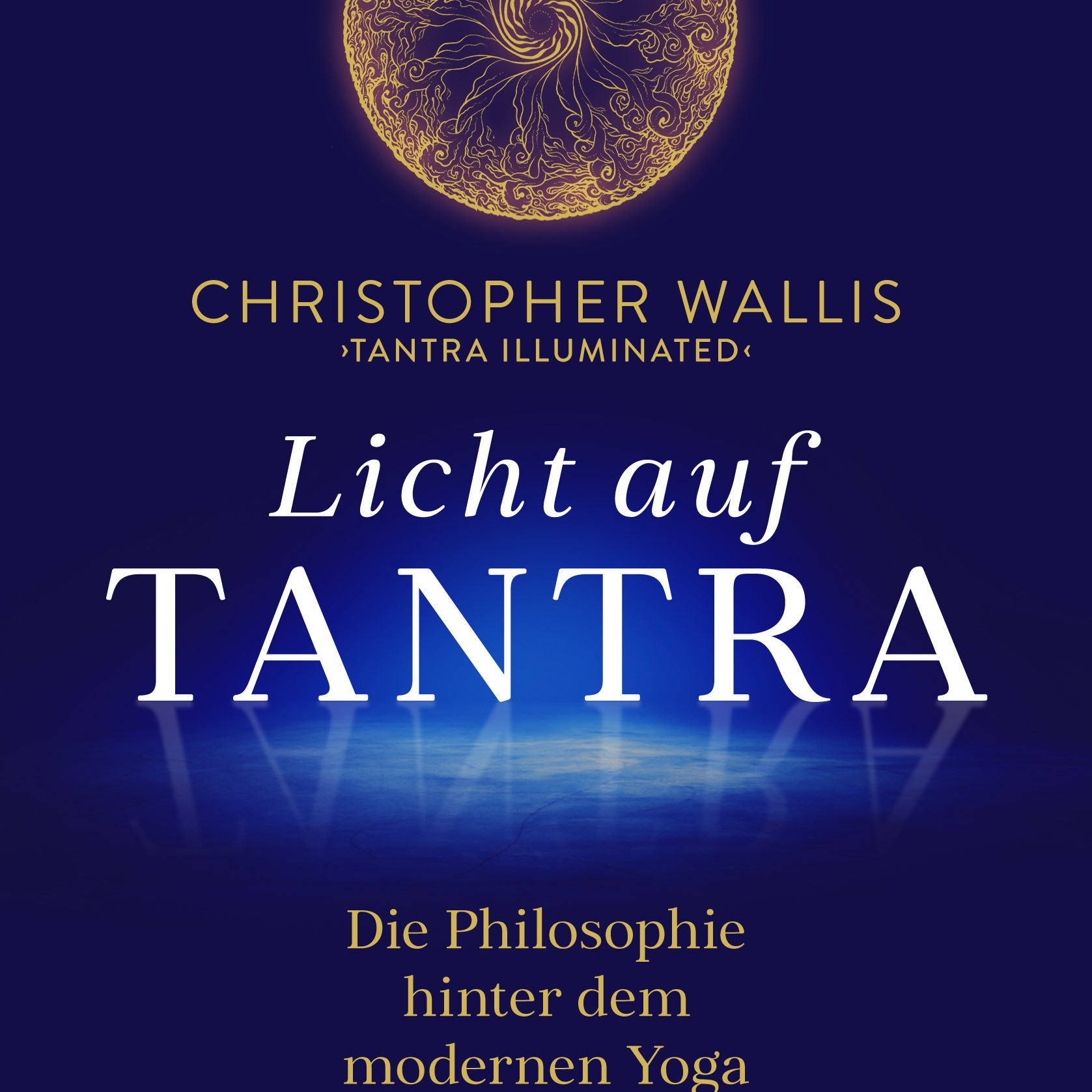
Dem Autor gelingt es, spirituelle Erfahrungen anschaulich zu schildern. Er beschreibt eine Erleuchtungspraxis vom Erwachen bis zur Befreiung. Ich folge ihm bereitwillig, mit der Vorstellung, Zeuge einer Offenbarung zu sein, die meinen Horizont sprengt.
mehr
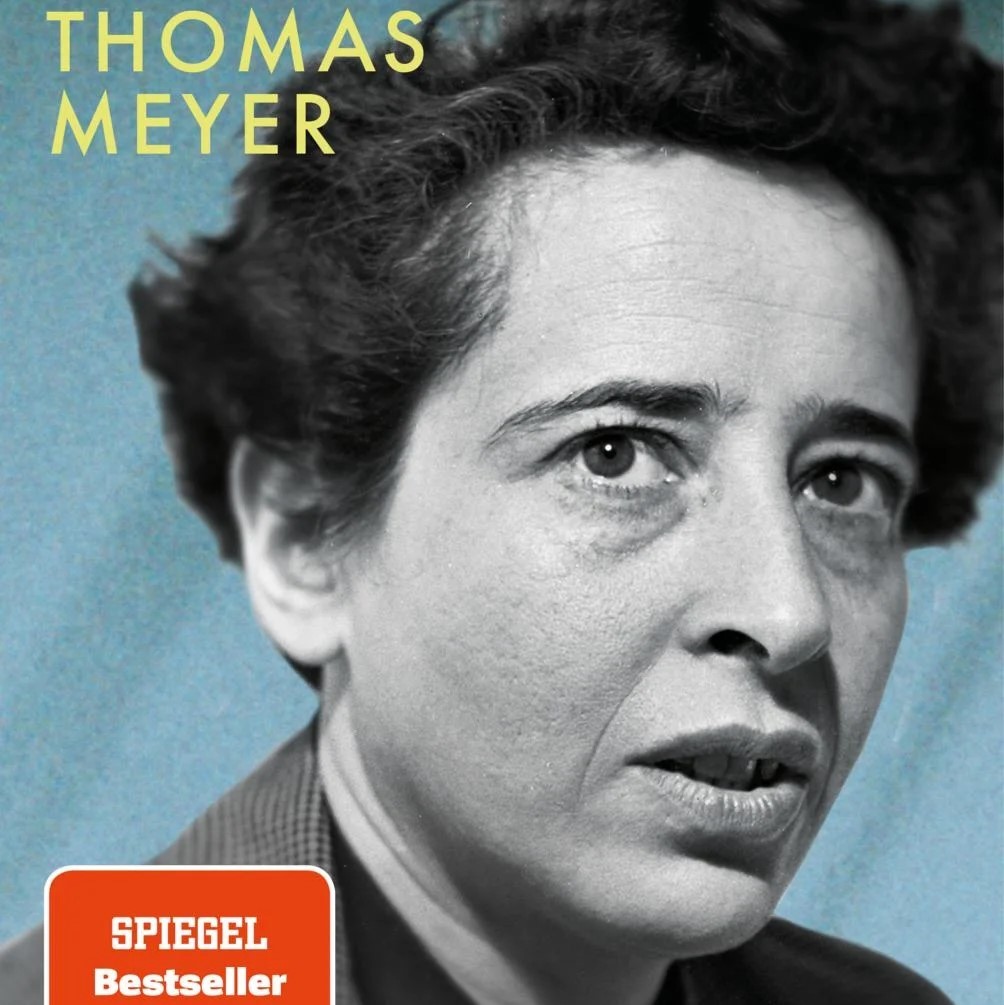
„Man … (kann) sich nur als das wehren … als was man angegriffen wird. Ein als Jude angegriffener Mensch kann sich nicht als Engländer oder Franzose wehren.“ Hannah Arendt
mehr
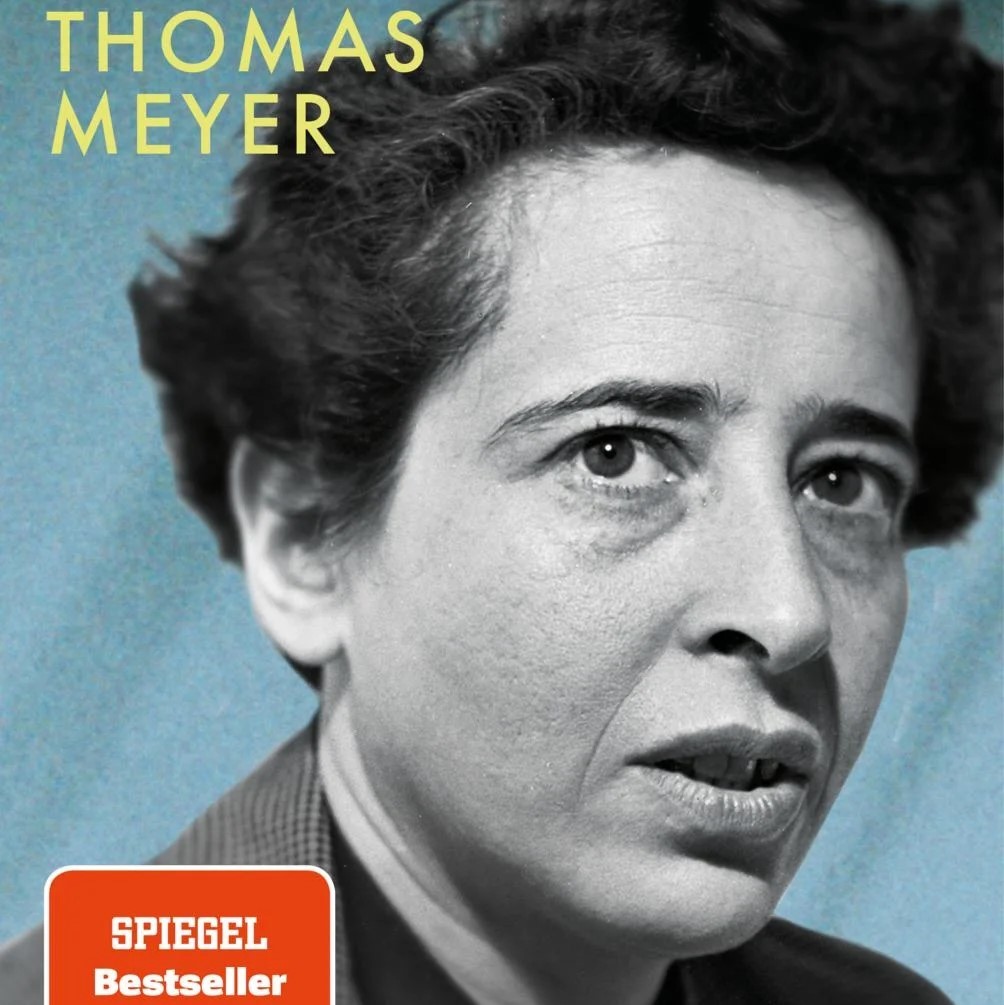
Adorno bezeichnet den Antisemitismus als „Planke in der Plattform“ des Nachkriegsrechtsradikalismus. Ihrem Mann schreibt Arendt 1949 aus Deutschland: „Weißt Du eigentlich, wie recht Du hattest, nie wieder zurückzuwollen?“ Arendt deprimieren die rasanten Restitutionen zum Vorteil der nationalsozialistischen Funktionselite. Es werde im großen Stil investiert, schreibt sie. „Entnazifizierte SS-Führer“ kämen mit viel Geld in das Casino der neuen Zeit. Raubgoldgerüchte kursieren. Investigationen in diese Richtung hält Arendt für lebensgefährlich.
mehr
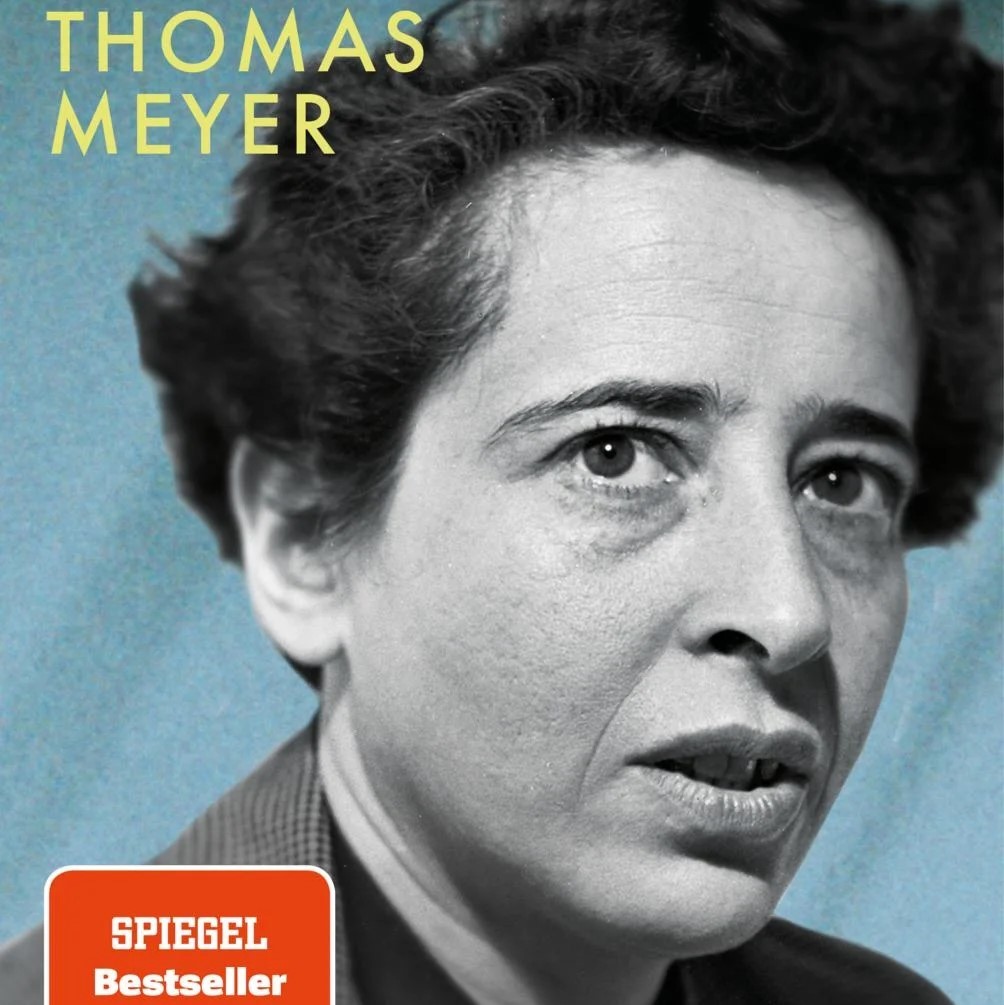
„Wo Tatsachen konsequent durch Lügen und Totalfiktionen ersetzt werden, stellt sich heraus, dass es einen Ersatz für die Wahrheit nicht gibt. Denn das Resultat ist keineswegs, dass die Lüge nun als wahr akzeptiert und die Wahrheit als Lüge diffamiert wird, sondern dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird.“ Hannah Arendt
mehr
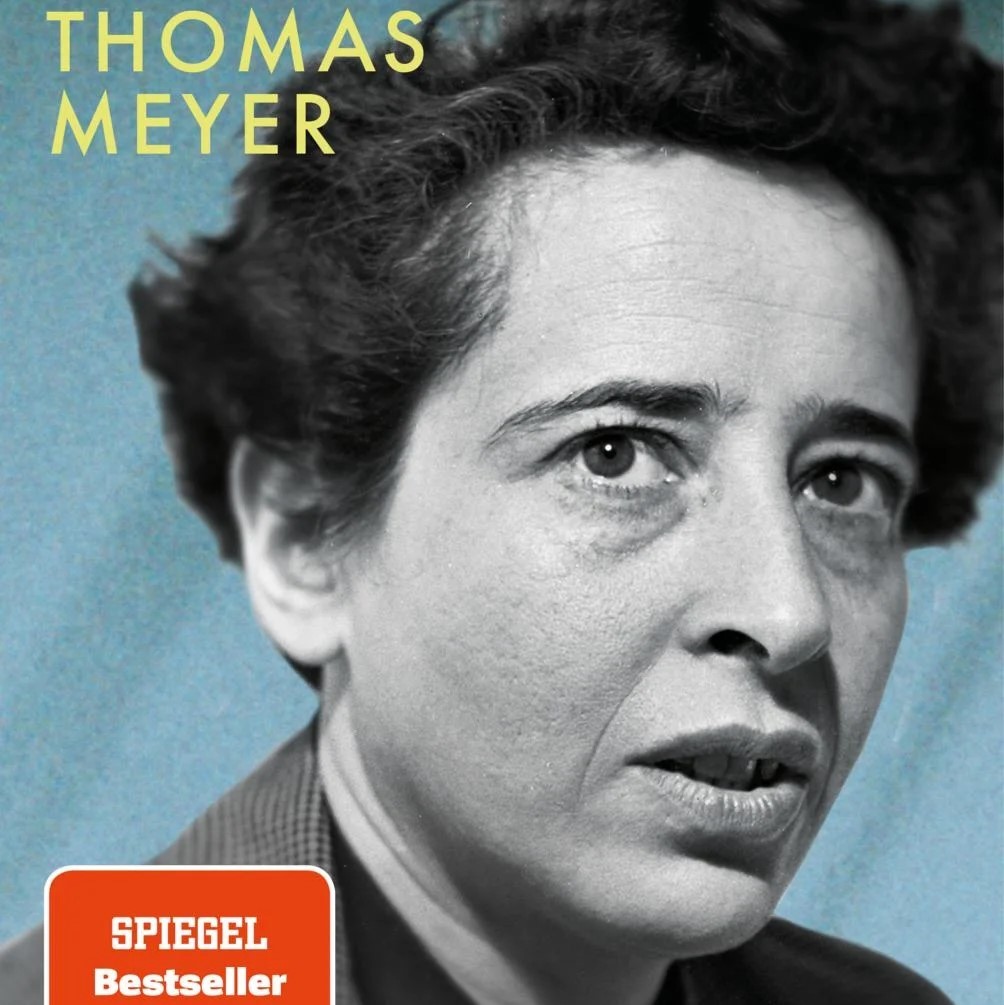
In den ersten Jahren ihres Exils hält Hannah Arendt Vorträge an der Pariser Volkshochschule. In diesem Umfeld begegnet ihr im Sommer 1936 erstmals Heinrich Blücher (1899 - 1970), ein so Meyer, mit allen Wassern der kommunistischen Konspiration gewaschener, autodidaktisch beschlagener, mit „intuitiver Intelligenz“ gesegneter Kader. Der schon zweimal verheiratete, vom Kommunismus allmählich abgerückte ...
mehr
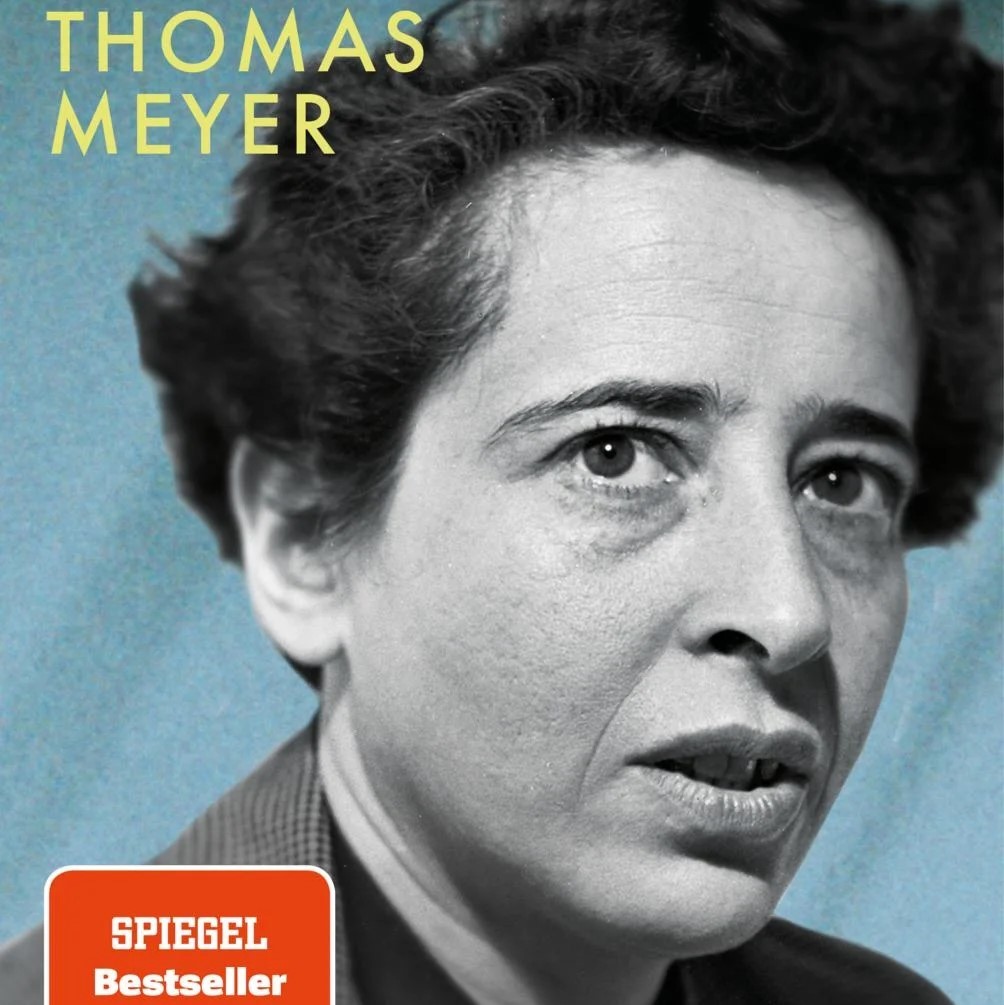
Entscheidend bleibt, dass Heidegger mit seinem Programm durchkommt; dass ihm die Nachkriegsfürsten, denken sie an Rudolf Augstein, das hochtrabende Gemurmel und die wegwerfenden Bemerkungen durchgehen lassen. Die bundesrepublikanische Restauration koinzidiert mit dem Achtundsechziger-Aufbruch. Zeitgenössisch Gewendete ...
mehr
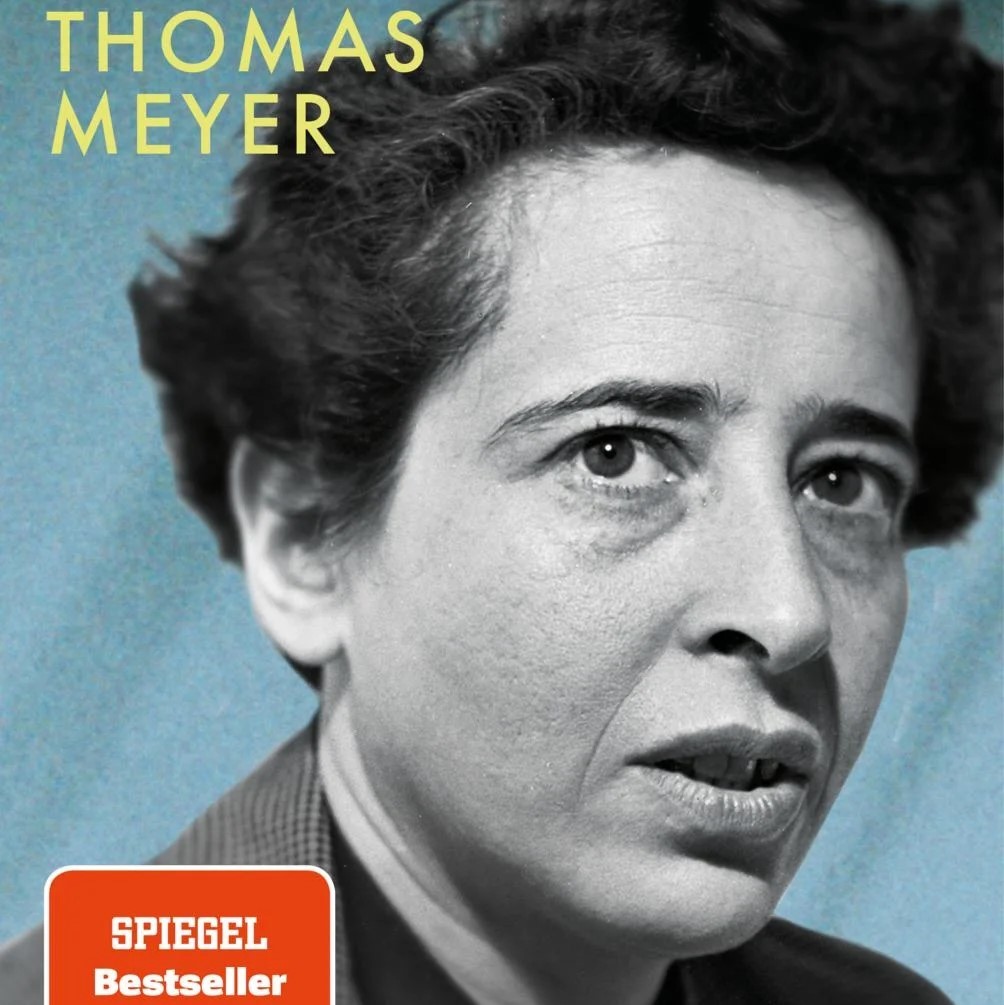
Die Liebesgeschichte beginnt im Wintersemester 1924/1925. Bald schreibt der verheiratete, vom „jähe(n) Blitz“ getroffene Universitätslehrer: „Das Dämonische hat mich getroffen … noch nie ist mir so etwas geschehen“.
mehr
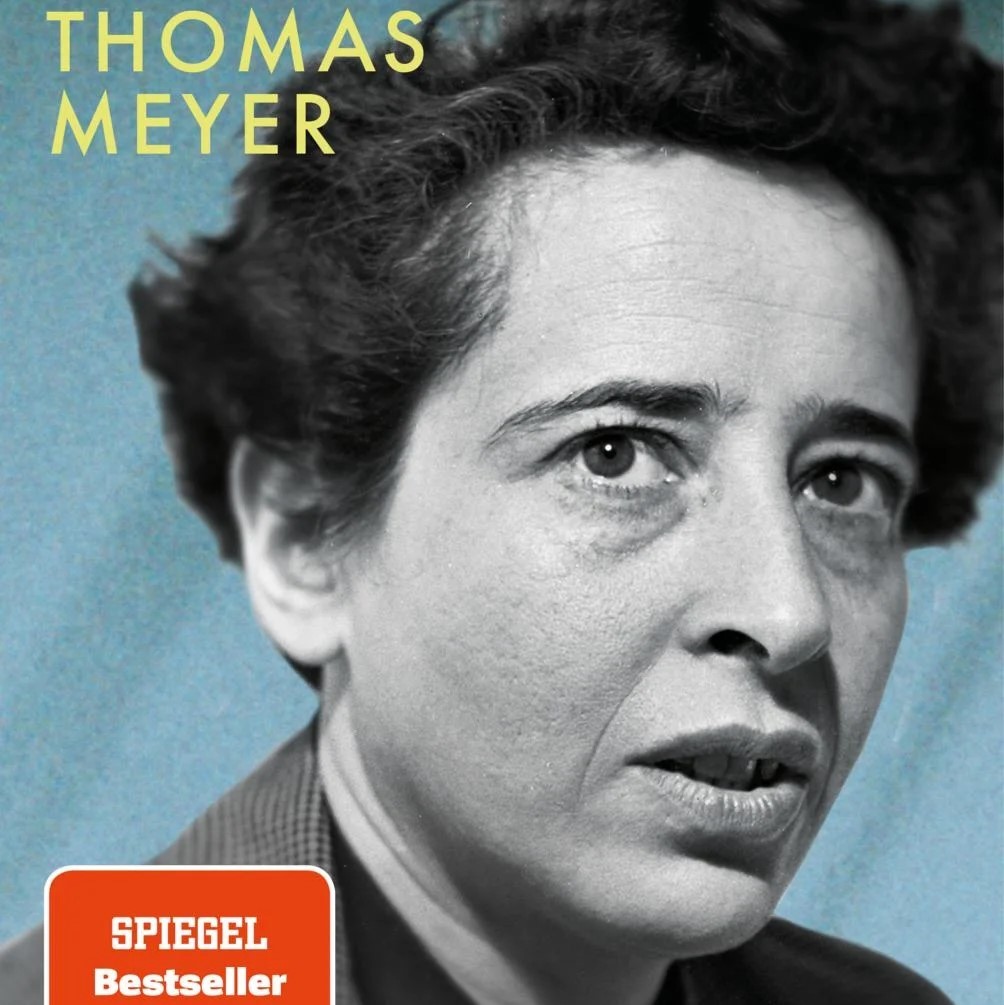
„Wer dies Gespräch hört und Dich sieht, wird nicht ausweichen können. Selbst Deine Feinde werden, wenn sie neue Argumente gegen Dich daraus holen, betroffen sein.“ Karl Jaspers nach der Ausstrahlung eines TV-Interviews, in dem Günter Gaus Hannah Arendt befragte. Die Aufzeichnung fand am 16.09. 1964 in einem Münchner ZDF-Studio statt.
mehr
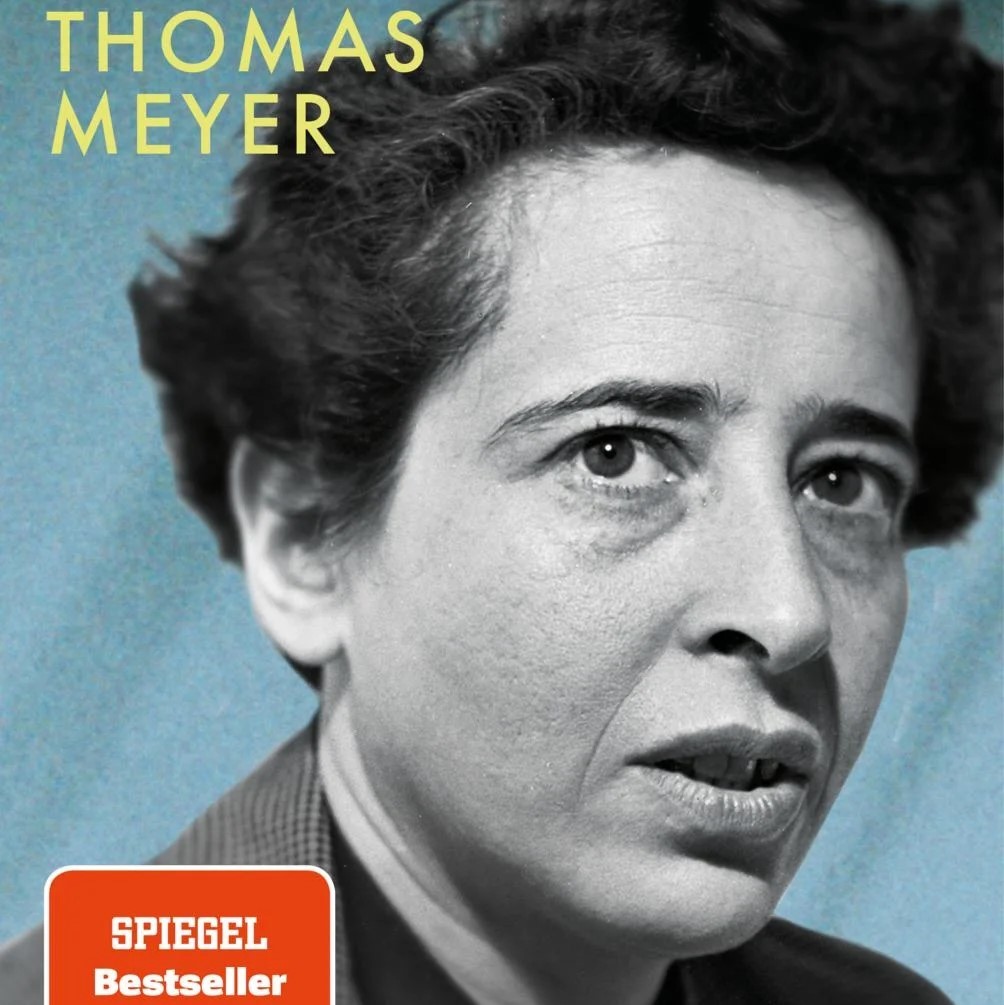
„Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist.“ Walter Benjamin
mehr
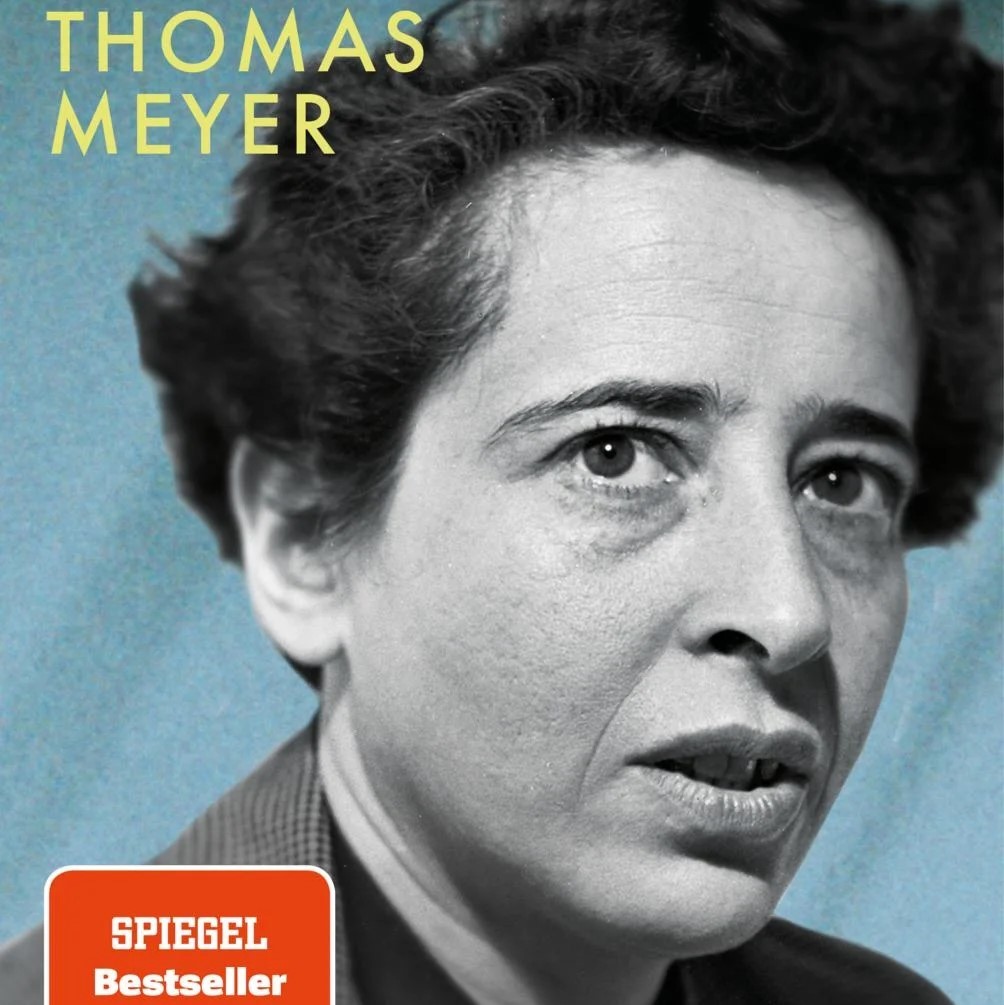
„Der Einbruch des Lichts erfolgt in die allertiefste Dunkelheit.“ Bertolt Brecht
mehr
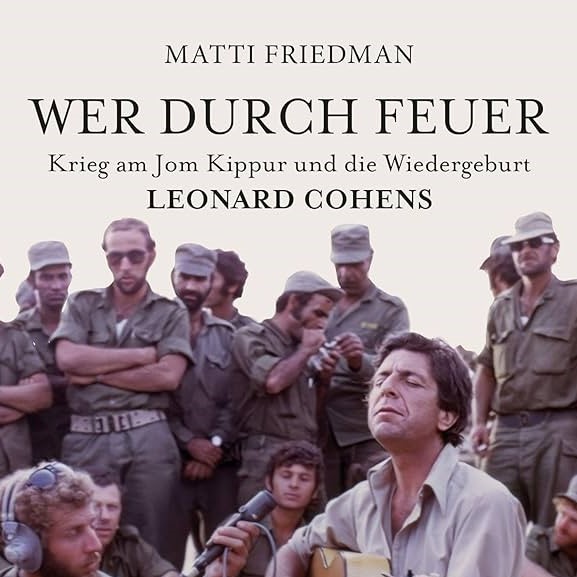
Leonard Cohen sang im Jom Kippur Krieg vor israelischen Soldat:innen. Für den Reporter eines Musikmagazins war der Star in der Wüste nur ein „besserer Tourist“. Die Überspannung des Augenblicks an einem äußersten Punkt des Lebens, in dem keine Suggestion die Vortragsmagie in der sagenhaften Wüste Sur übersteigt, und Cohen so konkurrenzlos wie der Messias erscheint, evoziert einen Bildersturm des Elementaren. Kongenial charakterisiert Friedman den Typus der hingerissenen Verteidiger:innen Israels „Sie waren die erste Generation einheimischer Israelis - nicht geflohen, keine Minderheit, nicht religiös, nicht wirklich Juden, vielmehr aus Sonnenlicht und Salzwasser erstandene Wesen.“
mehr
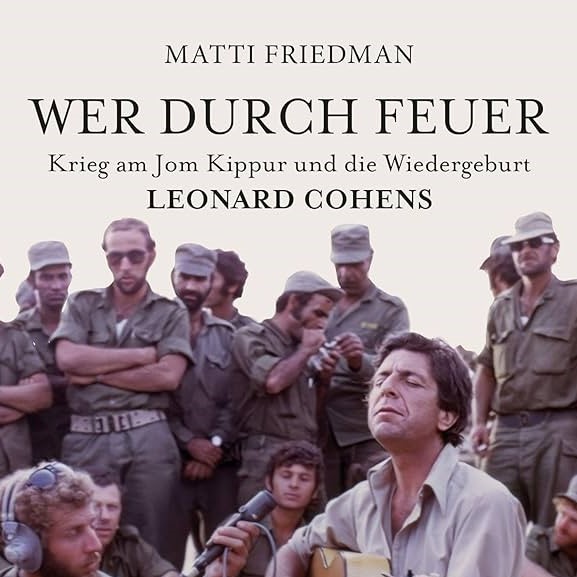
Seine eigene Erzählung beginnt Friedman auf dem 1968 als Stützpunkt der israelischen Luftwaffe angelegten, heute in Ägypten liegenden Flughafen Sharm El-Sheikh. Friedman schildert den koedukativ-zivilen Duktus der Mannschaft einer Radarstation im Modus „theoretischer Alarmbereitschaft“. Ein Foto zeigt Adoleszenten im Hippie-Look. Die rekrutierten Teens & Twens baden nackt. Sie langweilen sich, spielen Gitarre, grillen und rezitieren Gedichte.
mehr
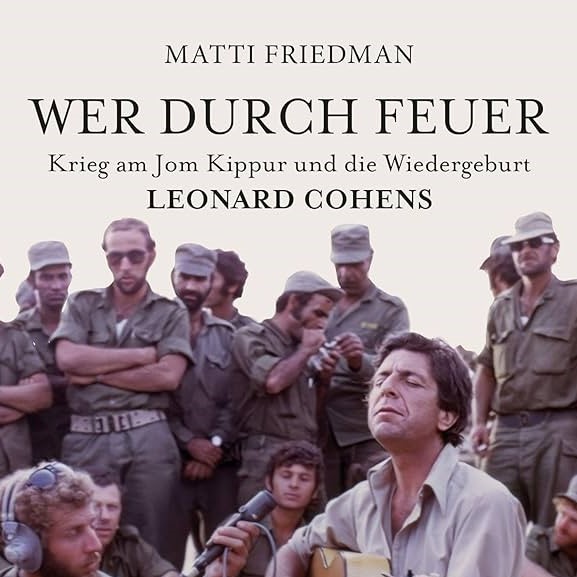
Leonard Cohen sang im Jom Kippur Krieg vor israelischen Soldat:innen. Für den Reporter eines Musikmagazins war der Star in der Wüste nur ein „besserer Tourist“. Die Überspannung des Augenblicks an einem äußersten Punkt des Lebens, in dem keine Suggestion die Vortragsmagie in der sagenhaften Wüste Sur übersteigt, und Cohen so konkurrenzlos wie der Messias erscheint, evoziert einen Bildersturm des Elementaren. Kongenial charakterisiert Friedman den Typus der hingerissenen Verteidiger:innen Israels. „Sie waren die erste Generation einheimischer Israelis - nicht geflohen, keine Minderheit, nicht religiös, nicht wirklich Juden, vielmehr aus Sonnenlicht und Salzwasser erstandene Wesen.“
mehr
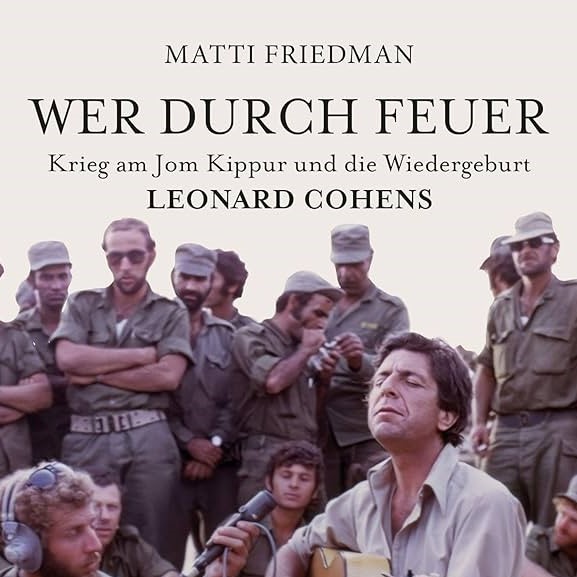
Für den Reporter eines israelischen Musikmagazins ist der Star in der Wüste nur ein „besserer Tourist“. Er verspottet den von einer Schaffenskrise gebeutelten Künstler als „großen Pazifisten“. Dass einer Katharsis da sucht, wo andere verbluten, lässt sich leicht degoutant finden. Der Kanadier Leonard Cohen (1934 - 2016) wähnt sich auf den Kriegsschauplätzen an einem genealogischen Ursprung. Israel deutet er als „mythische Heimat“; während seine einzigartige Truppenunterhaltung selbst zum Mythos wird.
mehr

“The conquest of cultural power takes place before the assumption of political power. This is achieved through a concerted action of intellectual ‘organic’ appeals. They infiltrate every form of communication, every form of expression, and the academic media.” Antonio Gramsci
mehr

Als ich William Sung zum ersten Mal traf, war er bereits über neunzig. Er amtierte als Doyen einer Kampfkunstlinie, zu der ich mich jetzt nicht äußern will. Obwohl er so lebhaft wirkte wie eine mumifizierte Fliege und auch nicht mehr aus dem Bett kam, verblüffte er mich mit Skizzen von überraschenden Bewegungsabläufen, die er zittrig in die Luft zeichnete.
mehr

„Es bedurfte eines Wahnsinnigen, um die Farce in ein Trauerspiel zu verwandeln.“ Konrad Engelbert Oelsner über die Ereignisse rund um den 20. Juni 1792, als bewaffnete Sansculotten in die Tuilerien eindrangen, wo Ludwig XVI. und Königin Marie Antoinette in ihrem Palast das Dasein von Festgesetzten fristeten, die den revolutionären Furor artig begrüßen mussten. Der degradierte König sagte zu allem Ja und Amen, was ihm am Leben zu bleiben versprach. Der vormals absolutistische Herrscher figurierte als Hampelmann mit Krone. Oelsner sah ihn gute Miene machen zum bösen Spiel der Stürmer:innen und Dränger:innen.
mehr

„Auch Worte sind wichtig. Aber der marxistische Politologe Ernesto Laclau hat einmal den Begriff des ‚leeren Signifikanten‘ verwendet. Ich finde, das passt ganz gut auf das Diktum der Sicherheit Israels als deutscher Staatsräson.“ Carlo Masala in der 'Jüdischen Allgemeinen'
mehr
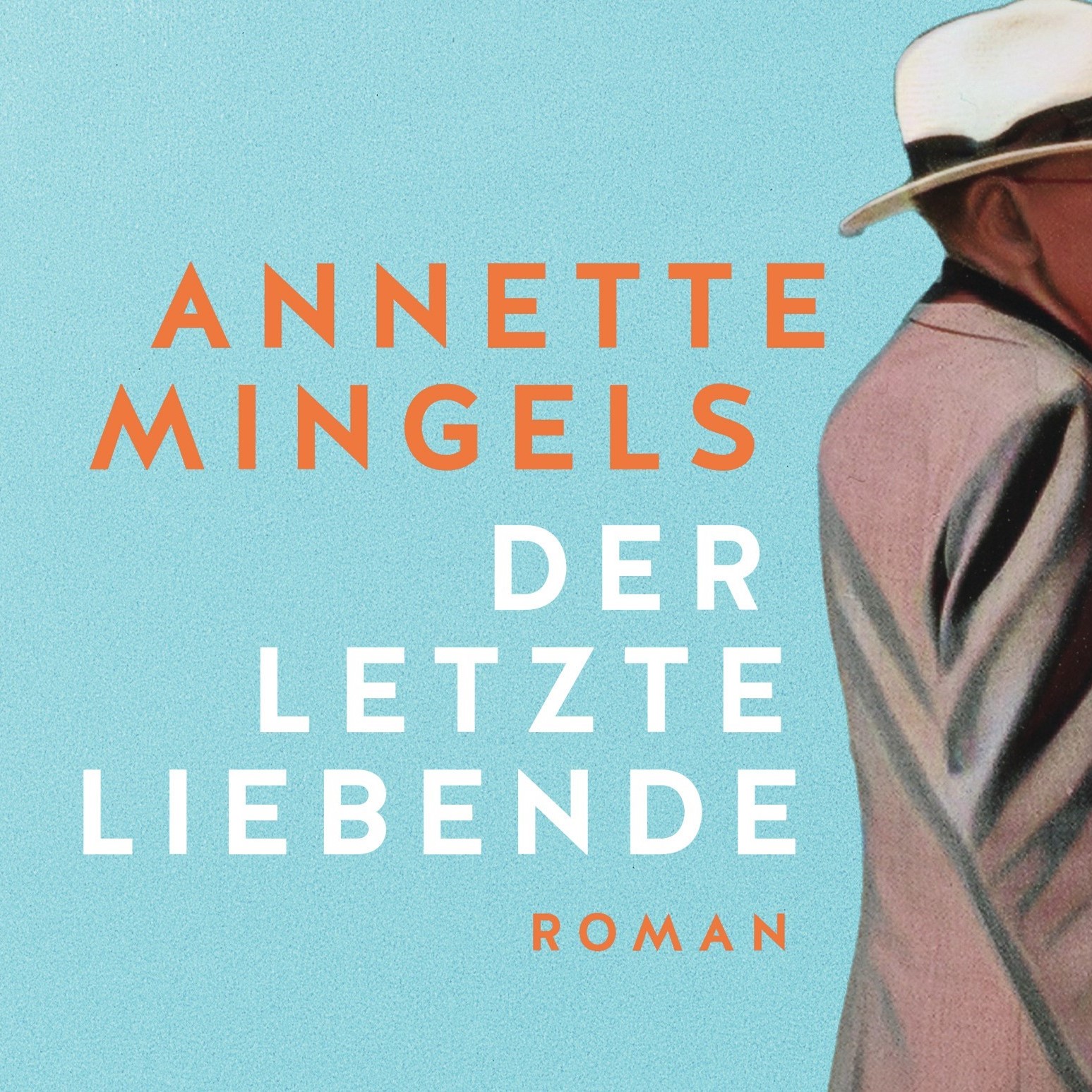
In ihrem Roman „Der letzte Liebende“ verknüpft Annette Mingels deutsche Geschichte mit zumindest halbwegs amerikanischen Lebensläufen. Ihre Zentralfigur absolviert den Parcours der Kindheit und Jugend in der DDR. Karl/Carl startet als Spross einer ‘Umsiedler‘-Familie. Er wird von der Konfirmation abgehalten und zur Jugendweihe gedrängt. Er trägt nicht schwer an der Schuld ...
mehr
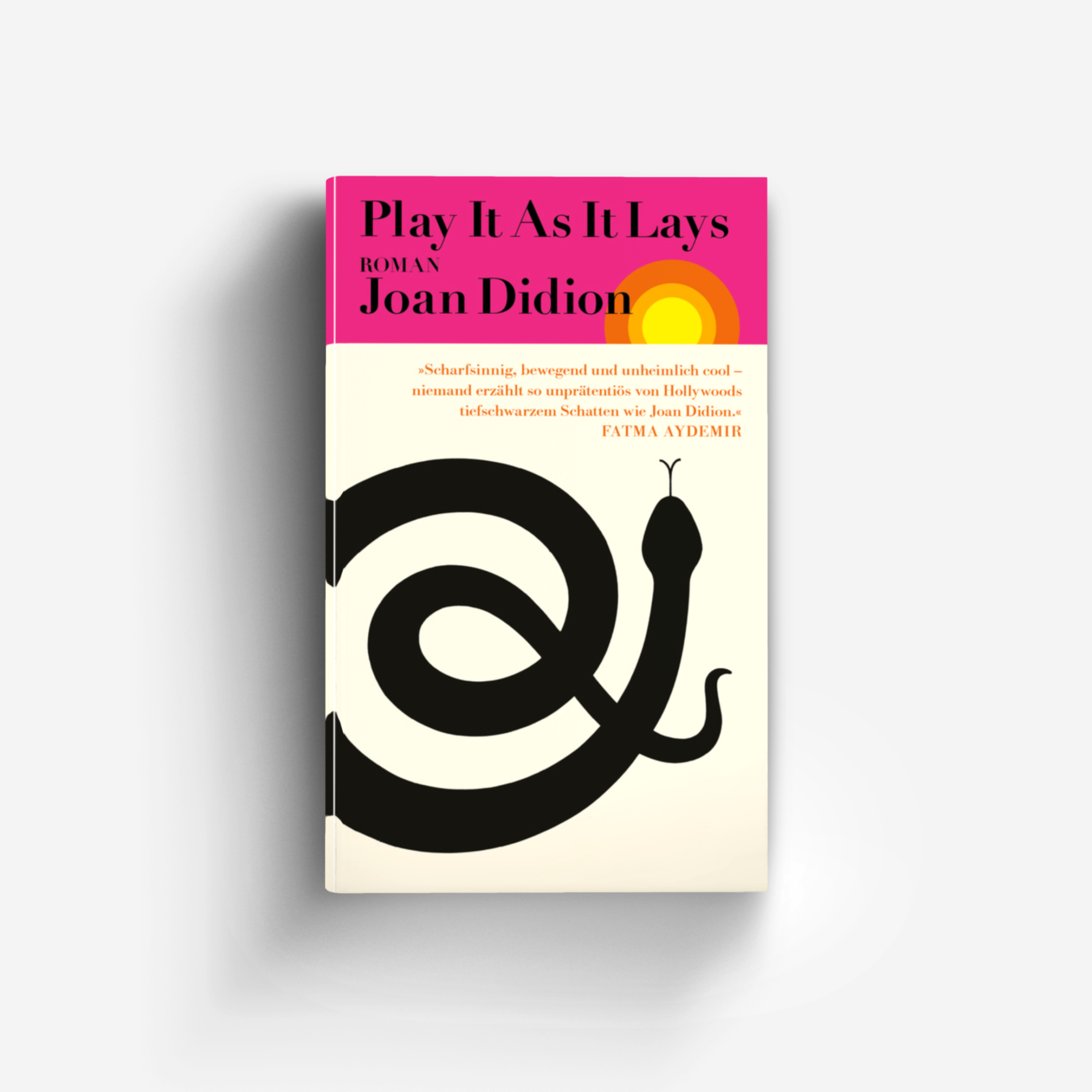
In Maria Wyeths Welt gelten „Versagen, Krankheit, Angst … als übertragbar, ein ansteckender Mehltau auf glänzenden Pflanzen“. In der Bürosphäre ihres Agenten begegnet sie einem Schauspieler. Gnadenlos konstatiert die erzählende Instanz: „Der Blick, den er Maria schenkte, war pflichtschuldig aufgeladen mit sexueller Wertschätzung, die nicht Maria galt.“
mehr
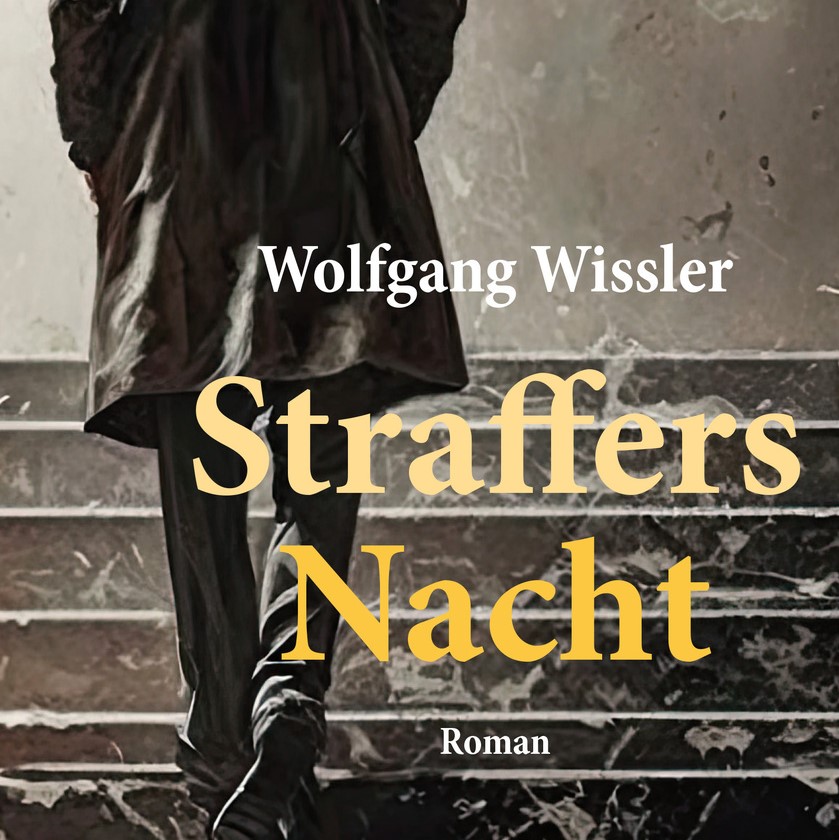
„Die Ein- und Ausschlusslinien der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft“ (Samuel Salzborn) verlieren in der Bundesrepublik nicht ihre Geltung. Die NS-Ästhetik geht unerkannt als Unschuld vom Land und langweilt die künftigen Achtundsechziger:innen mit ihrem Kitsch. Niemand käme auf die Idee, den Heimatfilm für etwas anderes als eine Reaktion auf Verluste zu halten. In Wahrheit tarnt sich der Faschismus im Heimatfilm ...
mehr
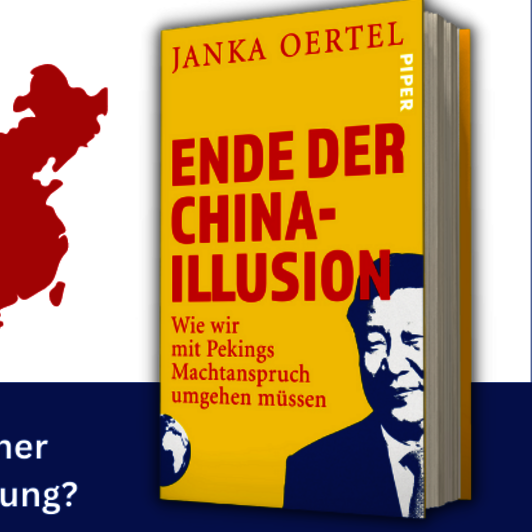
Zwei Punkte bestimmen die chinesische Staatsdoktrin maßgeblich: das Verhältnis zum einzigen Konkurrenten, der China militärisch gefährlich werden kann, und die Auswertungen des Kollapses der Sowjetunion. In ihrer Analyse überliefert Janka Oertel eine Pekinger Einschätzung nach der „die Kommunistische Partei der Sowjetunion die Macht verlor, weil niemand Manns genug war, für ihren Erhalt zu kämpfen“.
mehr
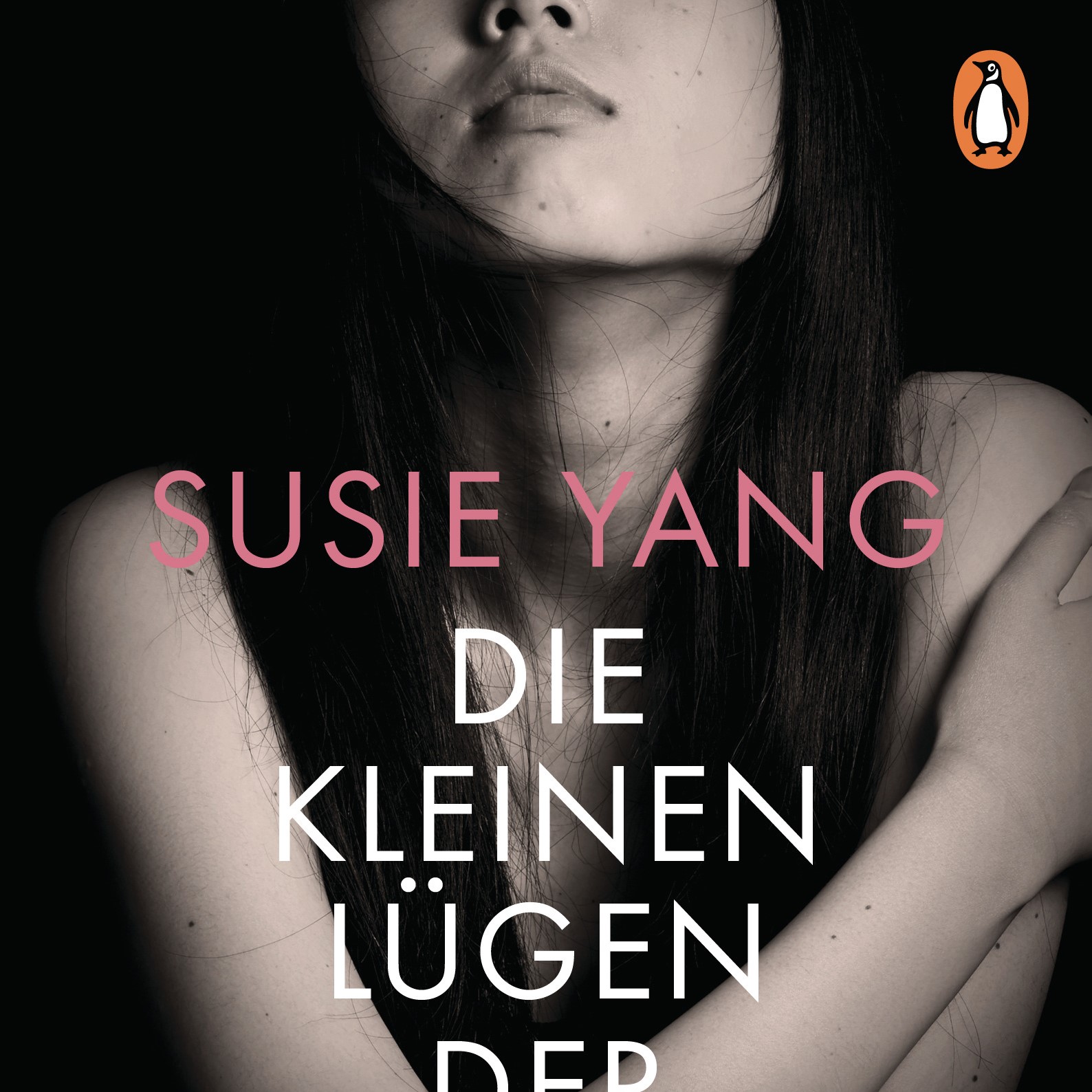
Ivy wächst in Boston und New Jersey auf. Sie erlebt eine Reihe von Liebespleiten im Dunstkreis reicher weißer Kandidaten. Obsessiv erscheint eine Fixierung auf den Irisch-Katholischen-Kennedy-Typus. Auf einer Party studiert sie den Einrichtungsstil der Gastgeberin. Sie registriert das Preisschild eines unscheinbaren Holzstuhls: 3950 Dollar.
mehr
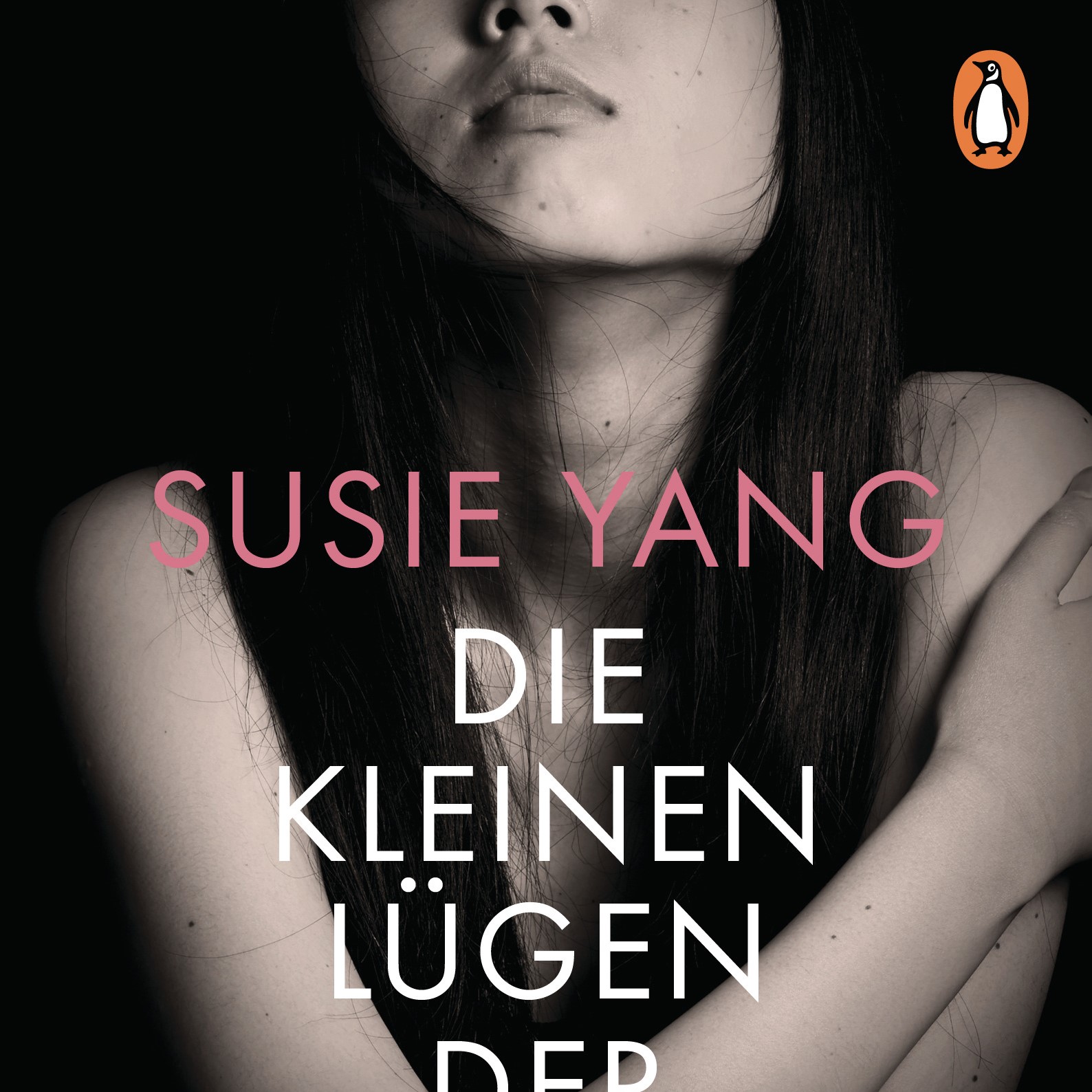
Großmutter Meifing führt ihre Enkelin Ivy in Feinheiten des Ladendiebstahls ein. Den Klau von zwei Schals tarnt die Versierte mit einem Etikettenschwindel. Ein von ihr selbst im Preis herabgesetzter Pullover lässt sie an der Kasse als reguläre Kundin erscheinen. Die Lektion lautet: „Du musst mit einer Hand geben und mit der anderen nehmen. Niemand wird auf beides gleichzeitig achten.“
mehr
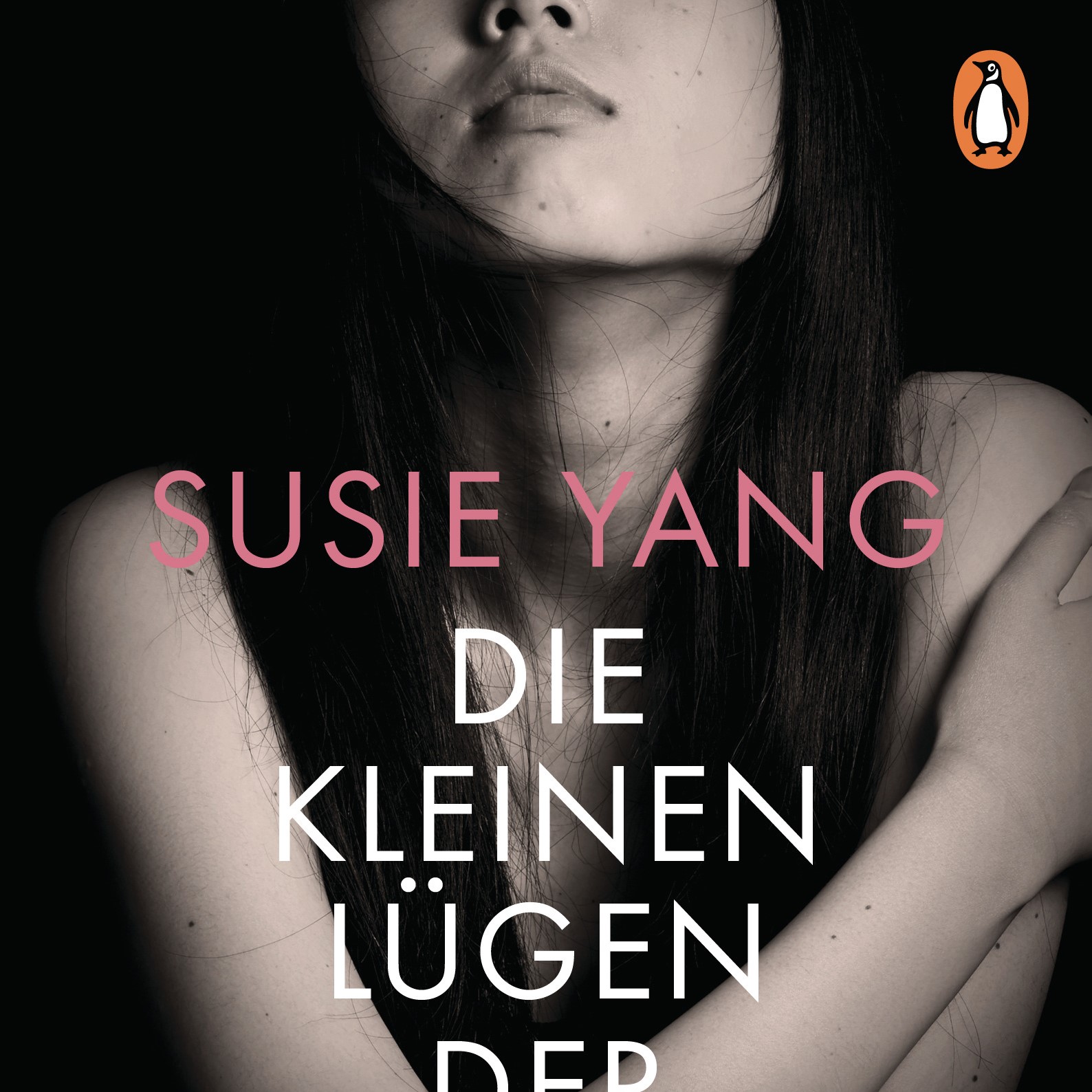
Susie Yang erzählt eine paradoxe Geschichte. Während in der Volksrepublik China der Wohlstand ausbricht, und Leute, die sich eben noch über ein Fahrrad zu freuen in der Lage waren, Kataloge nach Luxusartikel durchforsten, die sie für einen Augenblick nur an die Spitze des Konsumwettbewerbs setzen, konkurrieren chinesische US-Migrant:innen mit anderen Minderheiten um Nebenstellen und Randpositionen des Mainstream-Flows. Sie isolieren sich in ethnisch definierten Gemeinschaften. Für Susie Yangs Heldin Ivy geht es stets darum, dem Community-Knast und seinen Ideologien zu entkommen. Ivy fühlt sich ganz und gar als Amerikanerin.
mehr

Auch Valeries erster Weltmann, Josh, genannt Hamlet (den Spitznamen findet Valerie nun prätentiös), macht jenseits des Atlantiks einen auf unsterblich. In der Zeit ihres vollen Glanzes hielten Valerie und Hamlet im Schwarzwald Voodoo-Séancen ab, die das kosmische Gleichgewicht erschütterten, Sterne in Trance versetzten und Jahwe mit Shiva versöhnten. Zwei Tage nach einer spirituellen Himmelfahrt flog Valerie im Auftrag ...
mehr

Ein Vorstadtsonntagvormittag im Flutlicht des magischen Frühlings Neunundsechzig. Die dahinplätschernden Routinen am Saum der Seligkeit enden je. Vom Anblick der neuen Nachbarin gedopt, legt Irmen Gerold eine (seinen Sohn Merlin) erschreckende Hilfsbereitschaft an den Tag. Dorothea G., eine so perfekt ins Bild passende Person, das sie eine Jeans für sich nicht passend findet, beobachtet die Szene am Küchenfenster. Vier Monate später vereint die erste bemannte Mondlandung die Welt vor den Bildschirmen. John Updike stellte den ...
mehr

Zu Beginn unserer Zeitrechnung erntete man im Schärenverbund an der Mündung des Yuejiang Salz und Perlen. Ein chinesisches Tortuga bot sich Briganten als An- und Auslauffläche an. Dann kamen schon die ersten Migrant:innen, die ein Leben unter mongolischer Herrschaft vermeiden wollten. In der Neuzeit machten Portugiesen Hongkong zu einem Außenposten ihres Imperiums, bis sie von den Briten verdrängt wurden.
mehr
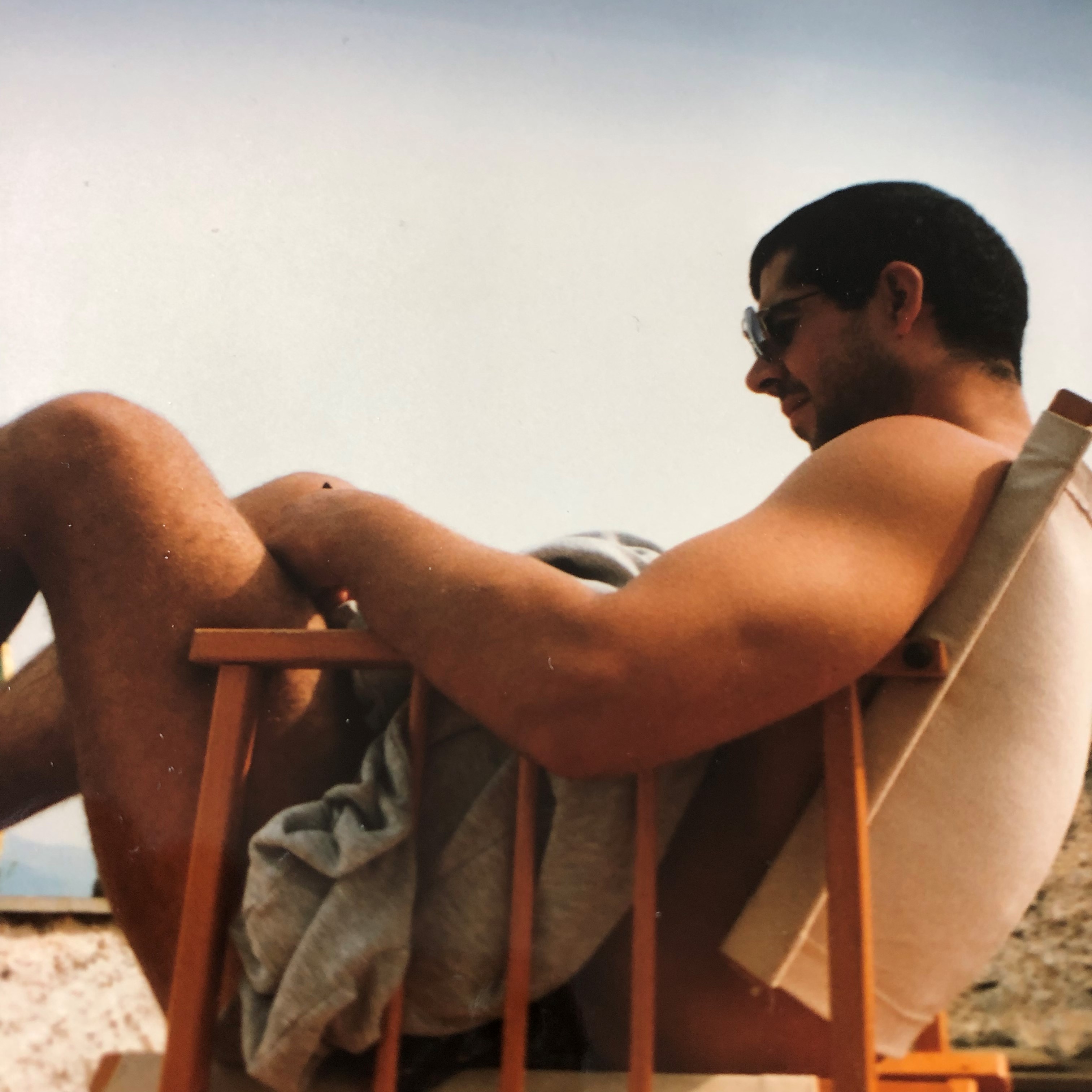
The purposeful exploitation of an affect to load an uninteresting muscular work with feelings of pleasure. In the sense of: Thoughts drive physiological processes.
mehr

In den 1950er Jahren beginnt Samuel Beckett das eigene Werk in seine Muttersprache zu übertragen. Er übersetzt sich selbst aus dem Französischen, so wie er sich in den 1920er Jahren ins Französische zu übersetzen begann. Er synchronisiert seine Denksprachen zunächst mit dem Ehrgeiz im Französischen ...
mehr
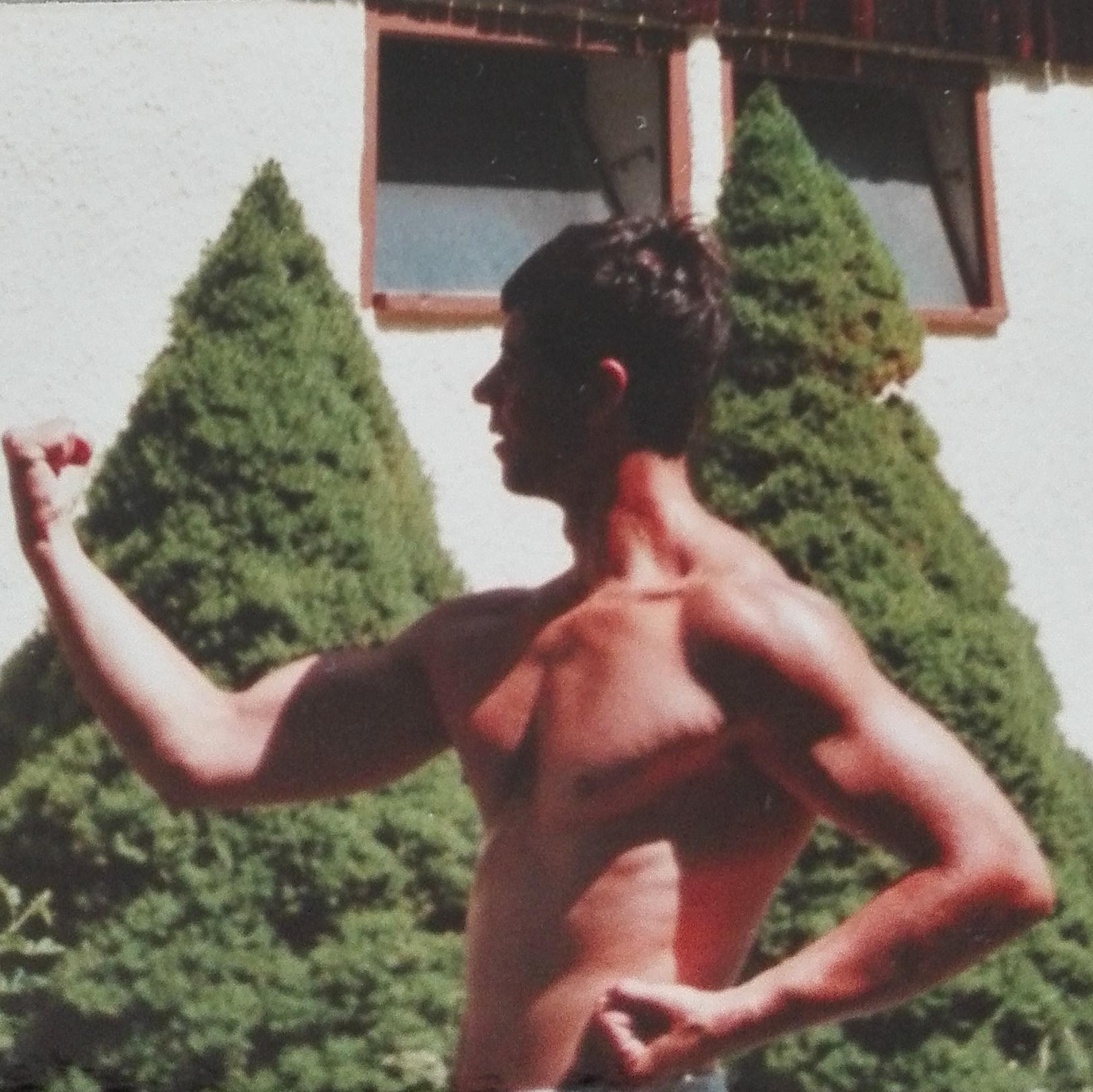
„Der Konkurrenzkampf der kulturellen Evolution drängt uns zu Werten, die in der jeweiligen Phase der Energiegewinnung am besten funktionieren“, sagt Ian Morris. Menschliche Werte haben biologische Wurzel und genetische Anker. Sie sind Anpassungsprodukte. Werte entstehen in funktionaler Rivalität zu evolutionären Anforderungen. Morris unterscheidet drei Generallinien unserer Entwicklung – Freibeuter:innen - Landwirt:innen - Nutzer:innen fossiler Brennstoffe. Margaret Atwood schätzt in ihrem Aufsatz „Wenn die Lichter ausgehen“, dass nach einem Energiekollaps kein Tag vergeht, bis das Regime der Straße die Herrschaft an sich gerissen haben wird.
mehr

Ist es nicht der Überfluss, der zum Verdruss führt? Jedem Spatzenlaut entnimmt Anton philosophische Prisen. Schopenhauer definiert Genialität, als „die Fähigkeit, sich rein anschauend zu verhalten“. Elegisch gestützt auf eine Forke, präsentiert sich der kaum alphabetisierte Selfmade-Millionär im blütenweißen Seidensticker Hemd, mit schlohweißer Mähne. Anton umgibt eine Aureole.
mehr
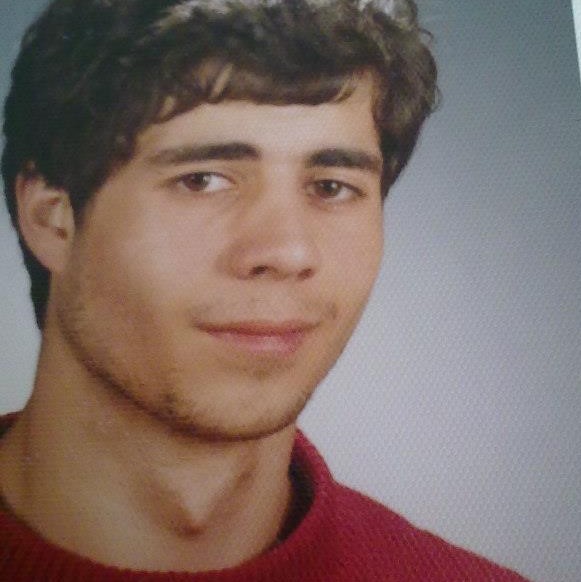
Bir traktör en zayıf halkası kadar iyi olabilir - Jeder Traktor ist so stark wie sein schwächstes Glied. Zwei Merkmale limitieren den osmanischen Supermann. Tayfun kann nicht zeugen und er kann nicht kraulen. Als unfruchtbarer Brustschwimmer neigt er zu operettenhaften Formulierungen seiner Vorsätze. An jedem Workout-Morgen schwört Tayfun seinem Schweiß, sich niemals so viel Schwäche zu gestatten, dass er die Gewalt (Verdrängungswucht) der Nachkommenden bloß noch zahnlos weglächeln kann.
mehr

„Um Qi zu verstehen, müssen wir uns die frühesten Schriften darüber ansehen und verstehen, was die chinesischen Schriftzeichen bedeuten. Die Schriftzeichen beziehen sich auf Dampf (Luft) und Reis (Nahrung). Die Verbindung von Nahrung und Luft erzeugt Energie. In der westlichen Medizin wird dies als Zellatmung bezeichnet. Ihre Körperzellen nutzen den Sauerstoff, den Sie einatmen, um Energie aus der Nahrung zu gewinnen, die Sie essen.“ Michael Watson
mehr
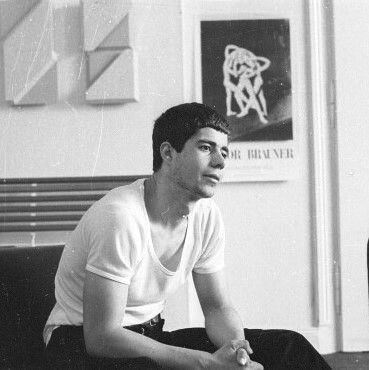
Alissa, kurz Issa, hasst die Superpower ihrer penetrant siegreichen Mutter. Die promovierte Hausfrau Veronika springt vor lautet Esprit und Elan im Dreieck. Als ehemalige Springreiterin (manche sahen in ihr eine Regionalausgabe von Helena Weinberg) ist die mit dem Privatklinikchef Tayfun Yıldız verheiratete Lieblingstochter des Selfmade-Millionärs Anton Steinbrecher über den Landkreis hinaus so berühmt, dass sie sogar in Stuttgart auf der Straße lobende Ansprachen über sich ergehen lassen muss.
mehr
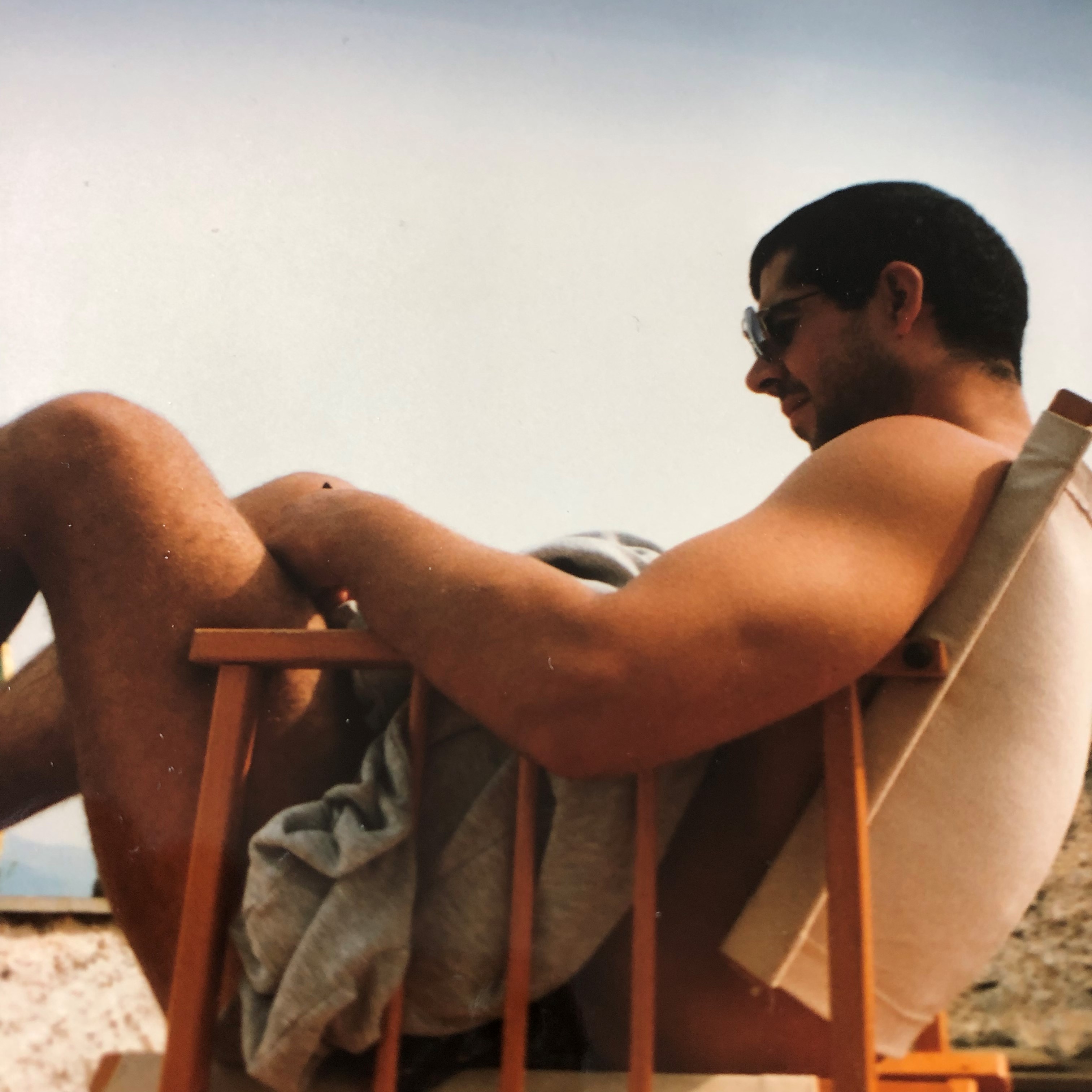
Das restaurierte Milchhäuschen. Die Wiederbelebung dörflicher Gemeinschaftsbacktraditionen. Wochenmärkte und Hofläden. Gelangweilte Hausfrauen in Hotpants vor antiken Eiscafés. Tayfun erregt es zuverlässig, in seinem 1963er Porsche 901 (ab 1964 911) die Landstraße direkt unter dem Bodenblech zu spüren. Von dem Oldtimer (mit einem luftgekühlten Sechszylinder-Boxermotor) wurden bis zur Umbenennung lediglich zweiundachtzig Exemplare verkauft. Wer weiß sowas überhaupt noch?
mehr

„Ich habe … wiederholt Proben dafür geben können, dass die Dichter Fehlleistungen ebenso als sinnvoll und motiviert auffassen, wie wir es … vertreten.“ Sigmund Freud
mehr
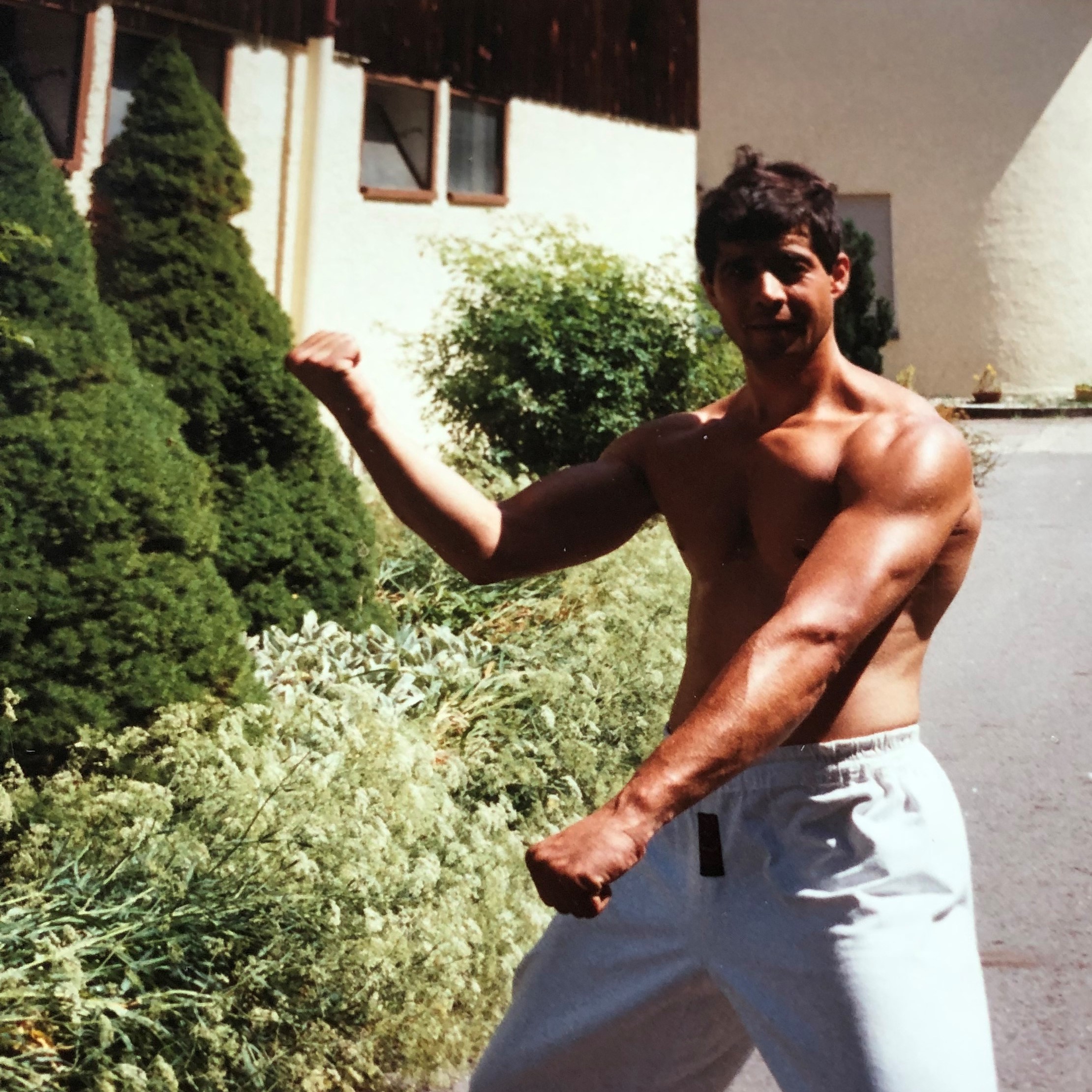
Täglich schließt Navin die Kreuzworträtsellücken der Ahne am gravitätischen Schreibtisch im Großraumwohnzimmer. Stille könnte einen Moment der inneren Einkehr begünstigen. Doch brüllt der Maximalfernseher von morgens bis abends, während so gut wie keine Sendung Betty die seelisch so notwendige Zustimmung gestattet. Vertrauenswürdig erscheinen ihr nur autoritär auftretende Männer, die sie an die leitenden Herren ihrer Jugend erinnern. Dazu gehörte der verstorbene Bernhard Grzimek. Betty trauert Leuten nach, denen sie nie persönlich begegnet ist.
mehr
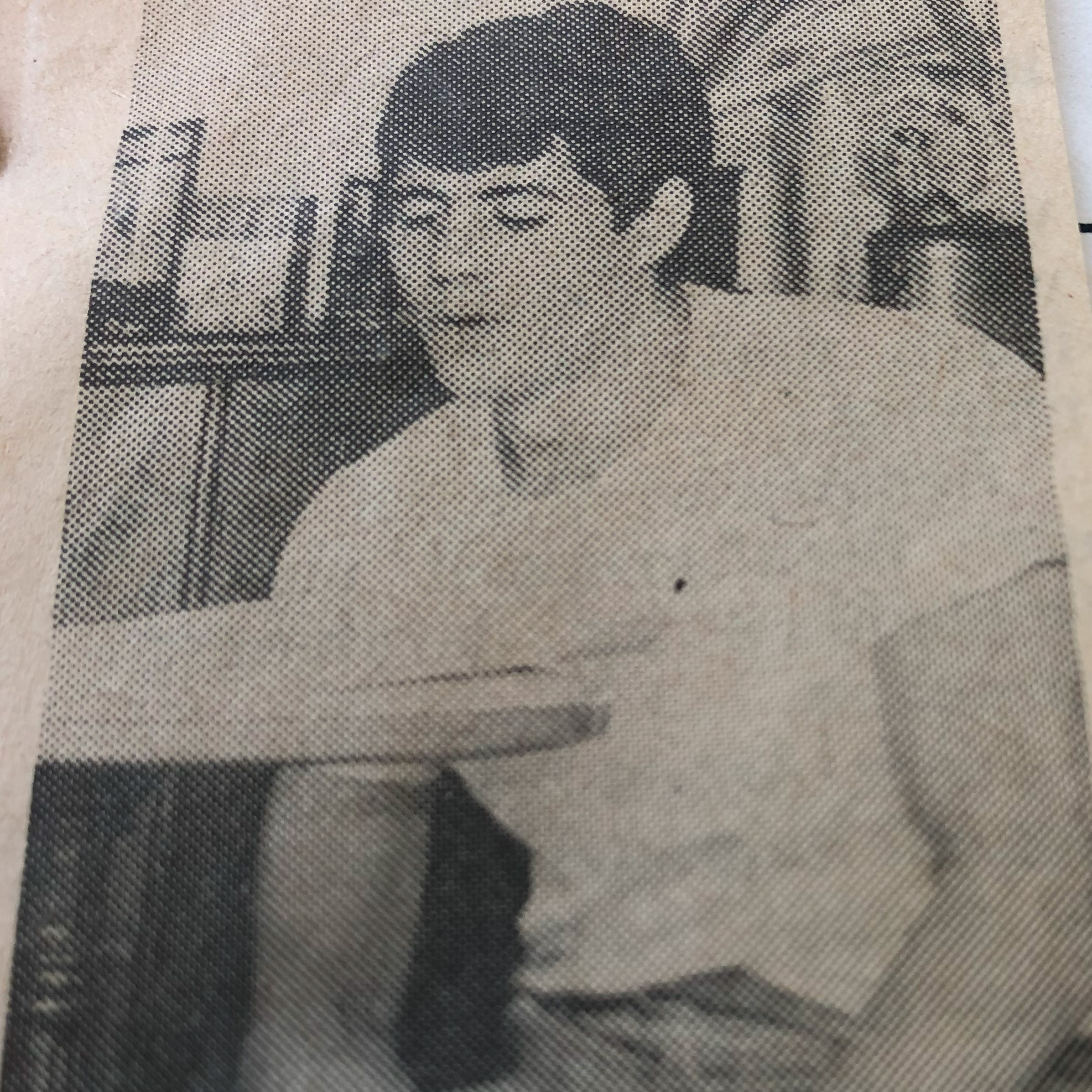
Elisabeth ‚Betty‘ Steinbrecher räuspert sich furios in ihrem futuristischen Fernsehsessel. Somnambul verschiebt sie die Brille auf dem Nasenrücken. Die Fernbedienung entgleitet der Sitzfläche und landet auf dem Teppich. Bettys Kopf sinkt unbequem auf einen Sesselwulst. Navins Großmutter wird gleich mit einem steifen Nacken aus ihrem komatösen Nickerchen erwachen.
mehr
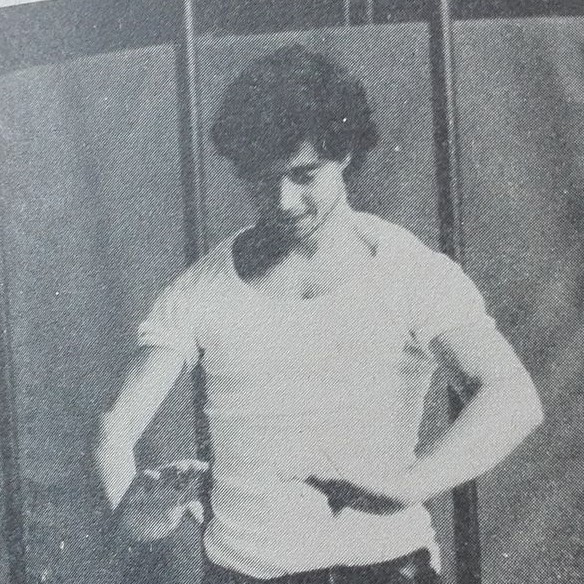
Der offiziell spukresistente Tayfun Yıldız neigt heimlich zu abergläubischen Spekulationen. Navin Steinbrecher, der siebzehnjährige Neffe seiner Ehefrau Veronika, kommt ihm immer mehr wie ein gut getarnter Alien vor; wie ein Bruder im Geist von E.T. oder Alf, der in den Weiten des Weltraums sozialisiert - und mit maximaler Kaltblütigkeit auf die Menschheit losgelassen wurde.
mehr

Doris und Raimund kennen sich aus Poona. Sie hätten sich auch beim Kraichgauer Weinfest über den Weg laufen können. Raimund stammt aus Knittlingen (der Geburtsstadt des Magiers Johann Georg Faust). Doris wurde im Kreiskrankenhaus Mühlacker geboren. Siebzehn Autofahrminuten verstreichen zwischen den Städten, wenn man sich an die Straßenverkehrsordnung hält.
mehr
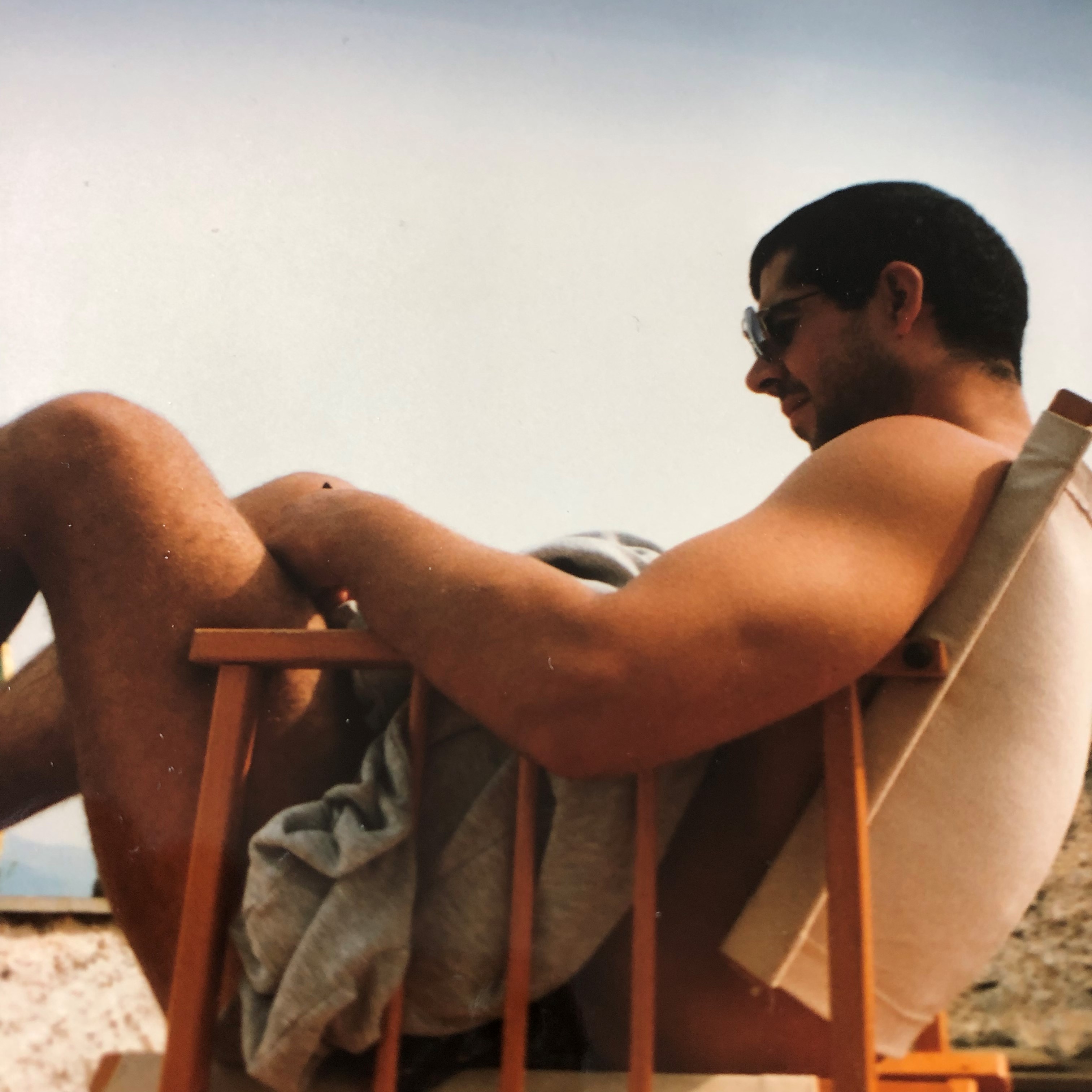
In einem späten Augenblick des 18. Jahrhunderts stürmen russische Truppen eine oberitalienische Zitadelle. Sie tragen die historische Flüchtigkeit eines Sieges davon, von dem nur die Leidtragenden Notiz nehmen. Das Missverhältnis von blutigem Getöse und politischer Wirkung löst Unbehagen im Themenpark der Peinlichkeit aus. Der folgenlos aufschäumende Betrieb wirkt abstoßend. Heinrich von Kleist spekuliert auf den Effekt ...
mehr

Im Schweiße seines Angesichts stemmt Navin mit dem Schlagbohrer eine Betondecke auf. Es ist neun Uhr am Vormittag und schon brüllend heiß. Nahe der Baustelle striegelt Navins Cousine Alissa, kurz Issa, die älteste Stute ...
mehr

Anton Steinbrecher geriert sich als Nonkonformist. Er prahlt mit seiner Unabhängigkeit. Zurück blickt er auf eine Vergangenheit als Kommunarde ...
mehr

Die Drachentodfama-Spindel dreht sich um einen Kampf in der karmisch-epischen Dimension. Der Sieger stand von vornherein fest, entpuppte sich dann aber als Verlierer.
mehr
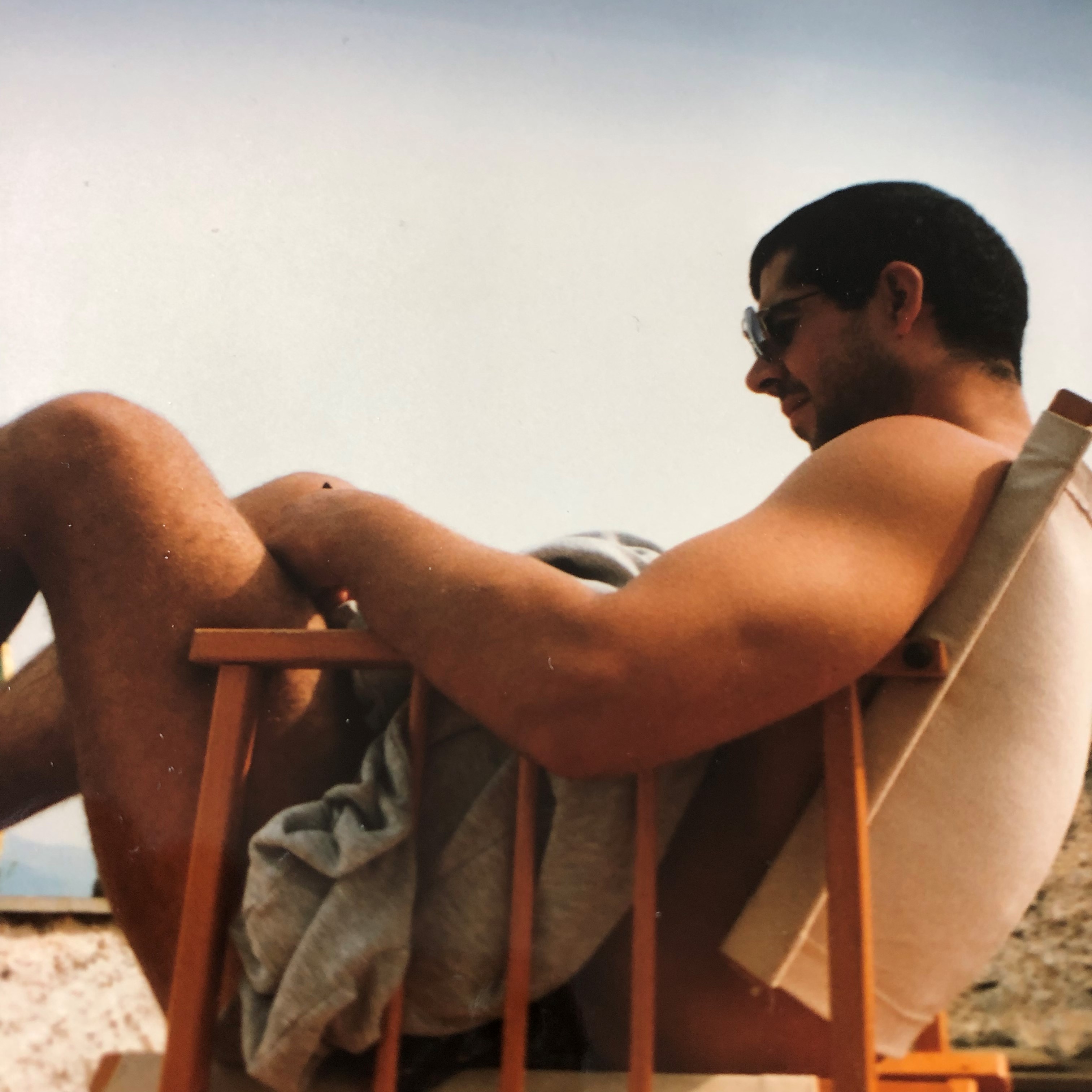
The fate of the overpowering enemy was to achieve a result with superpower, that you would otherwise only be able to achieve with idiots. Jamal Tuschick
mehr
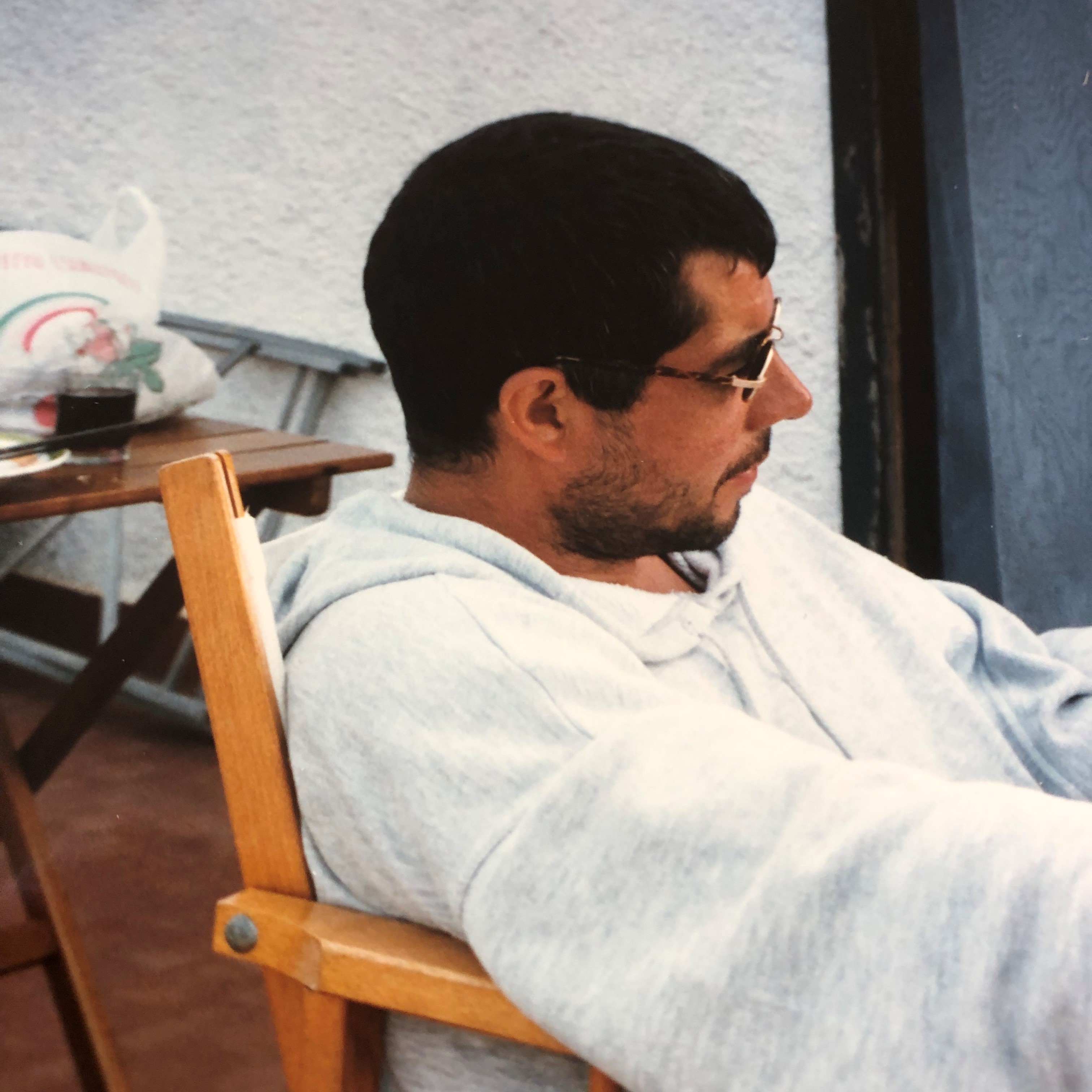
Endlich begriff Navin, dass er es mit Leuten zu tun hatte, die schlechter als er in dem Spiel waren, dass sie vorgeschlagen hatten.
mehr

Auf eine tyrannische Weise wohltuend erscheint Veronika heute Morgen die kalte Dusche, die sie sich vor ein paar Wochen erstmals verordnet - und sich nun doch erst zum dritten Mal zugemutet hat. Die schwache Bereitschaft zur Überschreitung ihrer Komfortzone wertet die promovierte Archäologin als Menetekel. Sie erkennt Vorboten künftiger Schwächen; herbei befürchtete apokalyptische Reiterinnen am Existenzhorizont.
mehr
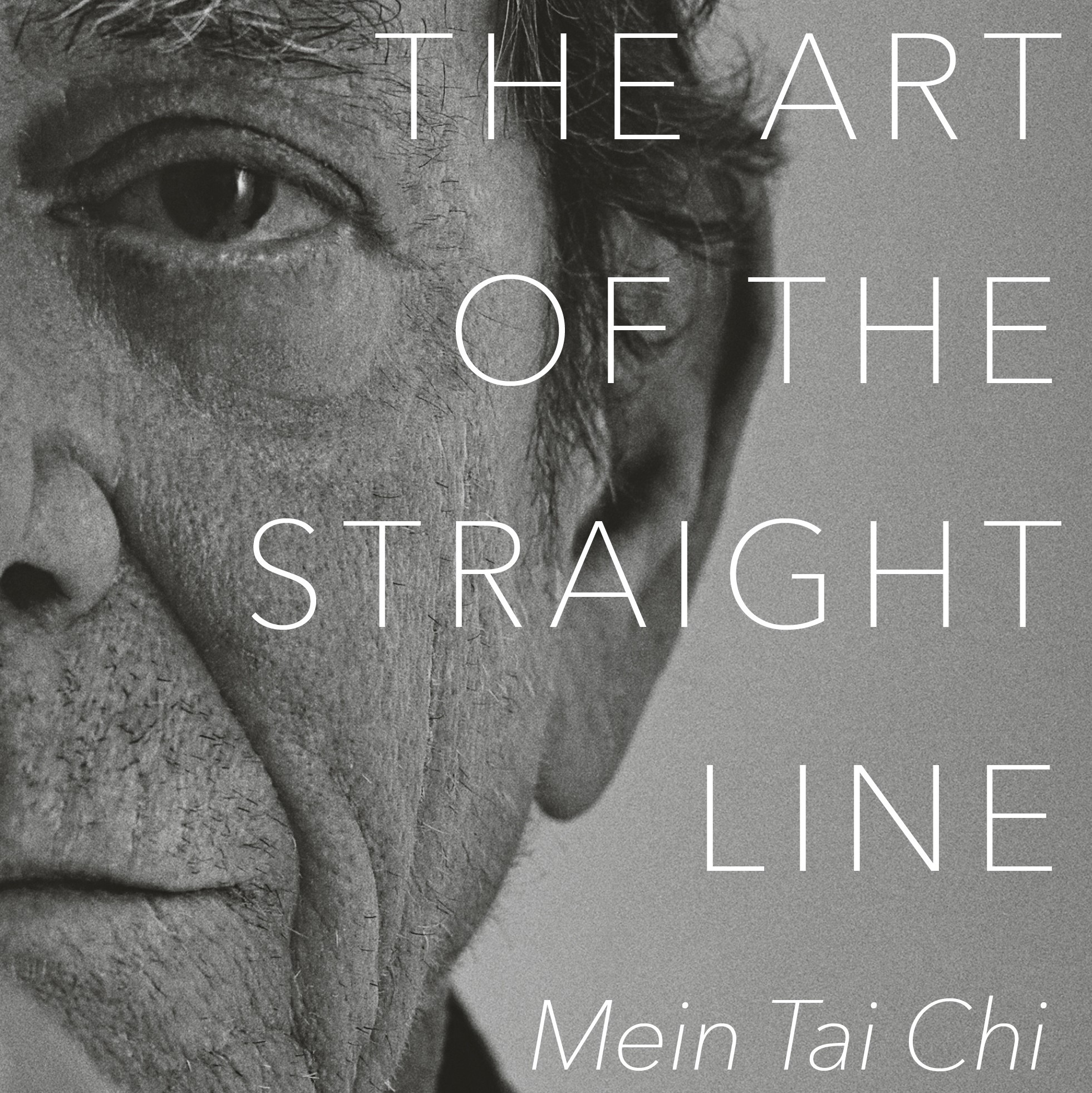
„Die Kultur von Tai Chi ist … ein riesiger Entwurf des Lebens. Lou (Reed) war imstande, sich innerlich damit zu verbinden.“ Chen Bing, Tai Chi-Meister
mehr
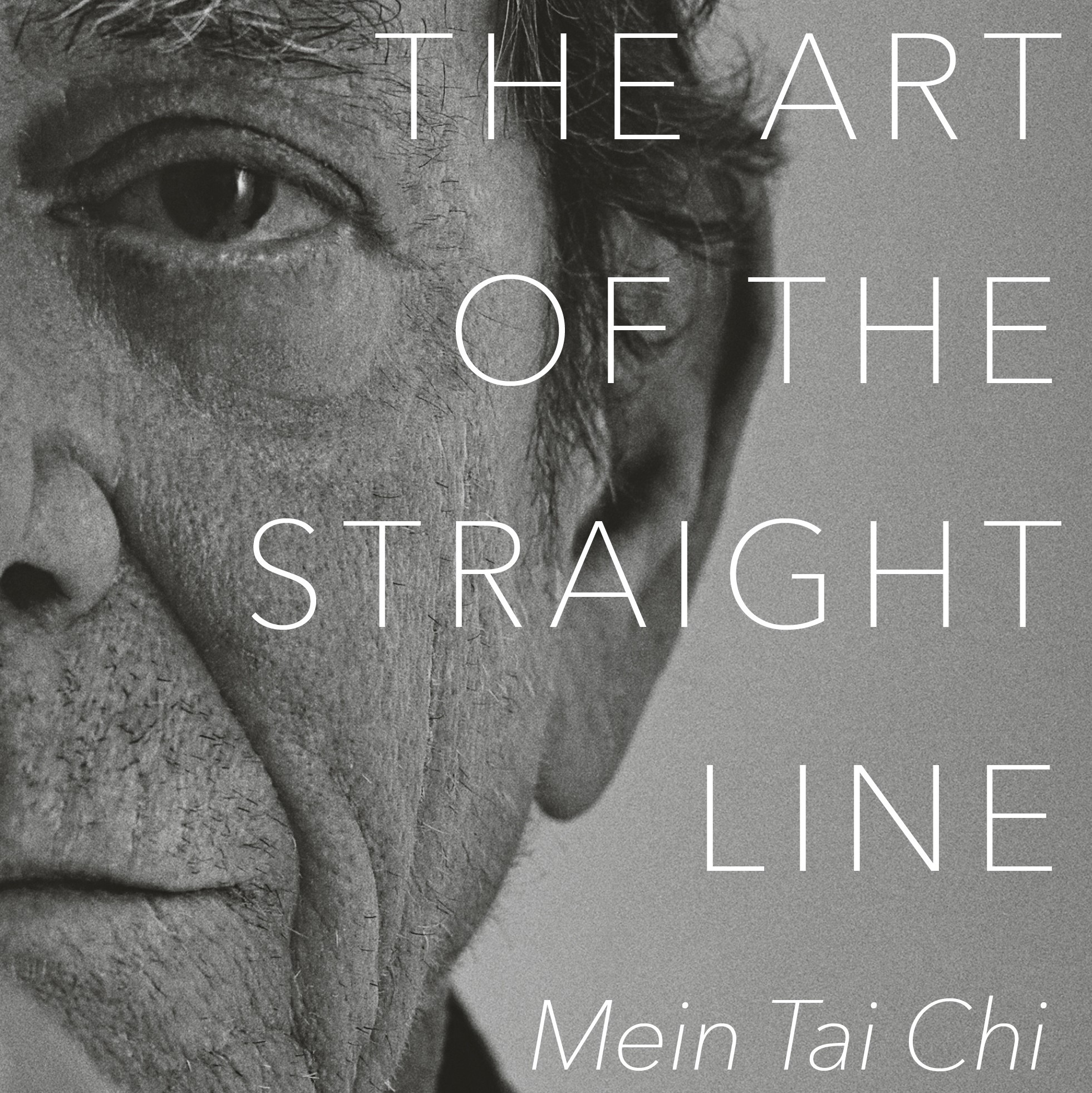
„Von dem Moment an, als ich Meister Ren Fajin machen sah, dachte ich: das werde ich ewig studieren.“ Lou Reed
mehr
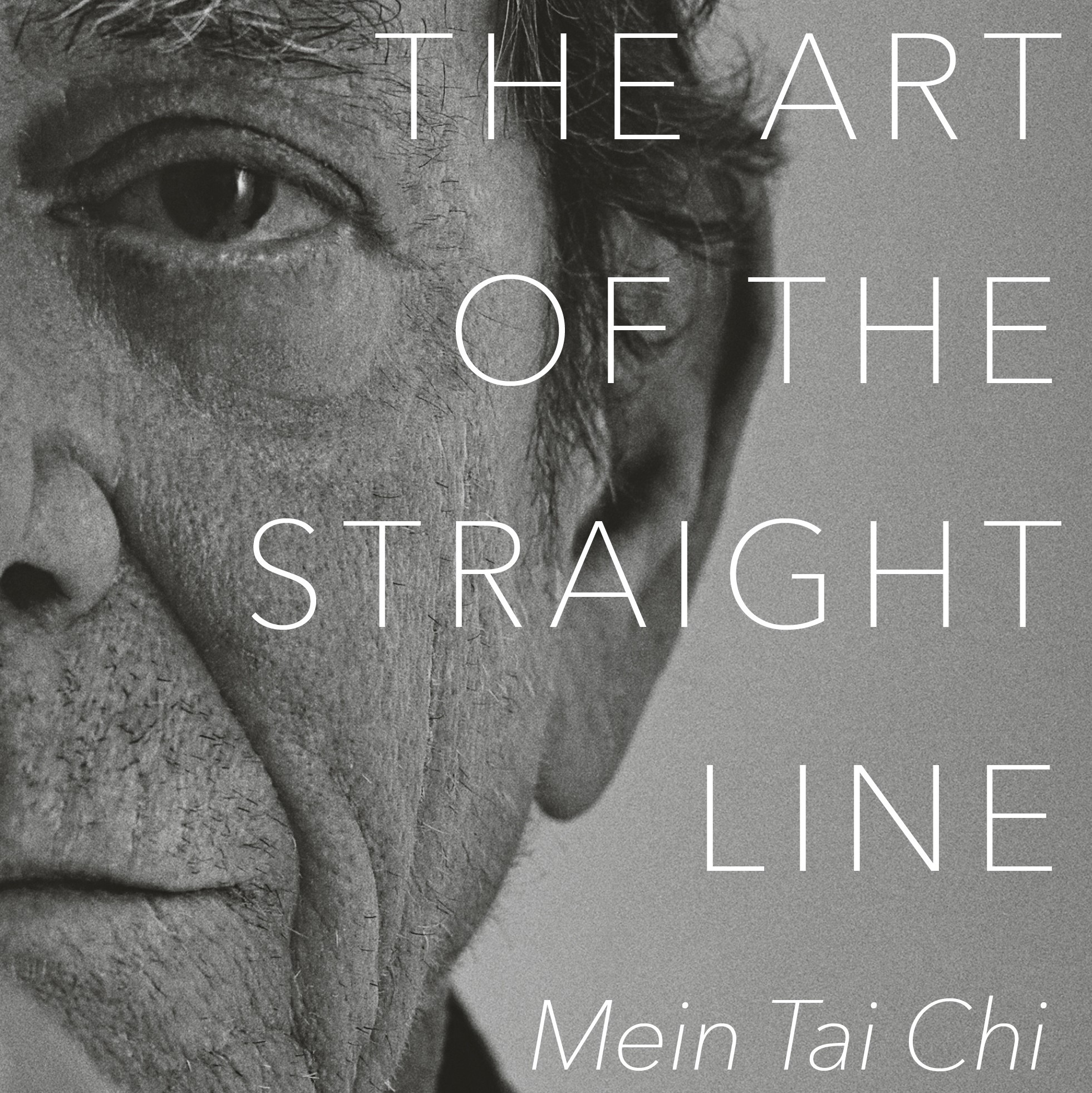
“(Lou Reed) nahm täglich (Tai Chi-)Stunden … Jeden Tag lernte er etwas Neues … ihm ging ständig ein Licht auf.“ Daniel Richman, Arzt
mehr
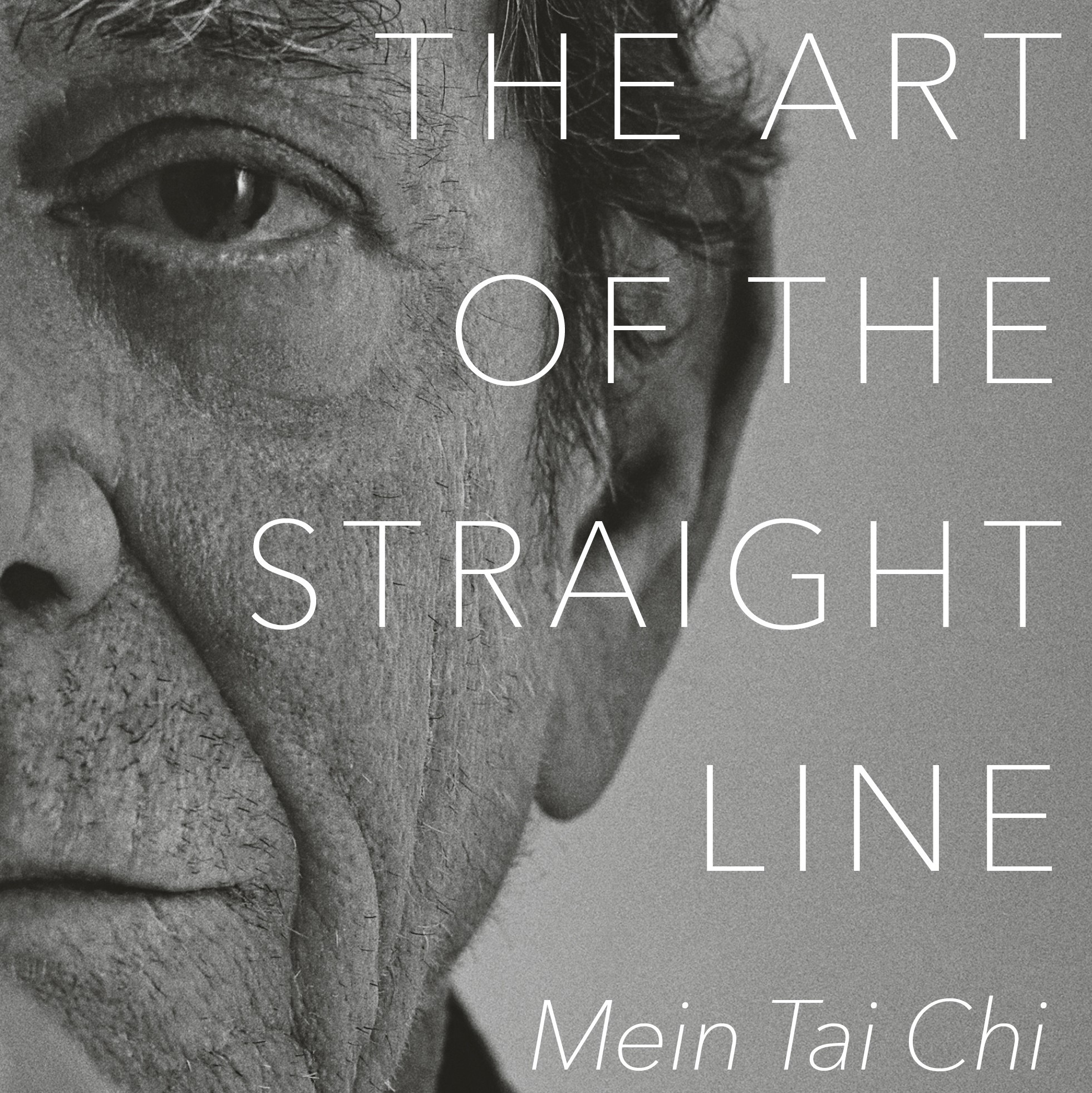
„Das Einzige, was ich nicht tun durfte, war Meister Ren (Lou Reeds Tai Chi-Lehrer) aus Lous Kalender zu streichen. Tai Chi fand jeden Tag statt. Von Montag bis Montag. … Lou sagte: Das ist das Wichtigste. Das muss ich tun. Das ist mein Leben.‘“ Elis Costa, Lou Reeds persönliche Assistentin in den 2000ern
mehr
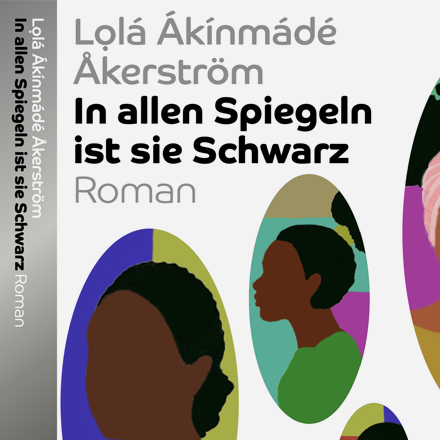
Auf der Modedesignschule stach Brittany als Schönheit heraus. Ein Textildesignlehrer erklärte sich zu ihrem Manager. Er verführte die in Atlanta, Georgia, geborene Tochter jamaikanischer Migrant:innen nicht nur zum Modeln. Nach einer nie richtig in Gang gekommenen Laufstegkarriere fand Brittany ihr Auskommen als Flugbegleiterin. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsanwalt und Ex-Basketballer Jamal lebte Brittany in Alexandria, Virginia, bis der Wirtschaftskapitän Jonny das Ex-Model in seinen Bann zog.
mehr
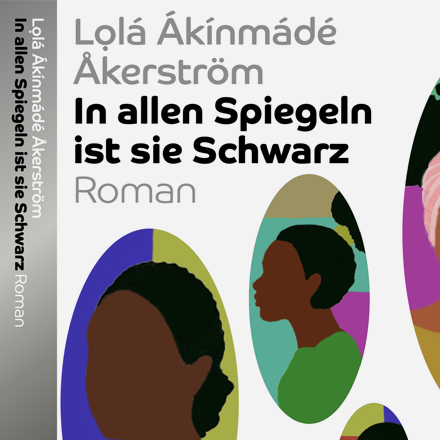
Auf den ersten Blick übersehbar ist die White-Supremacy-Komponente eines subtil gefilterten Rassismus. Ein Codewort lautet nordisch. Einer nigerianischen Spitzenkraft fehlt angeblich die Kompetenz für das Nordische. Das behauptet nicht nur der Tycoon Jonny, der mit seinen Angestellten wie mit Kegeln spielt, sondern auch sein engster Vertrauter. Ragnar personifiziert den Übergriff. Er verkörpert einen Dominanzanspruch, der jede Konstellation auflädt, an der er beteiligt ist.
mehr
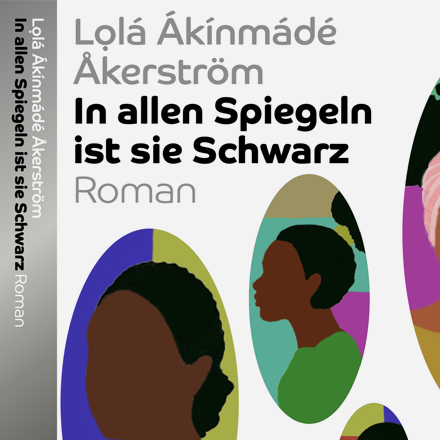
Johan ‚Jonny‘ Lundin ist ein Produkt alten Geldes, sein Familienname ein skandinavischer Türöffner. Die Lundin-Dynastie hütet einen privilegierten Zugang zum schwedischen Königshaus. Von jeher engagiert sie sich philanthropisch. Sie fördert die Kultur ihres Landes in einer transgenerationalen Weitergabe des Verantwortungsstabes. Sie ist lange genug reich, um Maßstäbe für Diskretion und Gediegenheit zu setzen. Ihre Distinktionsmarken sind Muster der Dezenz.
mehr
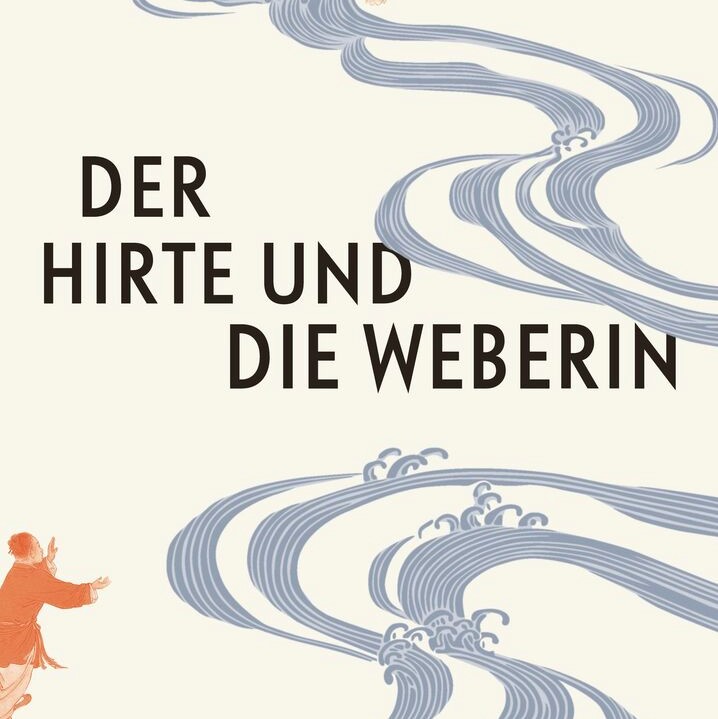
Im Januar 1938 erhält der konspirative Kader Nju-Lang von der Komintern den ehrenvollen Auftrag, ein Buch über das Sowjettheater zu schreiben. Eine Hospitanz am Stanislawski-Theater gewährt ihm privilegierte Einblicke. Nju-Lang erklärt sich Hanna. Eine arrangierte, inzwischen aufgelöste Ehe machte ihn zum Vater eines Sohns. Als Mitglied der KPCh gehorcht er Parteibefehlen. Seine erste europäische Station war Paris.
mehr
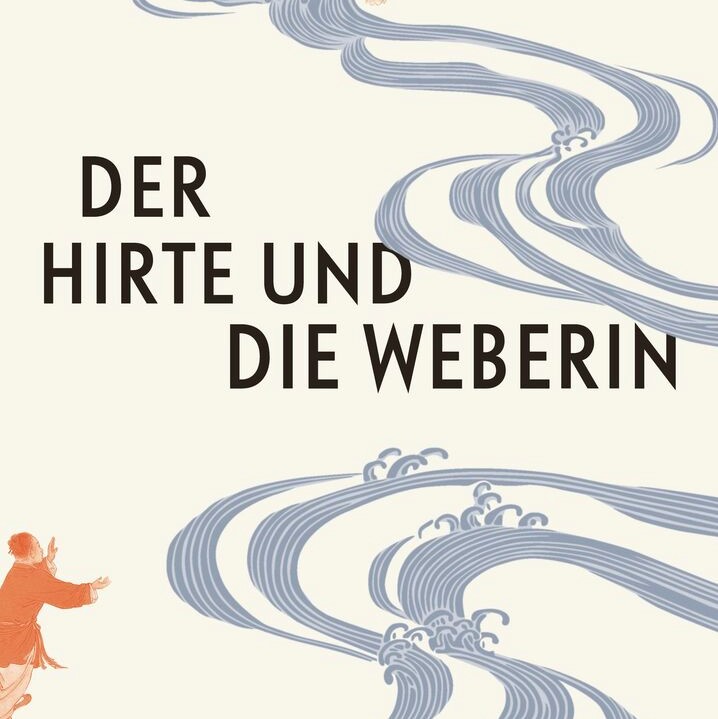
„In der Menschheit … sind Möglichkeiten verborgen … die niemand ohne Liebe erraten kann.“
mehr
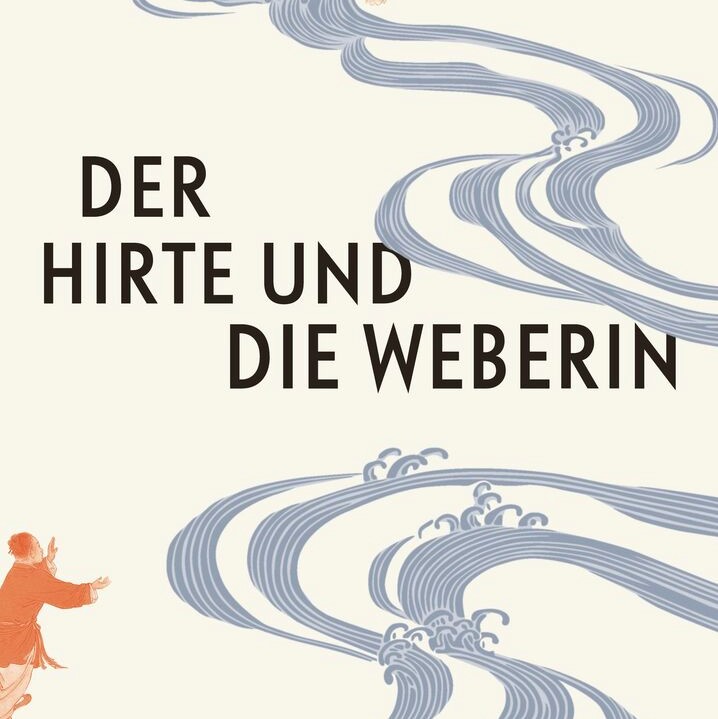
„Der chinesische Bauer blickt selbstbewusst zum Himmel auf, nennt die Milchstraße den Silberstrom und hält sie für eine Fortsetzung des Hoang-Ho, an dessen Ufern sein Dörfchen liegt.“
mehr

So ging das den ganzen Abend. Ich wusste was, Heinz wusste es besser. Selbst da, wo ich zuhause bin, überblickte er die Kontinente. Das Einzige, was Heinz wirklich wurmte, so kurz vor dem nächsten Frühjahr, war der „lieblose Zustand“ der Hecken vor dem ehemaligen Gaswerk an der Danziger Straße. Die wären unter Honecker mit größerer Sorgfalt gestutzt worden.
mehr
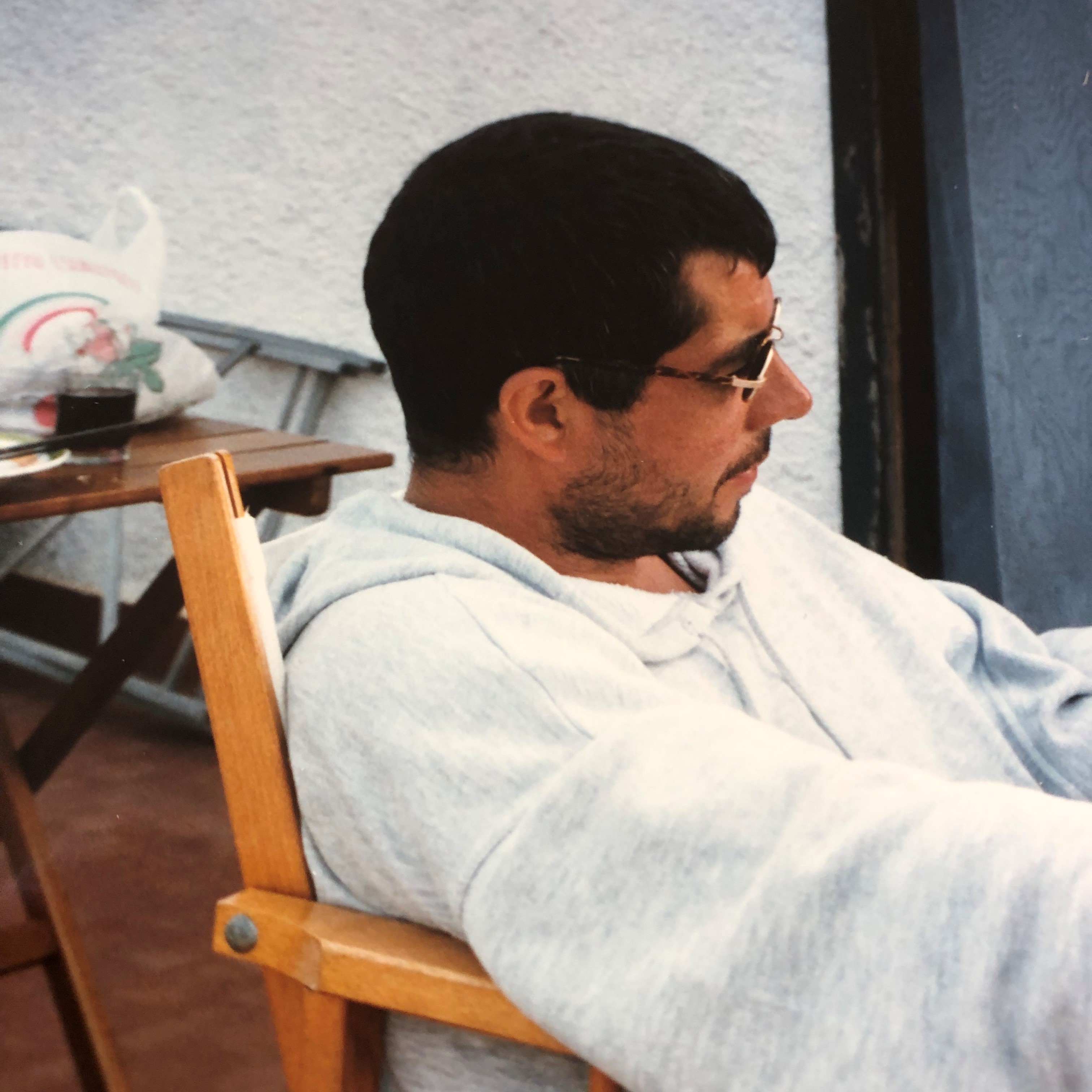
Heinz kreuzte die Arme wie ein Ringer. Er ließ keinen Zweifel daran zu, dass er mit sich im Reinen war.
„Ich war Offizier der Staatssicherheit.“
Die Sieger:innen der Geschichte hielt er für vorläufig, Heinz zitierte Fatzer: „Von nun an und für eine lange Zeit wird es auf dieser Welt keine Sieger mehr geben.“
Ich half mit Heiner Müller aus: „Das Scheitern, das den Siegern bevorsteht.“
mehr

Gletscherschmelzen treiben Pandemien an. Achtundzwanzig bis eben unbekannte Virus-Gruppen fanden Wissenschaftler:innen im Tauwasser. Dazu kommen steinalte Spielarten von Pocken, Spanischer Grippe und Beulenpest.
mehr
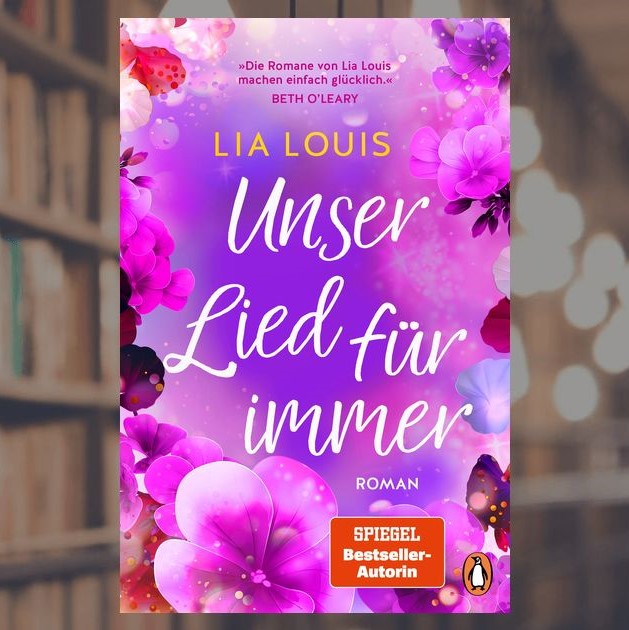
Regelmäßig setzt sich Natalie an ein öffentliches Klavier, das in einem Bahnhof steht. Eines Tages findet sie da die Noten ihres Lieblingsliedes - Fast Car von Tracy Chapman.
mehr
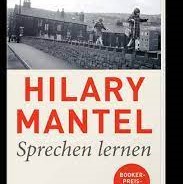
„Meine frühe Welt war synästhetisch, und ich werde von den Geistern meiner eigenen Sinneseindrücke verfolgt; sobald ich zu schreiben beginne, tauchen sie auf und erbeben zwischen den Zeilen.“
mehr

„Es gibt Schlimmeres (als Blut an den Händen)“, fand Harry Truman, nachdem er - unangenehm berührt - zum Zeugen eines seelischen Aufbruchs seines Chefatomphysikers Robert Oppenheimer geworden war. Seinem Kammerdiener (im Rang eines Staatssekretärs) Dean Acheson befahl er, ihm „dieses Individuum“ fortan vom Hals zu halten. Schließlich habe der Wissenschaftler lediglich das Ding gebaut. „Ich (Truman) habe sie explodieren lassen.“
mehr

„Bertolt Brecht und Caspar Neher haben einen ganz eigenen Darstellungsstil geschaffen, dessen Hauptmerkmal im Verzicht auf Illusionswirkung besteht. Es soll nichts vorgetäuscht werden.“ Walter Becherer 1948
mehr

„(Im Berliner Ensemble) herrscht … das Bemühen, vollständig natürlich zu sprechen, nicht mehr zu geben, als man hat, nicht den Eindruck zu erwecken, man habe mehr, als man hat, sondern eben in der natürlichsten und einfachsten Weise die Texte der Dichtungen zu gestalten.“ Bertolt Brecht im Gespräch mit Maximilian Scheer am 22. Dezember 1951; im Beisein von Käthe Rülicke, Wera geb. Skupin, verh. Küchenmeister, Peter Palitzsch, Lothar Creutz und Egon Monk
mehr

„Aber ich glaube, dass nirgends so wenig Theorie getrieben wird wie gerade bei uns im Berliner Ensemble, weder während der Proben noch während unserer Diskussionen, sondern bei uns wird einfach praktisch gearbeitet.“ Käthe Rülicke
mehr

Brechts Kampf gegen den Faschismus macht ihn zur Jahrhundertfigur. Die amerikanische Journalistin Anne Hornemann deutete Brecht 1945 als Leitstern der Emigration: „Eine künstlerische Flamme, die der Hitlerismus nicht ersticken konnte.“
mehr

Am Donnerstag, den 13. November 1823 traf Johann Peter Eckermann Goethes langjährigen Kammerdiener vor Weimar auf der Straße nach Erfurt. Obwohl der Chronist den Namen verschweigt, kann kein Zweifel daran bestehen, dass Eckermann dem geschäftstüchtigen und umtriebigen, von Goethe mit Wohlwollen bedachten Christoph Sutor (1776 - 1795) begegnete. Der Erfurter Bäckersohn machte etwas aus sich und starb nobilitiert als Weimarer Ratsdeputierter.
mehr

„Als Brecht den Physiker Leopold Infeld, ehemaliger Mitarbeiter Albert Einsteins, im Mai 1955 in Warschau traf, warnte ihn dieser: ‚Einstein ist nichts fürs Drama, er hat keinen Partner, mit wem wollen Sie ihn reden lassen?‘“
mehr

„Der Kampf der fortschrittlichen Kunst - also auch des Theaters - muss zuerst gegen die Dummheit geführt werden.“ Bertolt Brecht 1945
mehr

„Für Brecht ist Kultur nur lebendig, wenn sie wie ein Löwe für ihre Rechte kämpft.“ Sten Hellsten
mehr

„Es gibt … Bevölkerungsschichten, die ein ungeheuer praktisches Interesse am Lernen haben, aber unzufrieden mit den aktuellen Bedingungen sind. Die sind die besten und eifrigsten Lernenden. Die Wissbegierde hängt also von mehreren Faktoren ab – aber es gibt bei all dem ein Lernen voller Freude, voller Spaß, ein militantes Lernen. Wenn es kein solches unterhaltsames Lernen gäbe, dann könnte das ganze Theater nicht lehren.“ BB
mehr

1935 besucht Brecht gemeinsam mit Margarete Steffin wieder die Sowjetunion. Der aus Magdeburg gebürtige, in die UdSSR migrierte, kurz vor seiner Verhaftung stehende, schließlich in den Gulag-Labyrinthen verschollene, 1989 rehabilitierte Schriftsteller und Funktionär Abraham Brustawitzki charakterisiert Brecht: „Ein ‚Literat bis in die Knochen, ein Intellektueller par excellence‘. (Er) sucht wie Stendhal ‚immer le mot juste‘ und ‚berechnet jede Phrase‘ … Nur ‚seine Halsstarrigkeit macht ihn manchmal einseitig‘.“
mehr

„Die Sowjetunion ist ein wunderbares Land für Lyriker. Die historisch berichtende Lyrik tritt noch (zu wenig) in den Vordergrund. In jeder Metrostation sollte in Stein (gemeißelt) ein literarischer Bericht über die Geschichte des Baues und über seine Helden zu lesen sein.“ BB 1935
mehr

„Der Fahrradkurier kennt den Surrealismus nicht, aber pfeift Mackie (Messers) Song vor sich hin.“ Jeanine Delpech
mehr

„Die Aufführung meiner Stücke konnte wohl verboten werden, aber die Polizei kann nichts Neues schaffen, und wo wir (1933) … aufhörten, werden wir (nach dem Krieg) wieder weitermachen.“ BB in einem Interview mit Henry Marx.
mehr
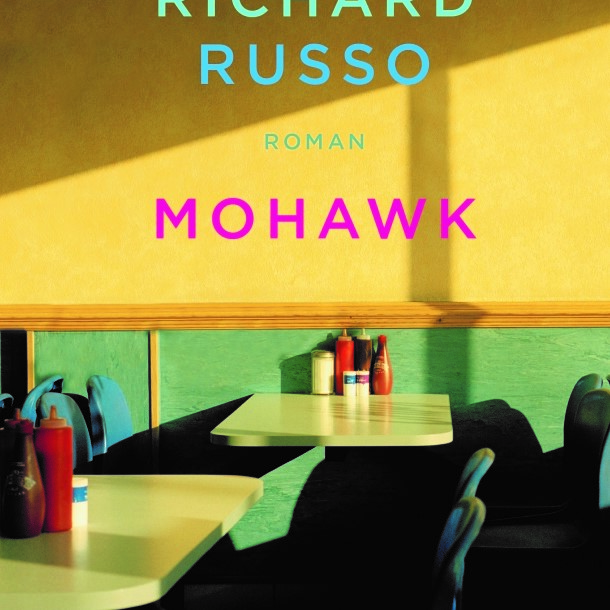
Am langen Ende des Industriezeitalters verödet auch jene Kleinstadt im New Yorker Dunstkreis, die Richard Russo zum Schauplatz seines 1986 erschienenen Romandebüts machte. In Mohawk sicherte die Lederindustrie bis zum Zweiten Weltkrieg das Auskommen vieler Arbeiter:innenfamilien. Die Eingesessenen arrangieren sich mit dem in den 1940er Jahren einsetzenden Niedergang. Sie schnallen die Gürtel enger, entschlossen die Marathondurststrecke durchzustehen. Ihr Verhalten variiert das Boiling Frog Syndrom. Sie passen sich an und harren aus.
mehr
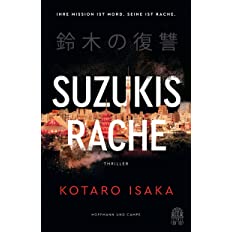
Bauchladenverkäufer machten im frühen 17. Jahrhundert den Anfang. Die Erwerbsnomaden rangierten unter den Ärmsten. Ihre Deklassierung war eine Totalität. Bis heute nennt man diese Schicht Burakumin. In der Bezeichnung erreicht die Entwürdigung ihren Gipfel.
mehr
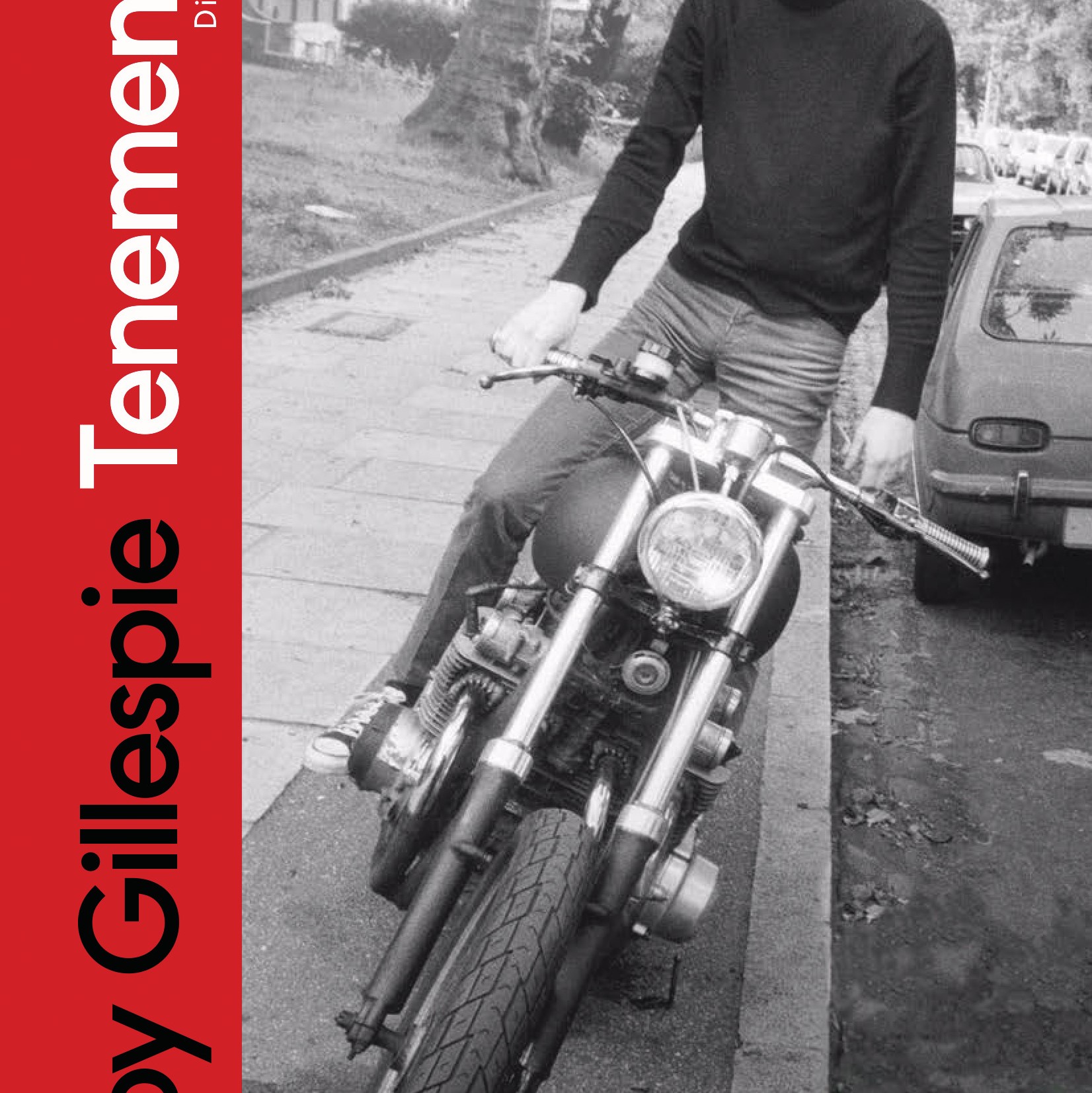
Zur Welt kommt er im historischen Stadtkern von Glasgow. Schon als Baby nimmt Bobby auf den Armen seiner aktivistischen Eltern an Demonstrationen teil. Die Mutter verfertigt Transparente an ihrer Nähmaschine. Bobby wächst in Springburn auf. In dem Arbeiterbezirk stand - bis zur Abschaffung einschlägiger Regelungen - das städtische Armenhaus (Barnhill Poorhouse). Eine „Atmosphäre von Flucht und Verlassenheit“ deprimiert die Bewohner:innen.
mehr
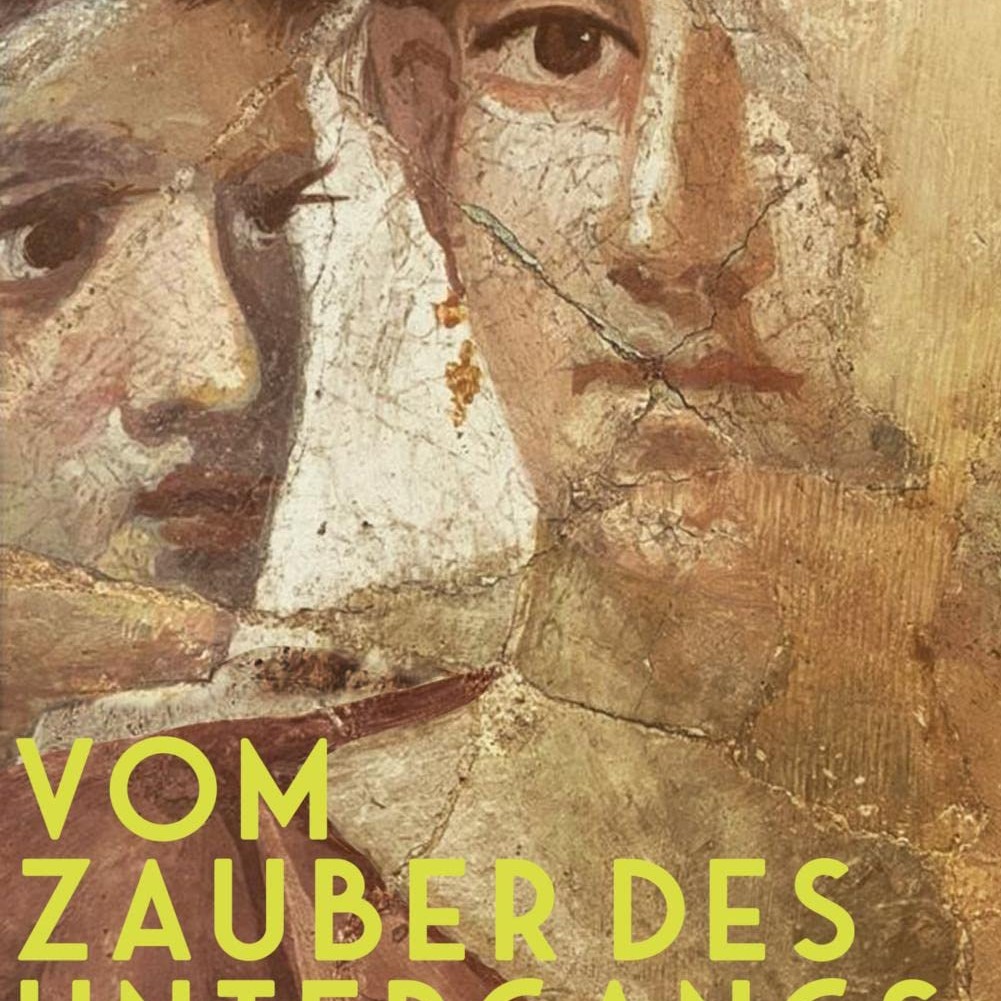
Im 19. Jahrhundert entreicherten Altertumsforscher:innen Pompeji planmäßig, um die Schätze im Nationalmuseum von Neapel zu konservieren. Zuchtriegel stellt fest, dass sie so ihrer wissenschaftlichen Sorgfaltspflicht genügten. Der Modus Operandi entsprach dem technischen Standard unter Open-Air-Bedingungen. Die Leser:innen erfahren, dass alliierte Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg Pompeji mit der Idee bombardierten, die Wehrmacht bunkere Munition in vorchristlichen Lagerräumen.
mehr
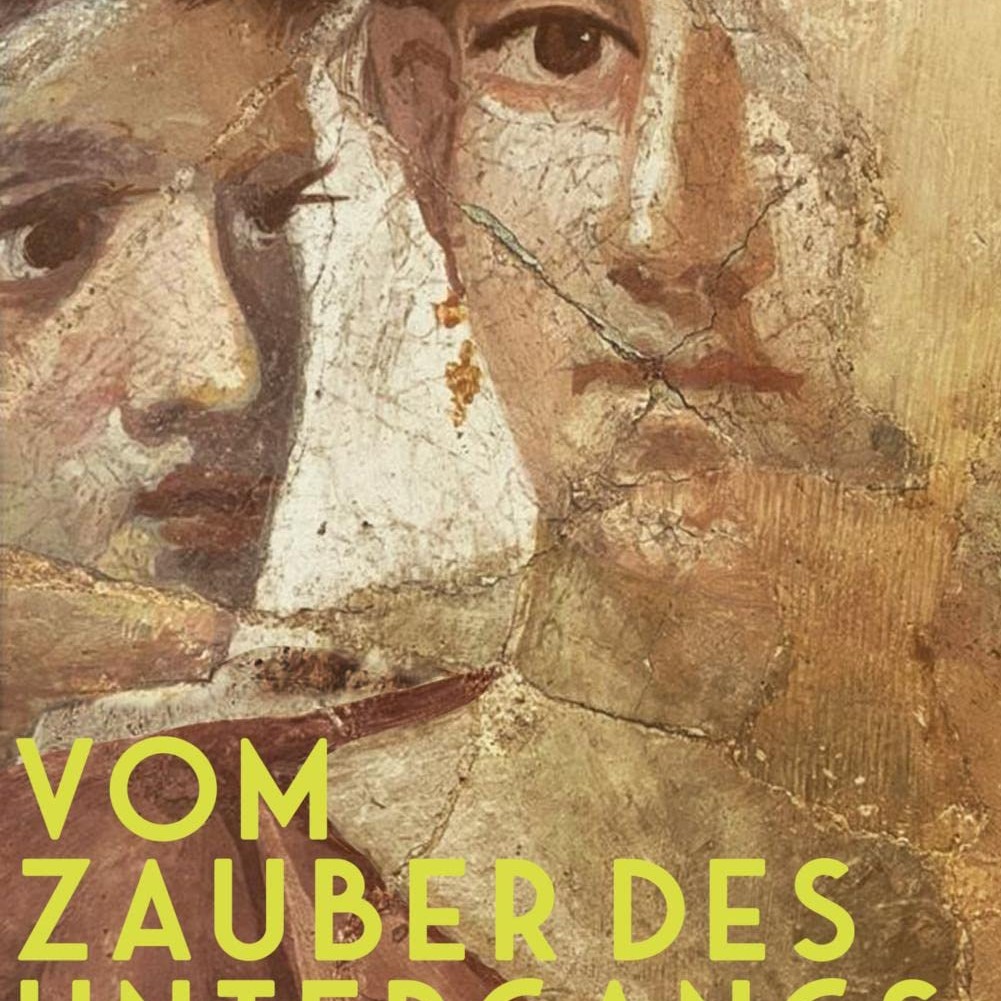
„Der Ritus ist wie eine eigene Sprache, die alle Bereiche der Gesellschaft gliedert und deren Grammatik und Vokabular untrennbar mit dem verbunden sind, was sich in dieser Gesellschaft kommunizieren lässt.“
mehr
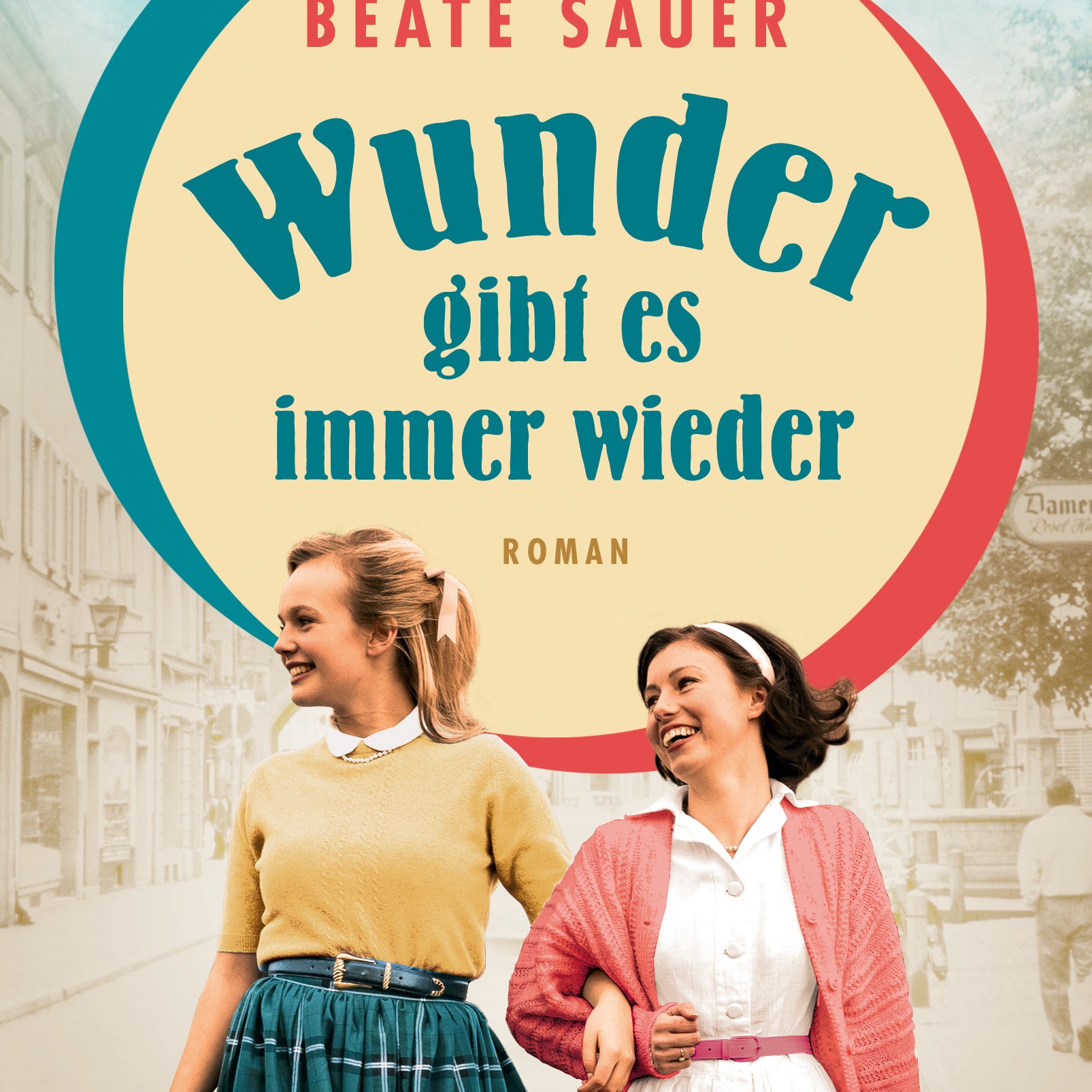
In den 1950er Jahren gibt es im Bonner Hotel Königshof „Speisekarten für Damen“. Darin werden Speisen und Getränke ohne Preisangaben offeriert. Die im Roman als Schauplatz eines Tête-à-Tête der Heldin mit ihrem Verehrer Paul Voss fungierende Spitzenherberge im Dunstkreis der rheinisch-katholischen Machtzentralen dient Adenauers Wiederaufbau-Crème de la Crème als Hort vertraulicher Begegnungen und dem Kölscher Klüngel als Refugium.
mehr
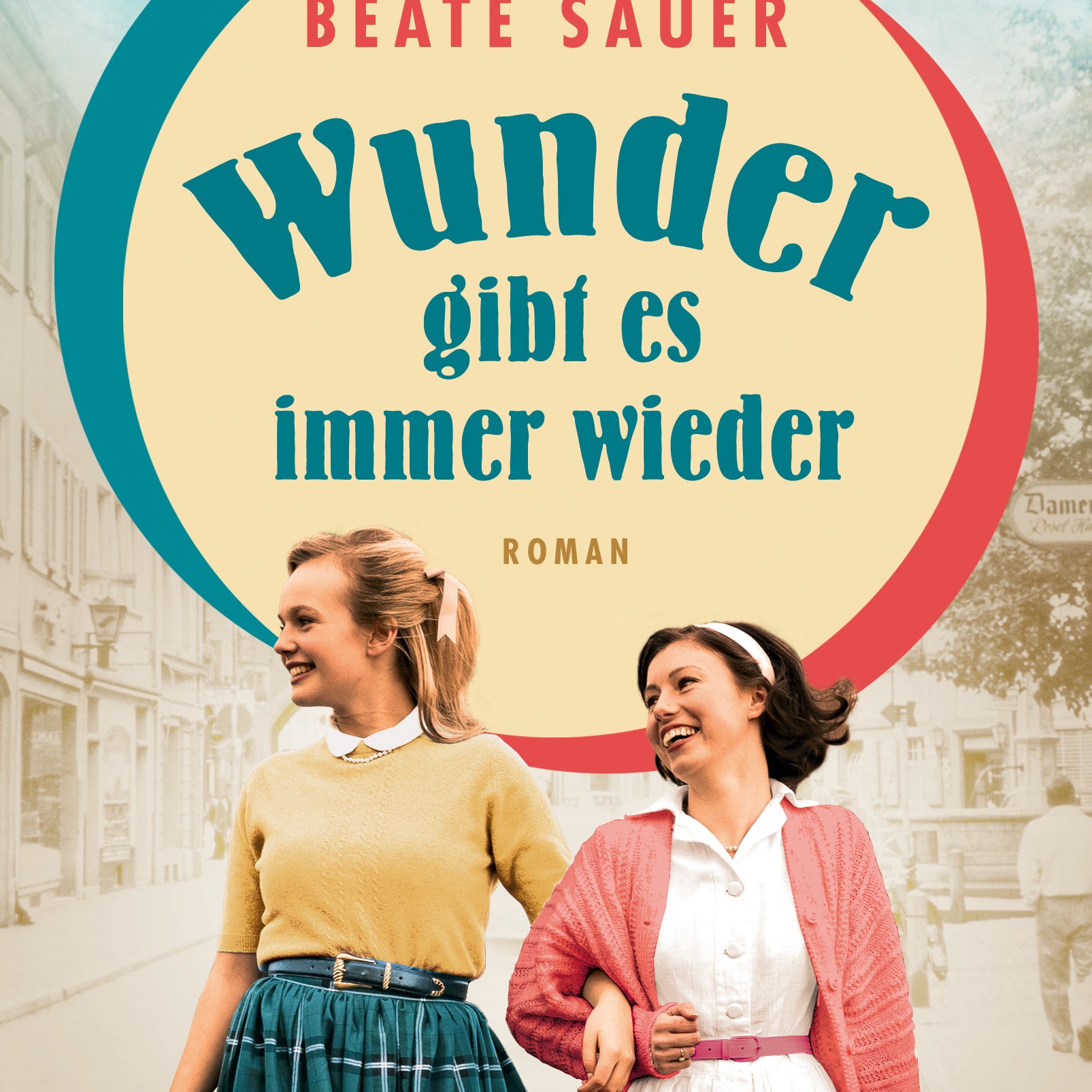
Die nationalsozialistische Ästhetik verlor in der Wirtschaftswunderrepublik ihr martialisches Kleid. Sie ging unerkannt als Unschuld vom Land und langweilte die künftigen Achtundsechziger:innen mit ihrem Kitsch. Niemand wäre damals auf die Idee gekommen, den Heimatfilm für etwas anderes als eine Reaktion auf Verluste zu halten. In Wahrheit tarnte sich der Faschismus im Heimatfilm mit Harmlosigkeitsbehauptungen. Vordergründig fehlte der NS-Bezug, wie Samuel Salzborn in seiner Analyse „Kollektive Unschuld“ feststellt.
mehr
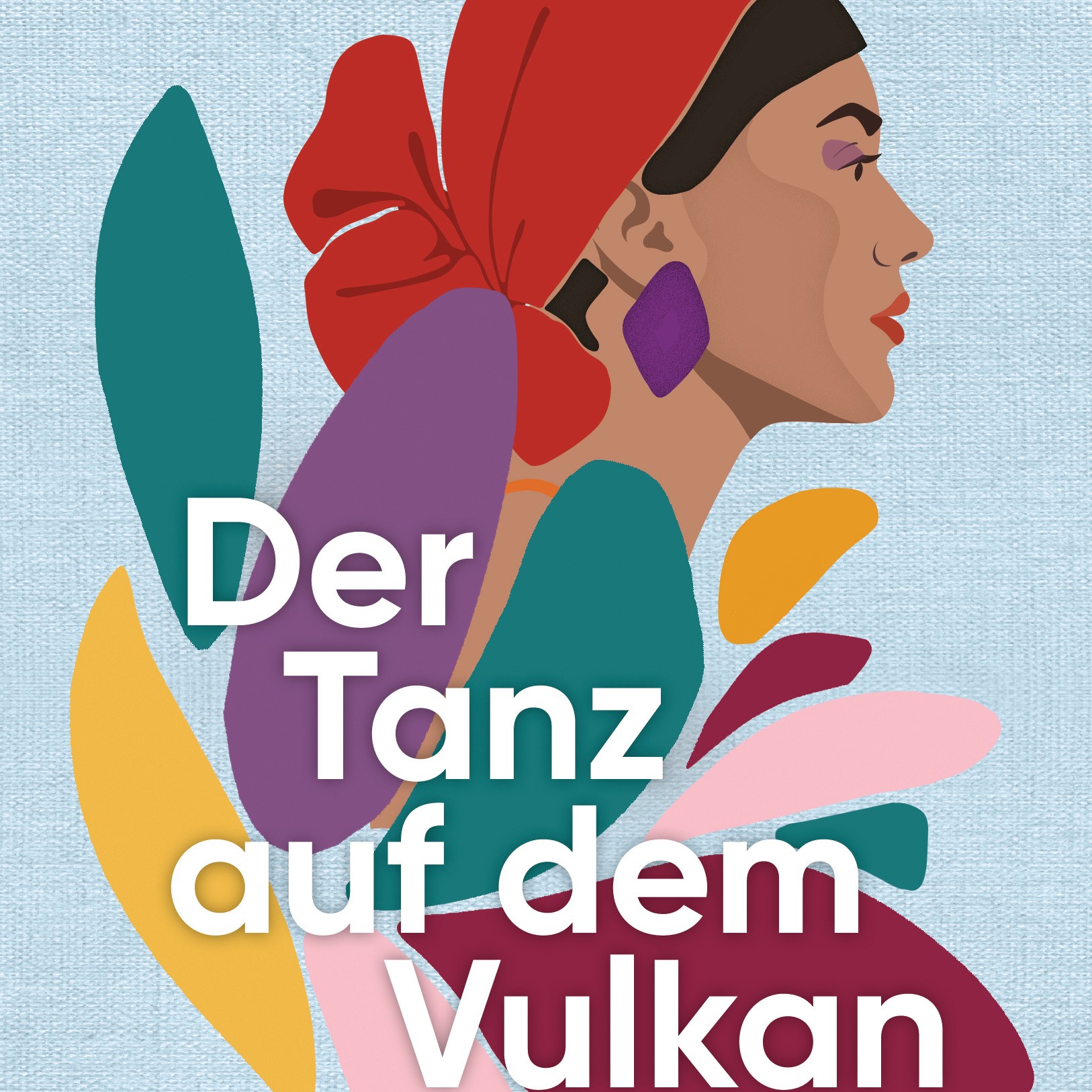
Marie Vieux-Chauvet rückt die revolutionär-karibisch brodelnden Romanereignisse in einen historisch verbürgten Rahmen. Zu den Personen der Zeitgeschichte, die in dem „Tanz auf dem Vulkan“ ihren Auftritt haben, zählt der eingewanderte Entrepreneur François Mesplés. In der 1750 gegründeten Kapitale Port-au-Prince lässt er 1777 ein Theater mit 750 Sitzplätzen erbauen und nach sich benennen - Salle Mesplés. Sein unternehmerisches Engagement trifft einen Nerv der Zeit.
mehr
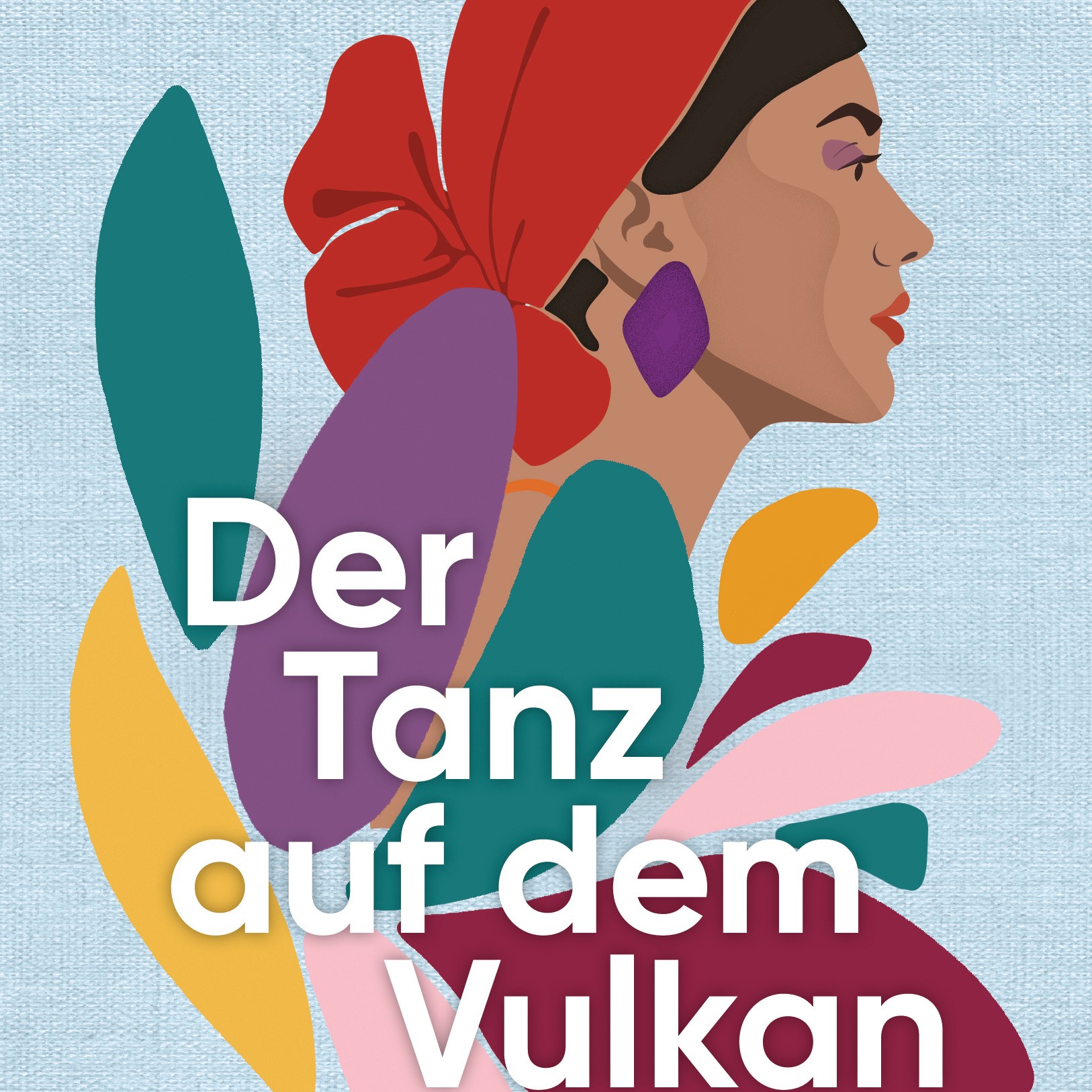
„Ihr Leben lang hatten sie ihren Unmut verheimlicht, so fiel es ihnen nicht schwer, ihren Gegnern mit gelassener Miene entgegenzutreten, während sie zugleich einen Schlachtplan entwarfen.“
mehr
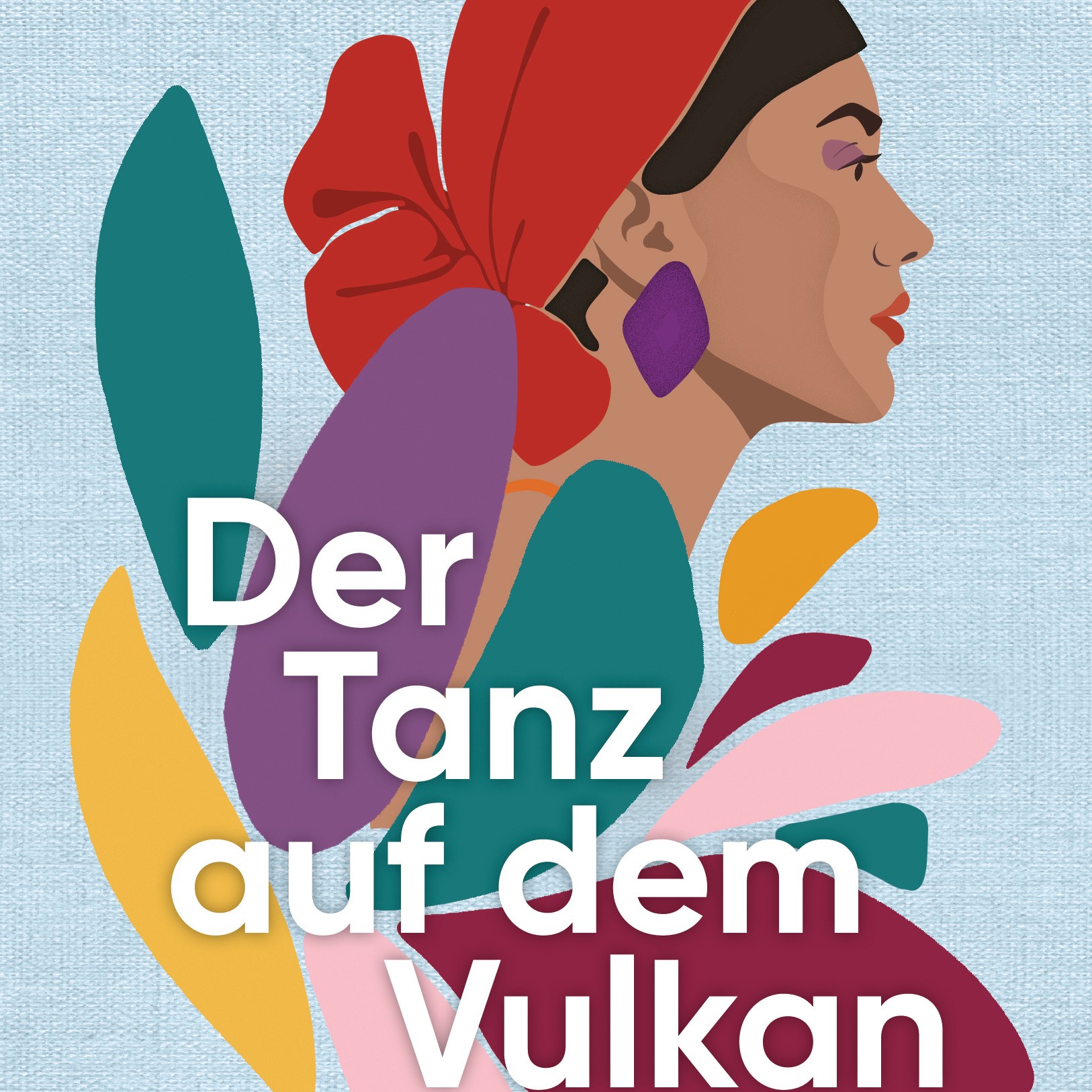
Am 1. Januar 1804 warfen die Revolutionäre von Saint-Domingue das koloniale Joch ab „und erklärten ihre Inselnation zur souveränen Republik Haiti“. Kaiama L. Glover bezeichnet in ihrem Nachwort die politische Eruption als „außerordentlichen Akt absoluter Verweigerung“. Daraus ergab sich die „erste erfolgreiche Sklavenrevolution der Welt, (der erste) unabhängige Staat der Karibik und (die erste) Schwarze Republik des amerikanischen Kontinents“.
mehr
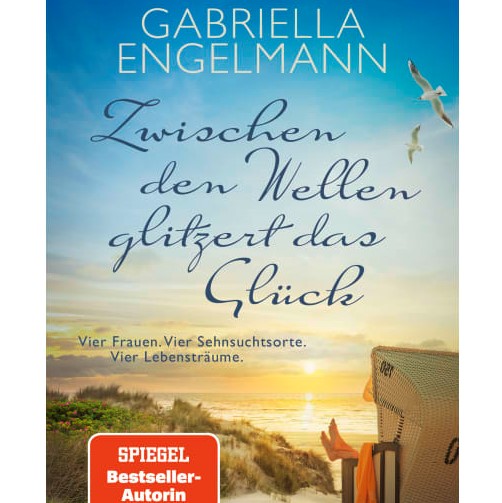
Alles könnte so schön sein, wäre da nicht eine plötzlich aufgetretene Schreibblockade, die Caro aus der Bahn zu werfen droht. Die Autorin ist im Verzug. Die Programmleiterin hat sie bereits ins Gebet genommen. Außerdem braucht Caro eine neue Bleibe ausgerechnet im teuren Hamburg. Dazu kommen Liebeskummer - und Kummerspeck in der Konsequenz zu vieler Tröstungen mit Röstaromen.
mehr
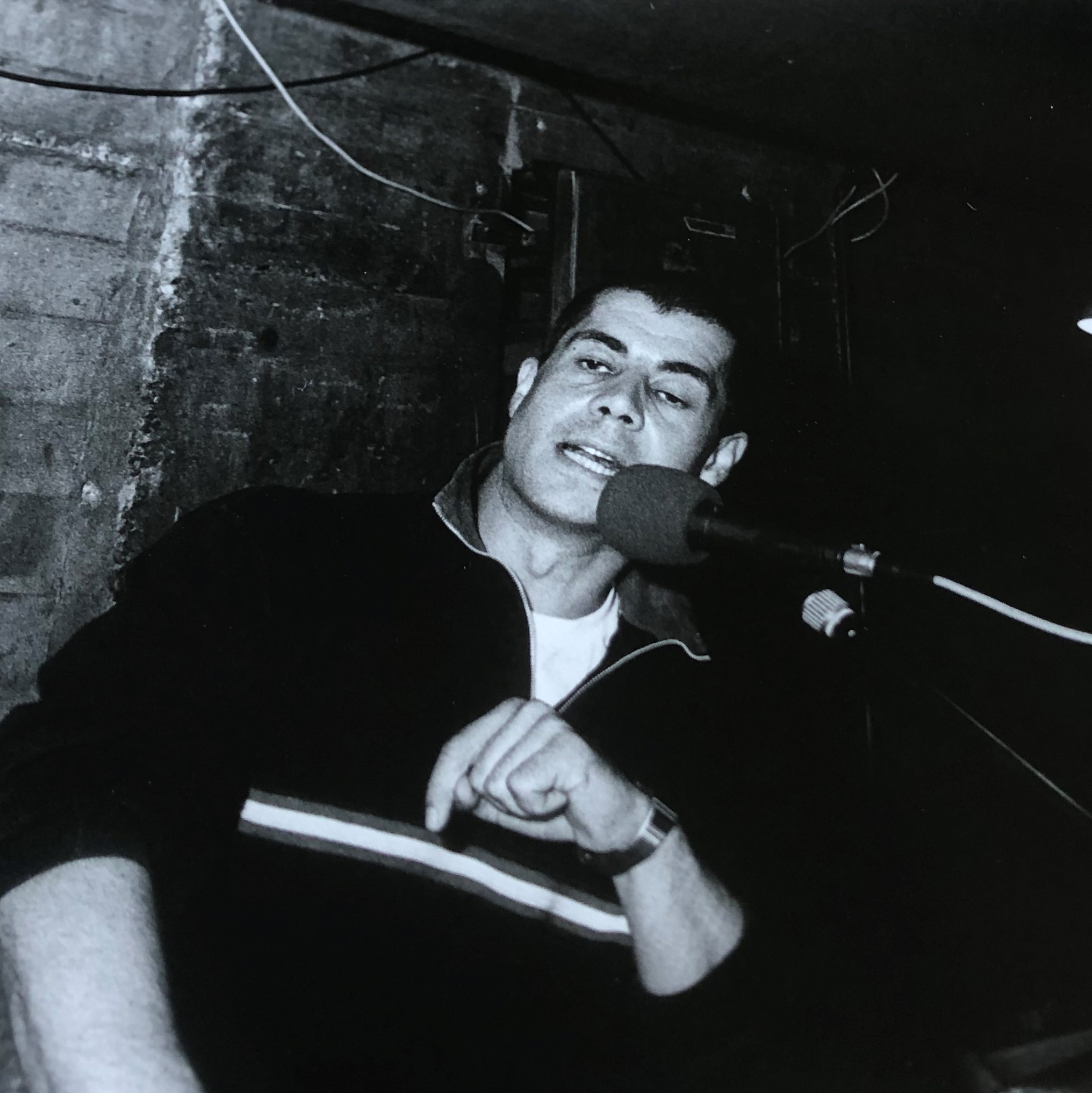
Der unfruchtbare Kardiologe Tayfun Yıldız, eine Koryphäe mit internationalem Ruf, bedacht mit Dankesbriefen aus aller Welt, sieht seiner Stieftochter wunschgemäß nicht so unähnlich, dass ihre außereheliche Herkunft offensichtlich wäre.
mehr

In the first evolutionary cycle is no right to spare. If you're too slow, that's your problem. What does this lead to? It causes you to be faster and stronger at sixty than you were at thirty.
mehr
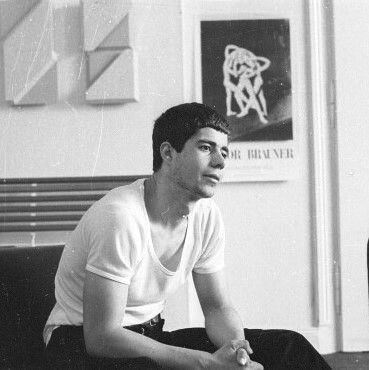
As soon as you come into contact with superpower, everything is like in 'The Da Vinci Code'.
mehr

Space gives you time. Time gives you space. If I take the space for myself in a fight to be closer to the enemy, I have to ask myself whether I am not stealing my time advantages.
mehr
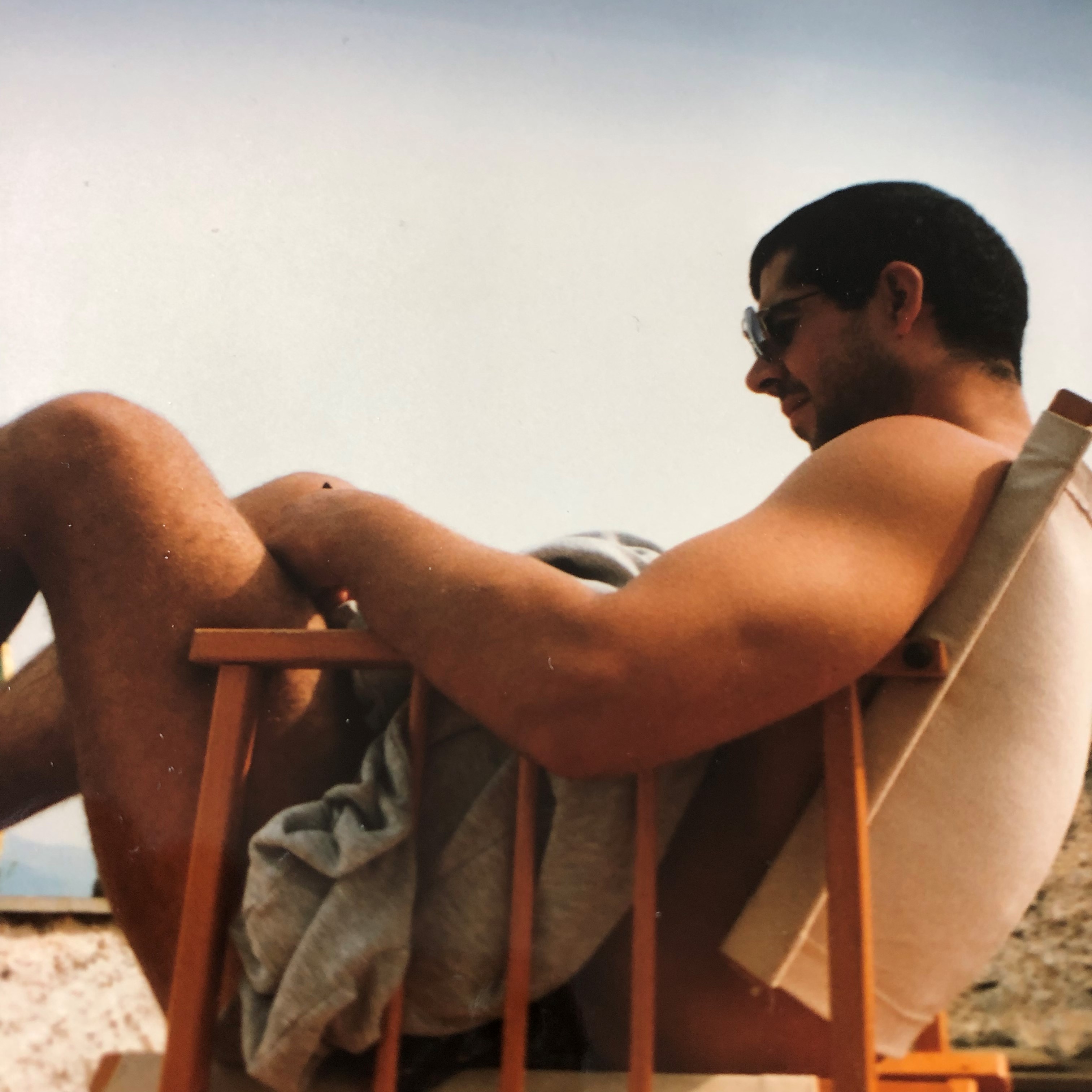
The most elementary evolutionary mechanism runs out in a dualism of pressure and adaptation. In the first evolutionary cycle there is no difference between enemy and opportunity.
mehr
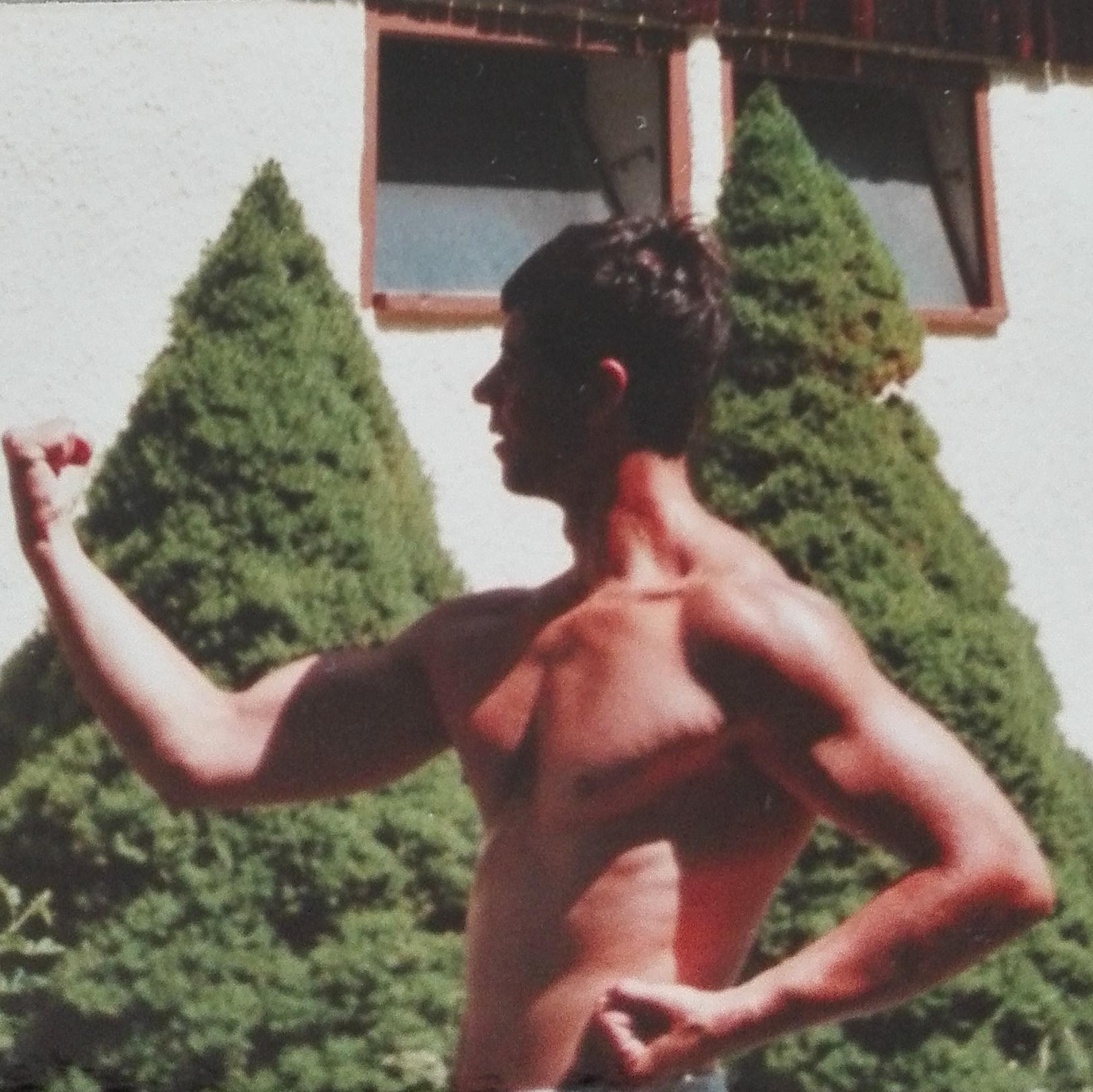
Boxing was developed in the fencing schools. That's why it's so effective. The deadly core is still in the art.
mehr

An jedem Familienast schwingen Gymnastinnen, Esoterikerinnen, pietistische Protestantinnen und Naturheilkoryphäen. Die Verwandten initiieren Navin mit einem Mix aus bodenständigem Materialismus (alle leben im Eigentum; zur Miete wohnt man nicht; das ist anrüchig) und einer jenseitigen Klopfzeichenkunde.
mehr
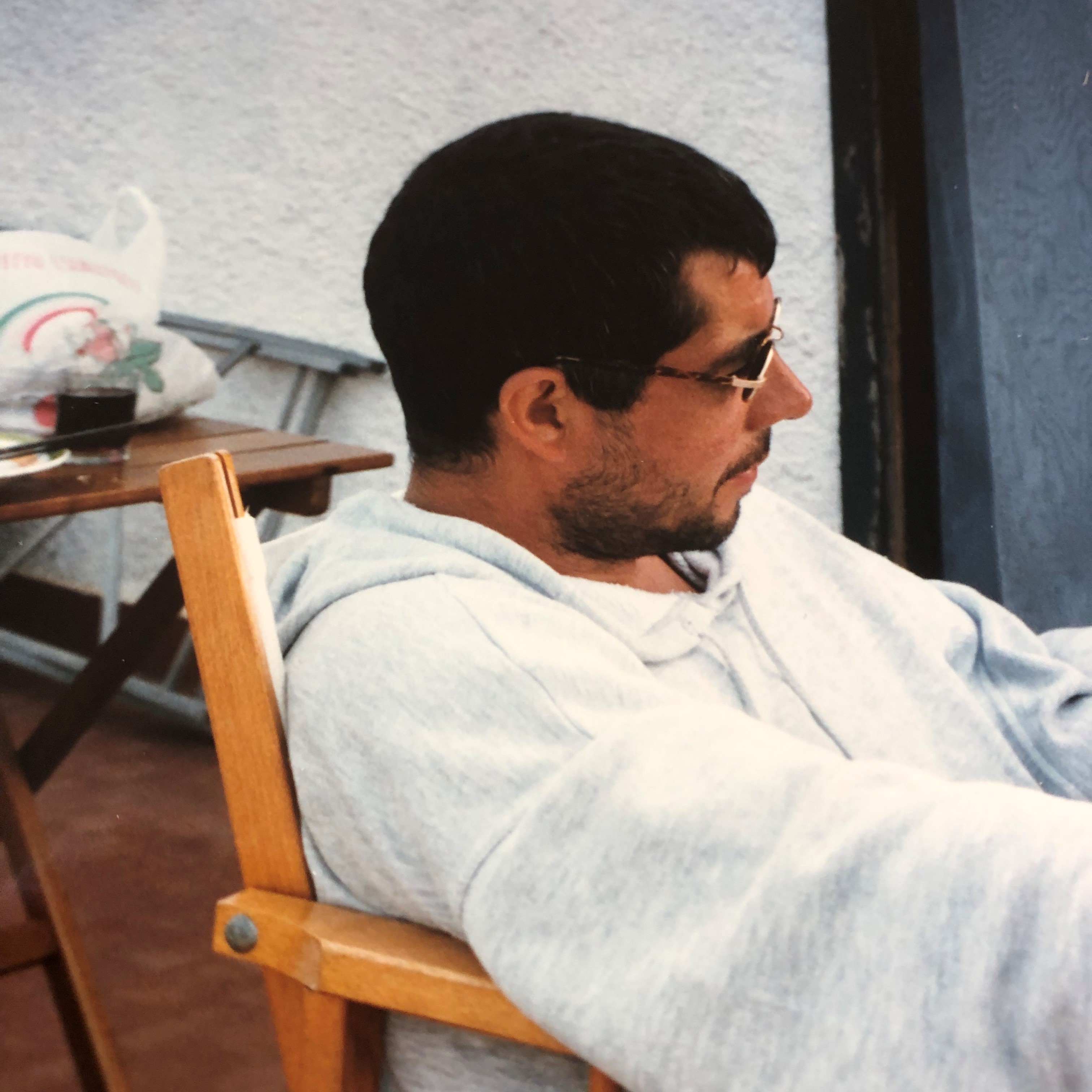
Anton trifft eine Serie glücklicher Entscheidungen. Für seine Treffsicherheit sucht er eigenwillig-esoterische Begründungen. Er beruft sich auf das Tibetische Totenbuch und die ägyptische Mythologie. Vorbildlich findet er Sven Hedin, Thor Heyerdahl, Peter Scholl-Latour, C. W. Ceram, Werner Höfer, Jacques-Yves Cousteau, Heinrich Harrer, Luis Trenker und den normannischen Kleiderschrank Curt Jürgens.
mehr
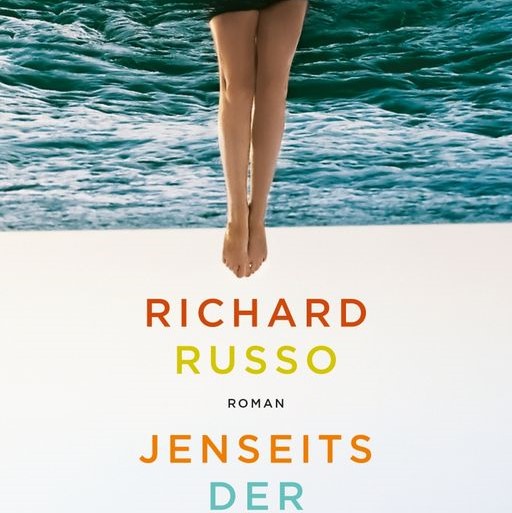
Sie sind Außenseiter unter den höheren Töchtern im piekfeinen Minerva College. Teddy Novak, Mickey Giradi und Lincoln Moser bilden die akademische Unterschicht in einer Edelbildungsstätte im US-Bundesstaat Connecticut. Sie jobben da, wo andere ihre Privilegien genießen. Teddy und Lincoln bedienen ihre Kommilitoninnen in einem Verbindungshaus, das sie nur durch den Hintereingang betreten dürfen. Mickey putzt lieber Töpfe in der Küche. Der bullige Zweimetermann ...
mehr
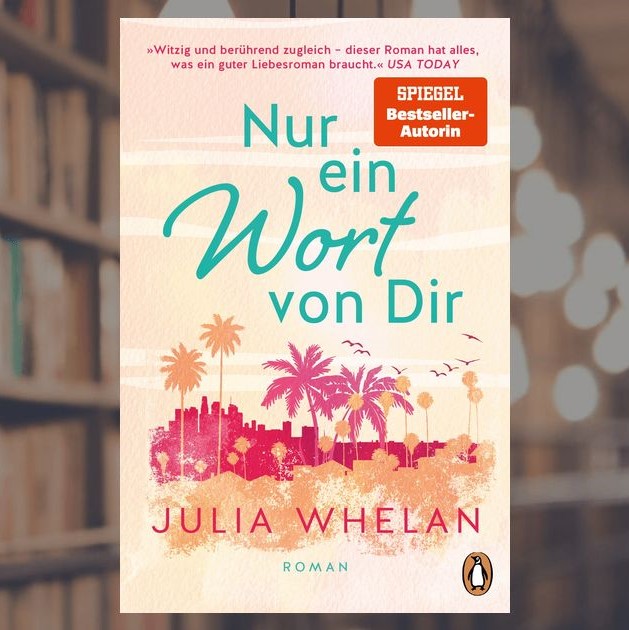
Auf einem Flug nach Las Vegas unterbricht die Neugier der fast fünfjährigen Hannah Sewanee Chesters professionelles Abhören eines Tonträgers. Die nach einem Unfall gehandikapte Hörbuchsprecherin muss sich von Hannah eine unverfrorene Bemerkung zu ihrer Augenklappe gefallen lassen. Mit Mühe beamt sich Sewanee auf ihre private Raumstation zurück.
mehr
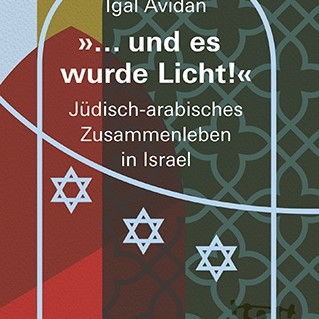
Zwischen Topografie und Ethnologie: Igal Avidan ergründet Voraussetzungen für spannungsarme, beide Seiten befruchtende jüdisch-arabische Stadtgesellschaften in Israel.
mehr
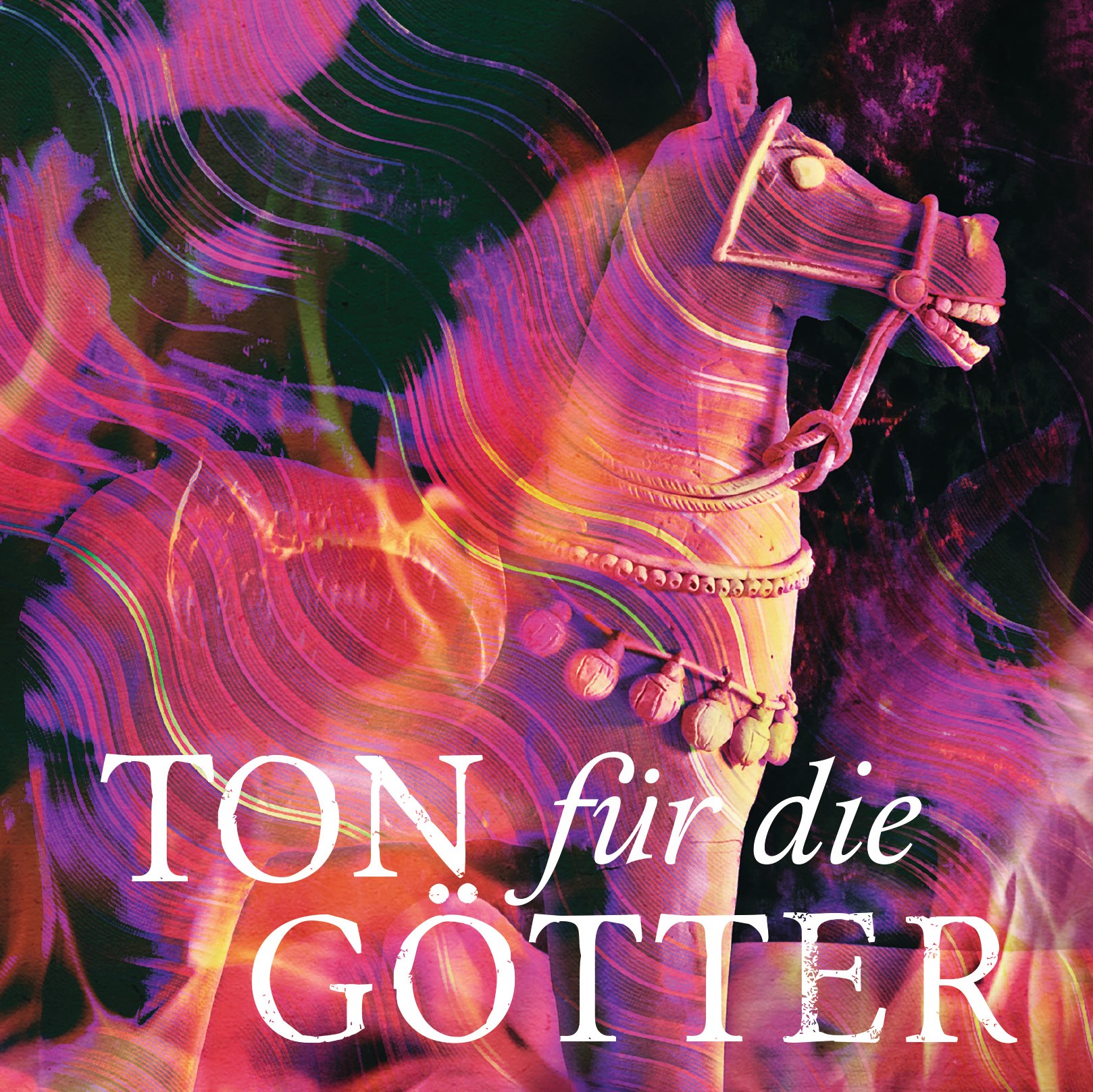
„Ihn faszinierte die Vorstellung, dass der Himalaya einmal unter Wasser gestanden hatte … und zwar vor nur … sechzig Millionen Jahren. Es fiel ihm leicht, sich vorzustellen, wie die afrikanische und die europäische Platte in Zeitlupe gegeneinanderstießen, wie unter dem Bersten und Krachen titanischer Wellen neue Berge in die Höhe wuchsen und keuchende Fische und Kalmare mit sich nahmen, die langsam versteinerten.“
mehr
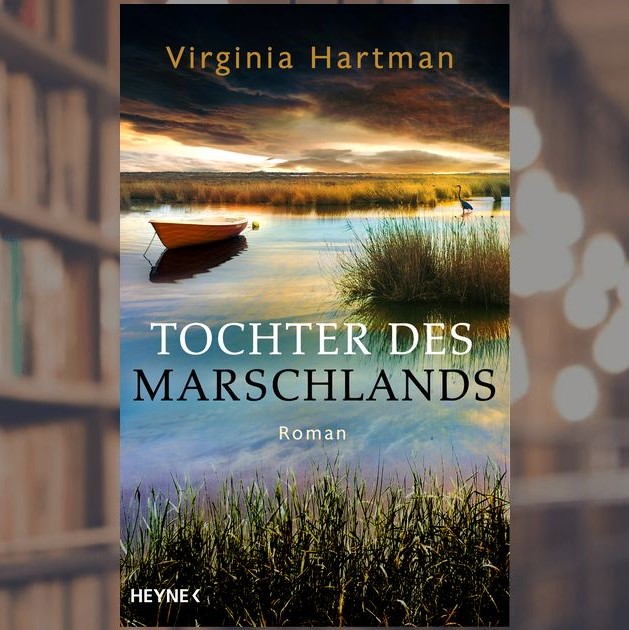
In Rückblenden erzählt Loni Mae Murrow von ihrem fabelhaften Ranger-Vater. Sein Totemtier war der Schlangenhalsvogel. In der Marsch von Tallahassee (im US-Bundesstaat Florida) lehrte Boyd Murrow seine Tochter das Waldläufer-ABC und Trapper-Einmaleins. Sein Programm changierte zwischen engagiertem Umweltschutz, relaunchtem Hillbilly-Pathos, Wildhüter-Weisheiten, Anglerlatein und handfestem Überlebenstraining.
mehr
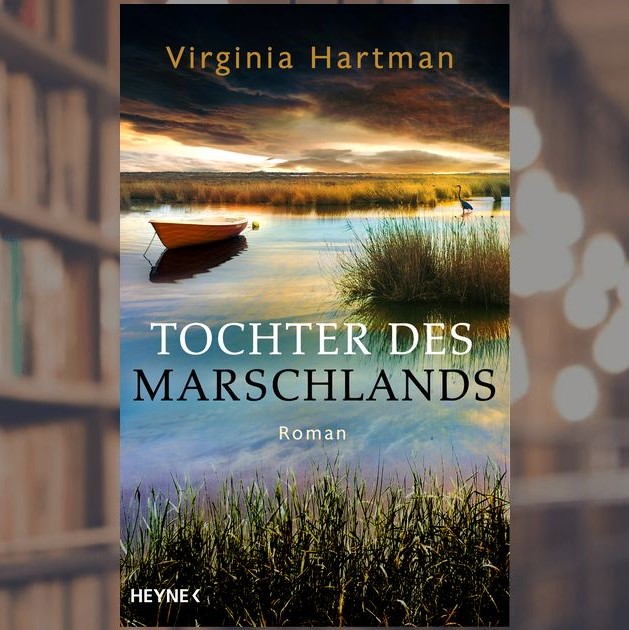
Alexander the Great was born in 336 BC; Frederick the Great was born in 1712 of our era. In between are roundabout 2000 years. Nevertheless, both rode and both fought with edged weapons.
mehr
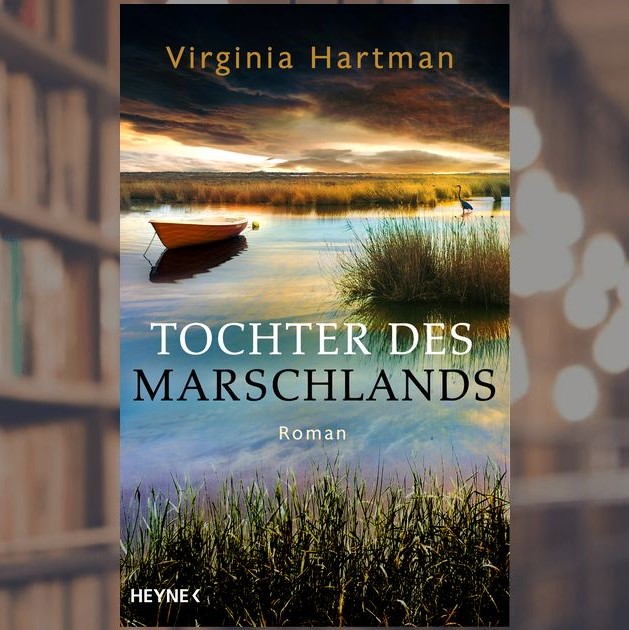
The beginning never tells us anything about what will become of it. It depends on how we tell ourselves the story. People who are not the tellers of their own story are inferior to people who actively tell their own story.
mehr
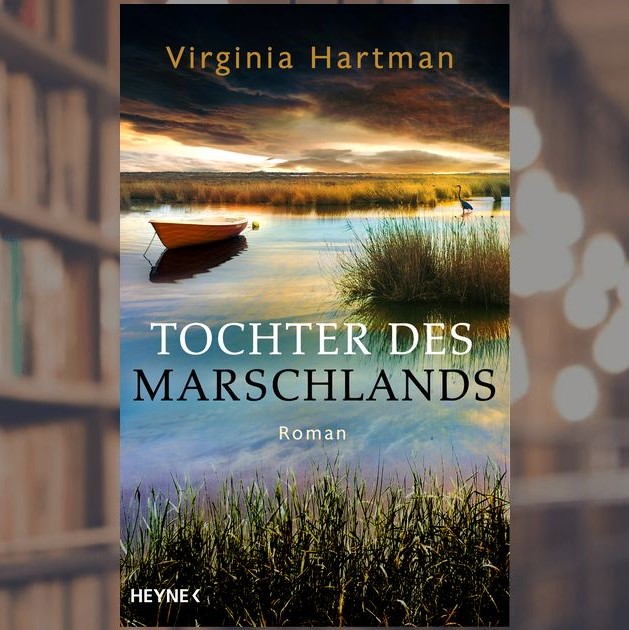
Loni Mai Murrow liebt ihre Arbeit als Zeichnerin in der ornithologischen Abteilung eines Museums. Ihr Dasein entspricht dem sprichwörtlichen Glück im Winkel. Ein Unfall ihrer an Demenz erkrankten Mutter Ruth erzwingt eine Unterbrechung angenehmer Routinen. Mit gemischten Gefühlen fährt Loni in ihre Geburtsstadt im Marschland von Florida. Ihr Bruder und dessen Frau haben Ruth in einem Seniorinnenstift untergebracht.
mehr
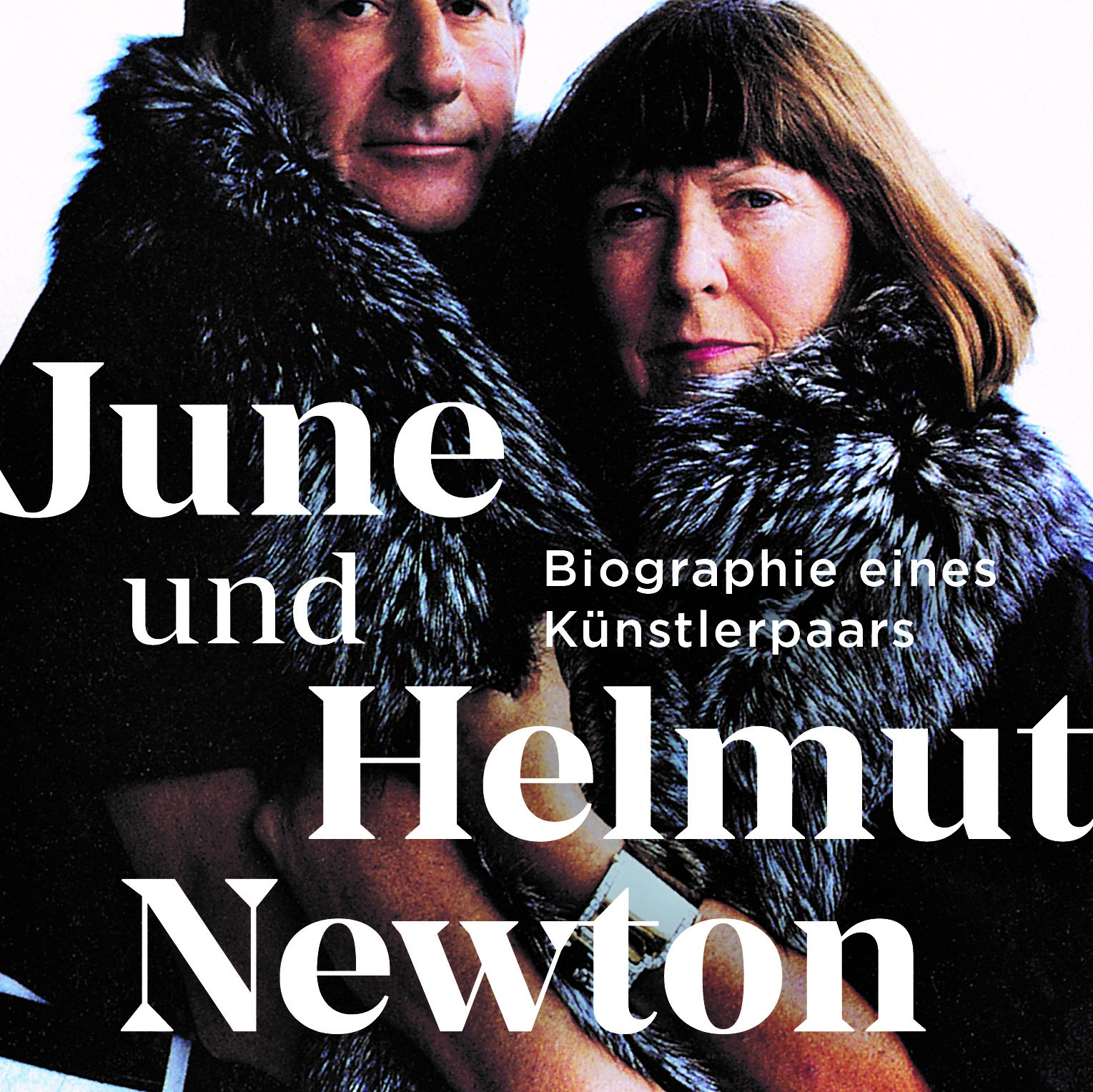
Helmut Newton antizipiert ein ikonografisches Momentum des 21. Jahrhunderts. Superreiche, die in verbotenem Luxus schwelgen, leben mit den Drohungen einer „moralisierenden Gesellschaft“.
mehr
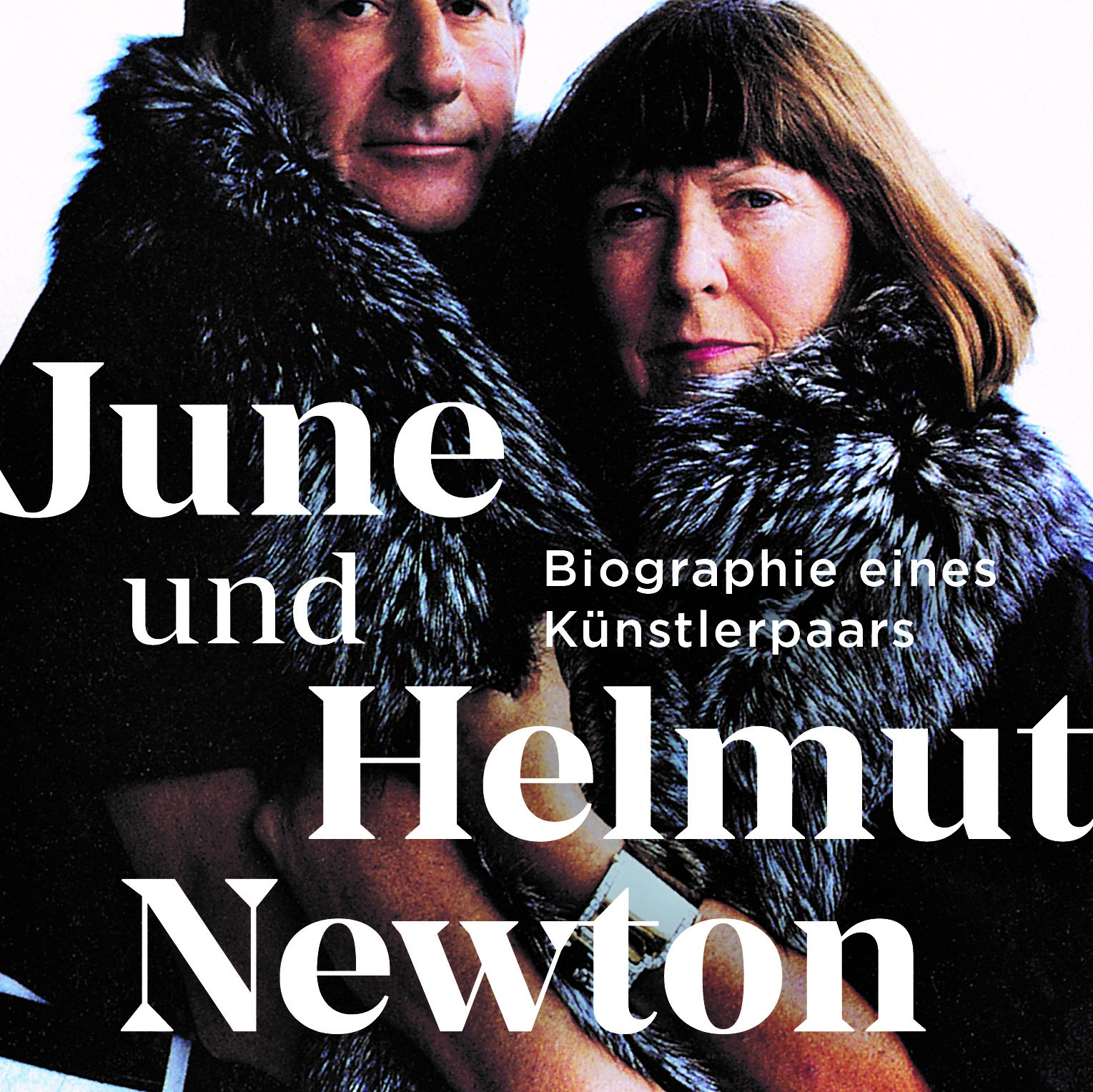
Er kriegt Carte blanche bei der Vogue France. Sein Stil trifft den Nagelkopf der Swinging Sixties. Die Ära zündet seine Ladung. Sie setzt das Potential frei. Wie Phönix aus der Asche steigt Helmut Newton kometenhaft auf.
mehr
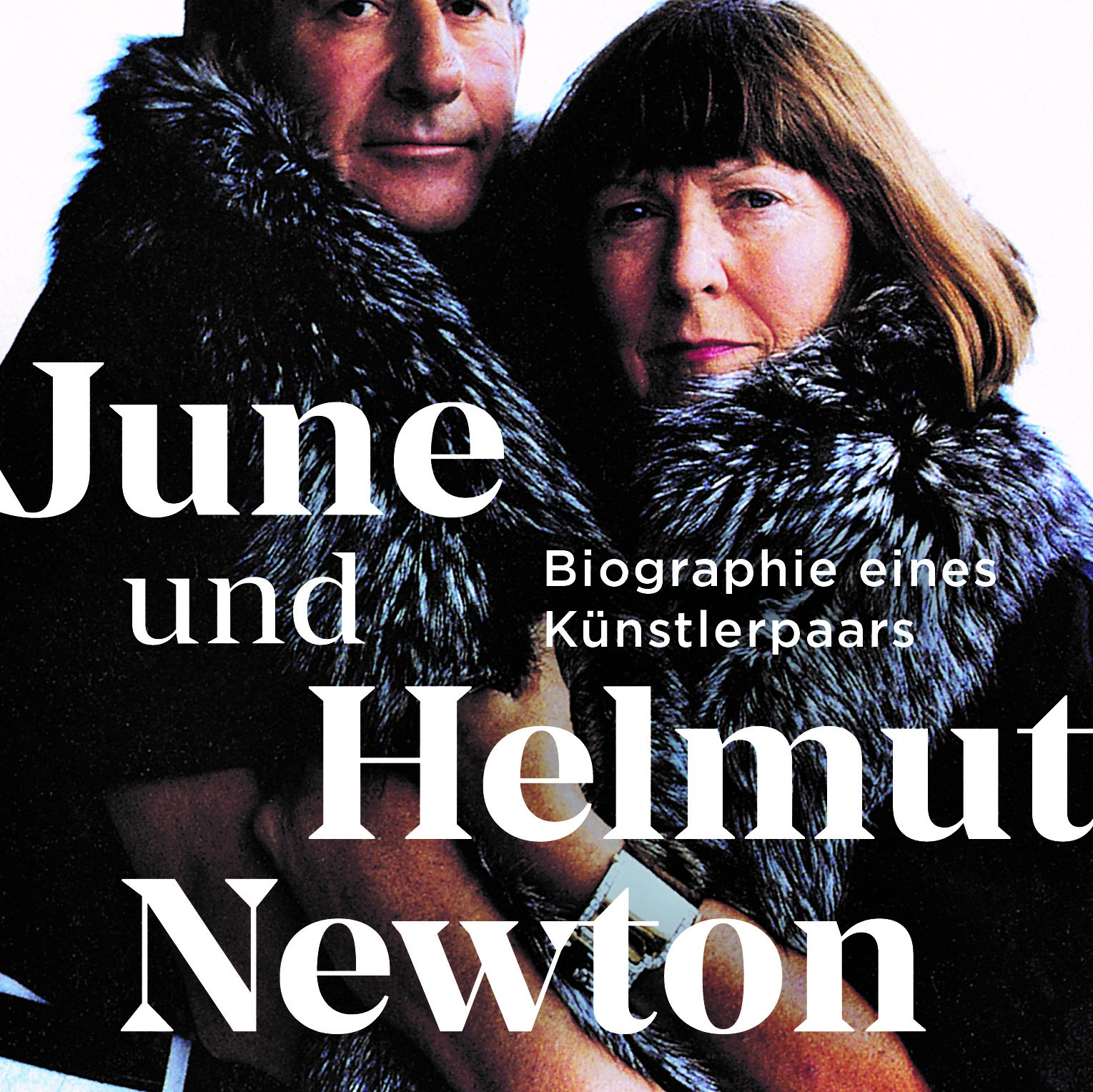
Helmut Newtons Inszenierungen bebildern den Rausch des gesellschaftlichen Aufbruchs der 1960er Jahre. Newton illustriert die Libertinage der Bourgeoisie ... Er liegt auf einer Linie mit Luis Buñuel und Claude Chabrol. Den Kristallisationsmomenten des Lebens liefert er surreale Kommentare in einem Mix aus tatortikonografischen Konnotationen in Film-noir-Manier und Fetisch-Accessoires. Auch Yves Saint Laurents Damensmoking verleiht Newtons Schick eine Signatur.
mehr
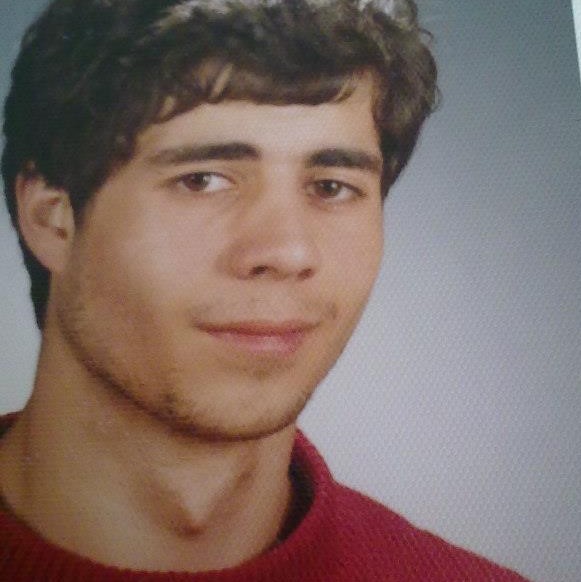
Ulrike Meinhof erlaubt es der ‚Gruppe‘, die Zukunft ihrer Kinder „zu planen“. Die beiden 1970 siebenjährigen Zwillinge Bettina und Regine sollen in einem palästinensischen Kinderguerilla-Ausbildungslager untergebracht werden. Klaus Rainer Röhl, Vater der dem Wahnsinn Anheimgefallenen, schaltet Interpol ein. Die Ermittler:innen ermitteln vergeblich. Die kaum geschulten Politkrieger:innen halten Bettina und Regine vorläufig auf Sizilien versteckt.
mehr

„Natürliche Selektion ist ein rein mechanischer, automatischer Vorgang. Die Welt füllt sich ständig mit Gebilden, die gut überleben können, und wird von denen befreit, die dazu nicht in der Lage sind.“ Richard Dawkins
mehr
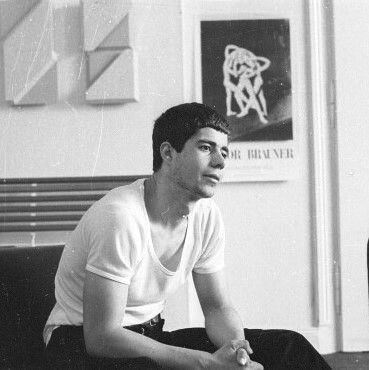
Vater und ich sind nie allein in den Nächten der heiß laufenden Maschinen. Drei, vier lemurenhafte Handlanger, die trotz ausdauernder Betriebszugehörigkeit wie Tagelöhner abgefertigt werden, verrichten in Hochämtern der stillen Selbstverständlichkeit niedrige Dienste.
mehr
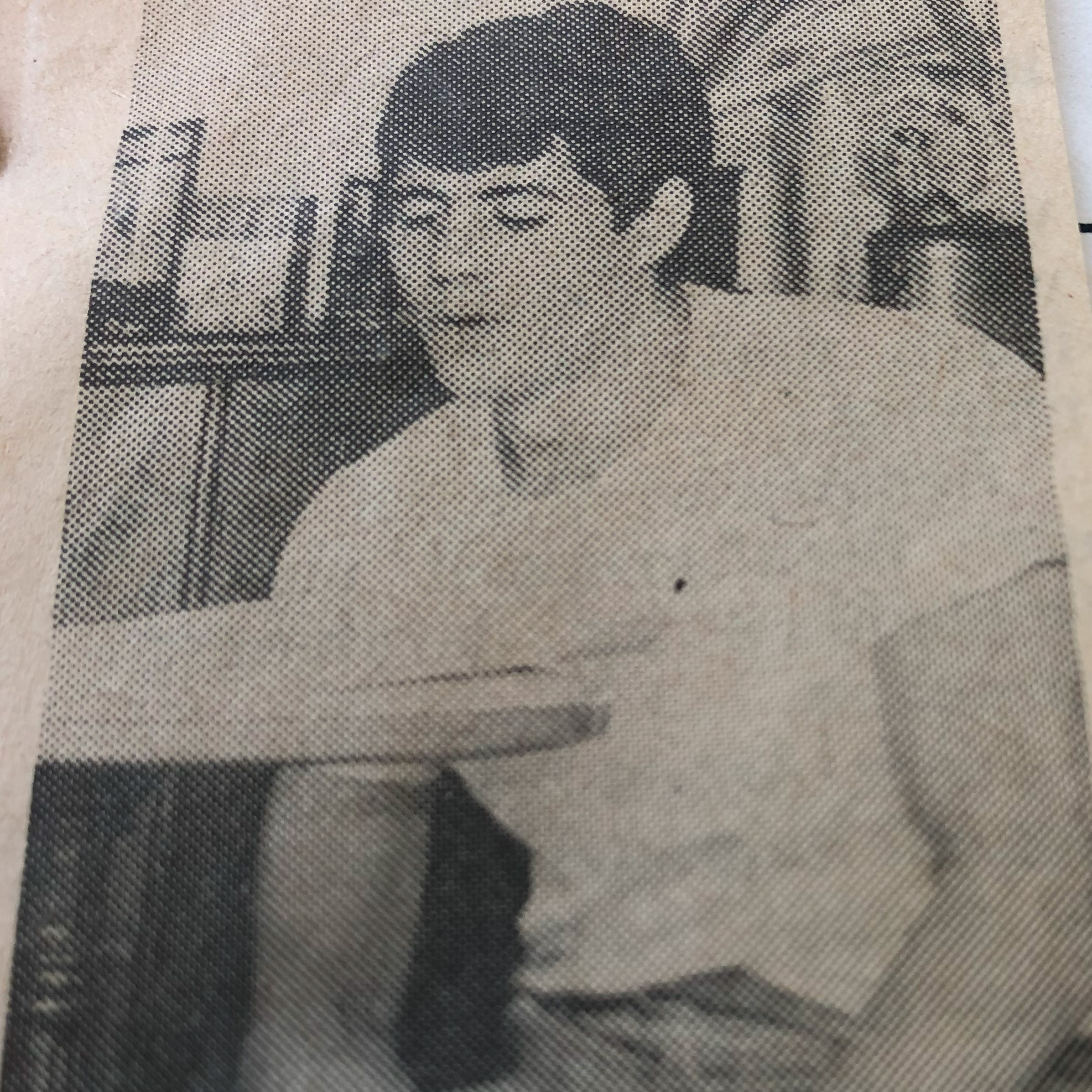
Der Horizont „absorbiert und verflüssigt Schiffe“ aus dem Hafen einer vom Erzähler imaginierten Gemäldegalerie. „Der Bug und das Tauwerk“ sind aus dem Material des Himmels. Dessen Blau gewinnt die Konsistenz von Baustoffen.
mehr
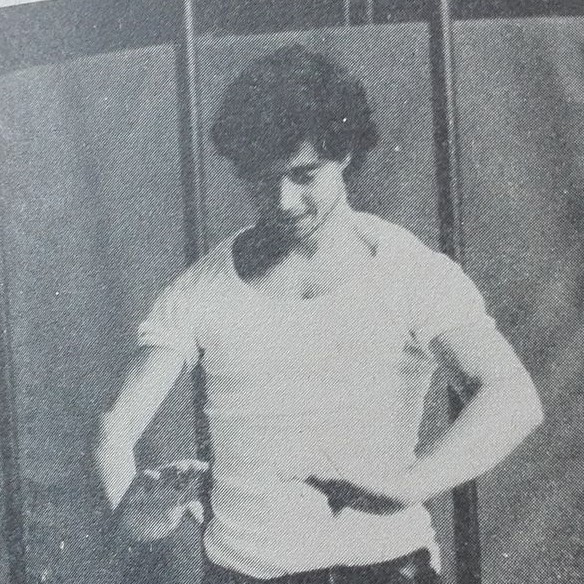
Das Habsburger Reich erwehrte sich der Pest erfolgreich mit einer Befestigung seiner Außengrenzen. Es verschanzte sich hinter einer Sperrzone von Kroatien bis Moldawien. Das Osmanische Reich stellte das Wiener Regime mit militärischen Mitteln unter Quarantäne. „Auf der türkischen Seite des Balkans wütetet die Pest noch bis 1840, auf der österreichischen ward sie nie mehr gesehen“.
mehr

In der Hochzeit der Afrika-Expeditionen und der spekulativen Ethnologie befasste sich der Journalist Henry Mayhew (1812 - 1887) mit der Armutsarchaik vor der eigenen Haustür. Er betrieb Völkerkunde in den Gassen von London und unterschied Stämme von Klans. In der boddenbaltischen Ländlichkeit lebt der aus Mühlheim am Main gebürtige Einar Ehrentraut wie in Traum und Nebel. Er betreibt seine eigene Ethnologie, wenn er zum Friseur geht oder sich eine Zeitung holt.
mehr
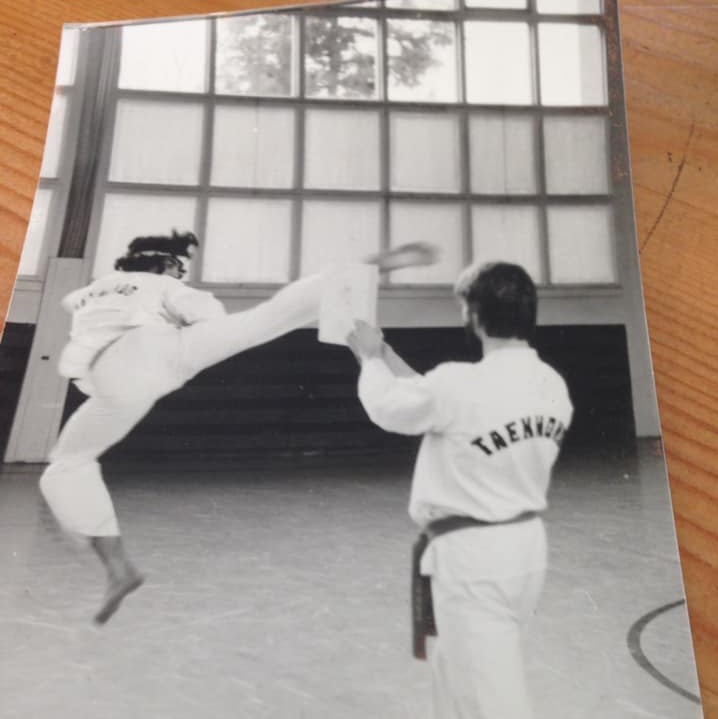
Im Fall von Olof Palme funktionieren sämtliche Verschwörungstheorien. Der schwedische Ministerpräsident wurde nah der U-Bahnstation Rådmansgården in der Stockholmer City erschossen. Zum Täter erklärt man bald den polytoxikomanen Beschaffungskriminellen Christer Pettersson. Er wird erst schuldig und dann freigesprochen. Daraus macht er eine Nummer, mit der er bis zu seinem Tod im Jahr 2004 tingelt.
mehr
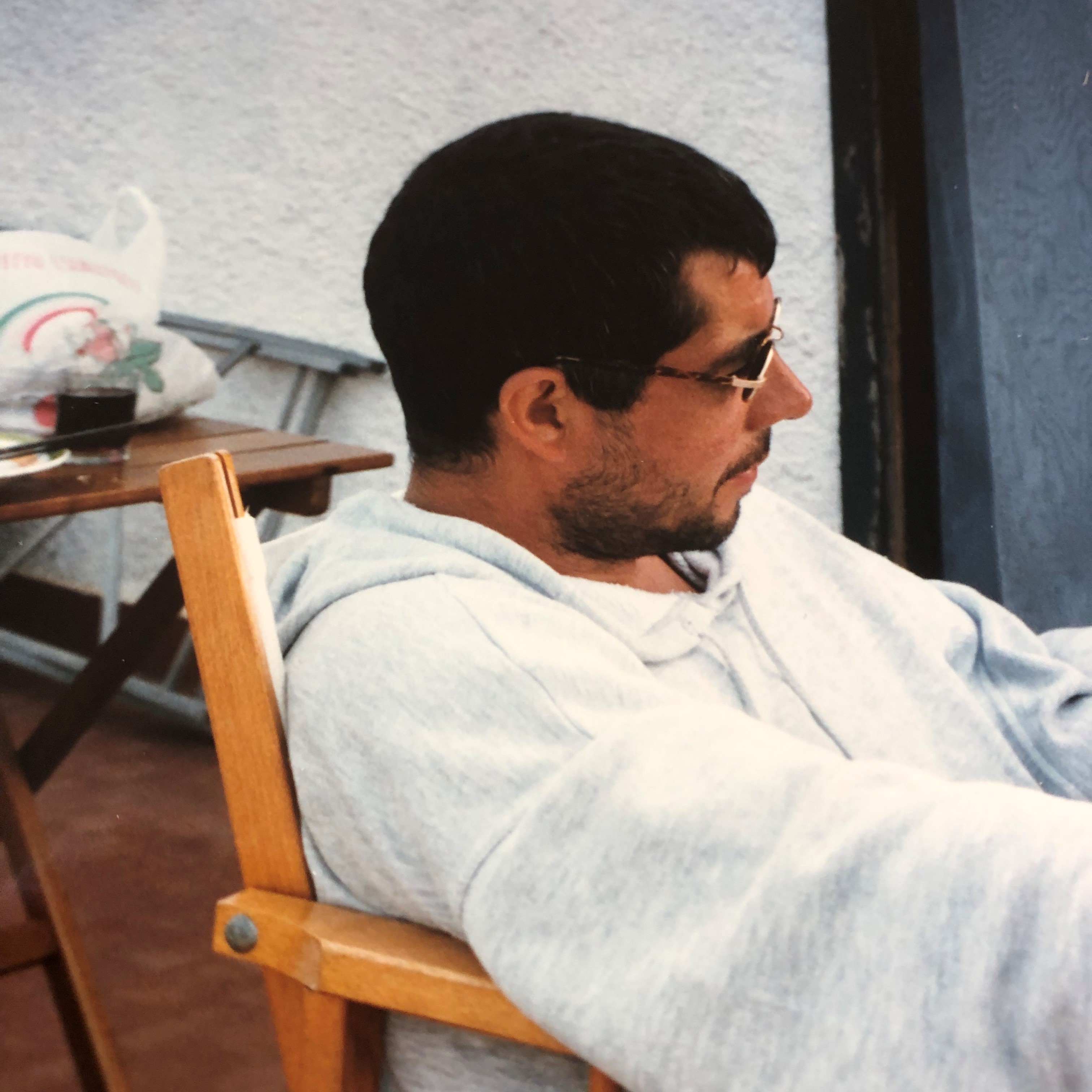
Sandra und ich besiedelten einst gemeinsam den Kontinent der körperlichen Liebe. Wir knüpften keine zarte Bande. Vielmehr holzten wir durch das Neuland. Die Bettwäsche unserer vom Kinder- zum Jugendzimmer aufgestockten Labore roch in beiden Elternhäusern Aprilfrisch. Frühlingsduft auch im Herbst. Jahre sollten ins Land gehen, bis man das wieder hatte: die sich im Geruch aussprechende häusliche Sorgfalt.
mehr
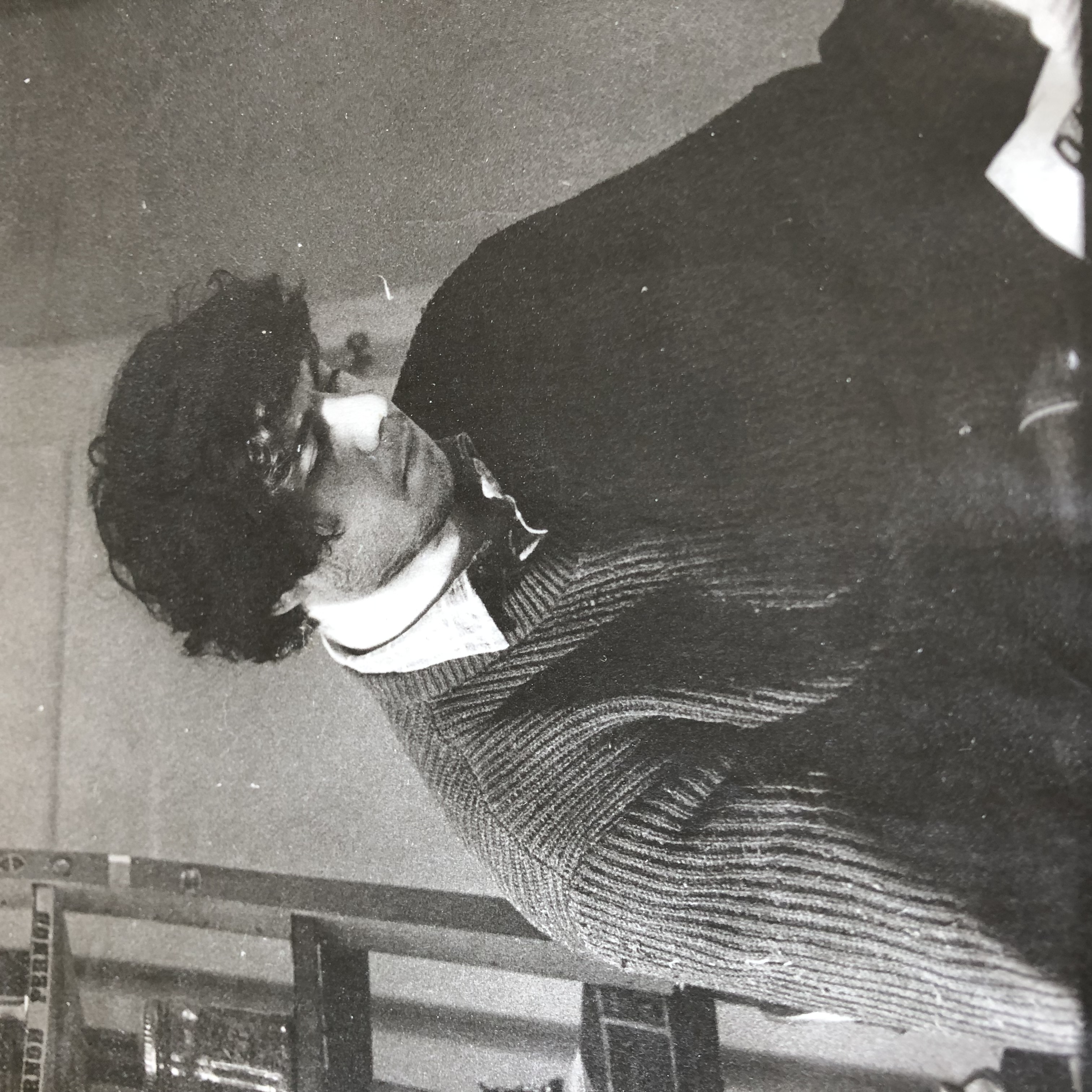
Selten war ein Tag heißer. Mir ist, als fingen meine Beine Feuer. Ich treffe Alecia im Brentanopark. Auf den Bänken liegen Leute wie aufgebahrt. Picknickszenen erinnern an heruntergebrannte Feuer; an (von einer Epidemie) geräumte Feldlager unter einem in Flammen stehenden, wie von einem Flamen im 17. Jahrhundert gemalten Himmel.
mehr

Er macht es ihr leicht, so dass sie sich erst gar nicht in die Pflicht genommen sieht, eine Entscheidung zu treffen und eigenmächtig eine Schamgrenze zu überwinden. Schon beim Vorstellungsgespräch ist Caroline Gaulle alles klargeworden. Maître de Lussac, Professor für Strafrecht mit eigener Kanzlei im eigenen Pariser Stadthaus, hätte sie auch eingestellt, wenn sie mit einem Sprachfehler aufgekreuzt wäre.
mehr
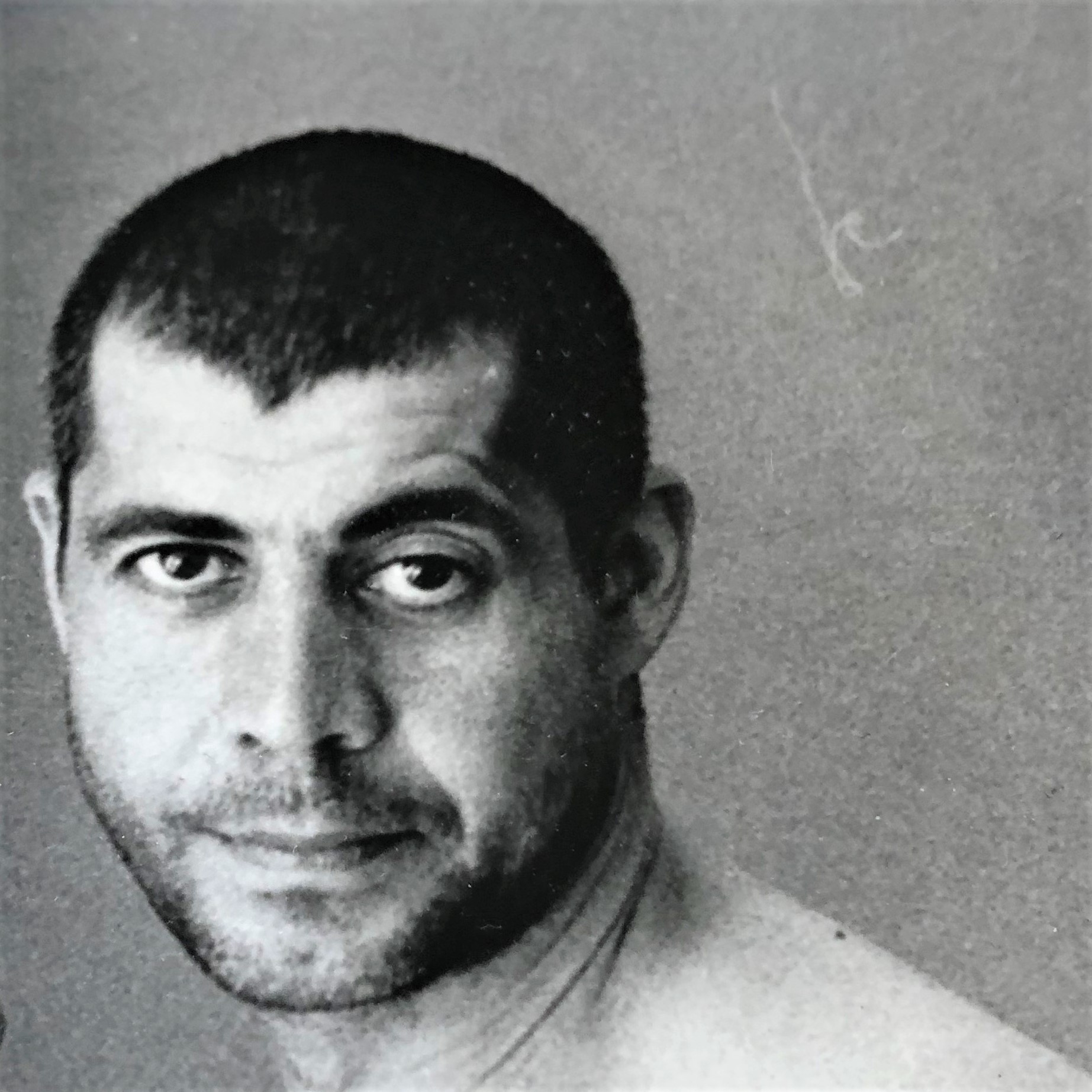
Mimikry und Mimese: Gute Tarnung wirkt sich positiv auf den Fortpflanzungsbetrieb aus. Camouflage-Virtuos:innen konkurrieren mit Hochleistungsnachahmer:innen. „Die Hainschwebfliege ahmt mit ihrer gelb-schwarzen Färbung eine wehrhafte Wespe nach, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Sie selbst hat keinen Stachel und ist völlig harmlos.“
mehr

In einer seiner letzten Publikationen vergleicht Hans Magnus Enzensberger den Limes mit einer „Membran, die einen osmotischen Austausch zwischen verschiedenen Kulturen und Verkehrsformen beförderte“. Die Römer:innen seien zu klug gewesen, um sich abzuschotten. Jede Verriegelung erschafft eine Verarmung.
mehr
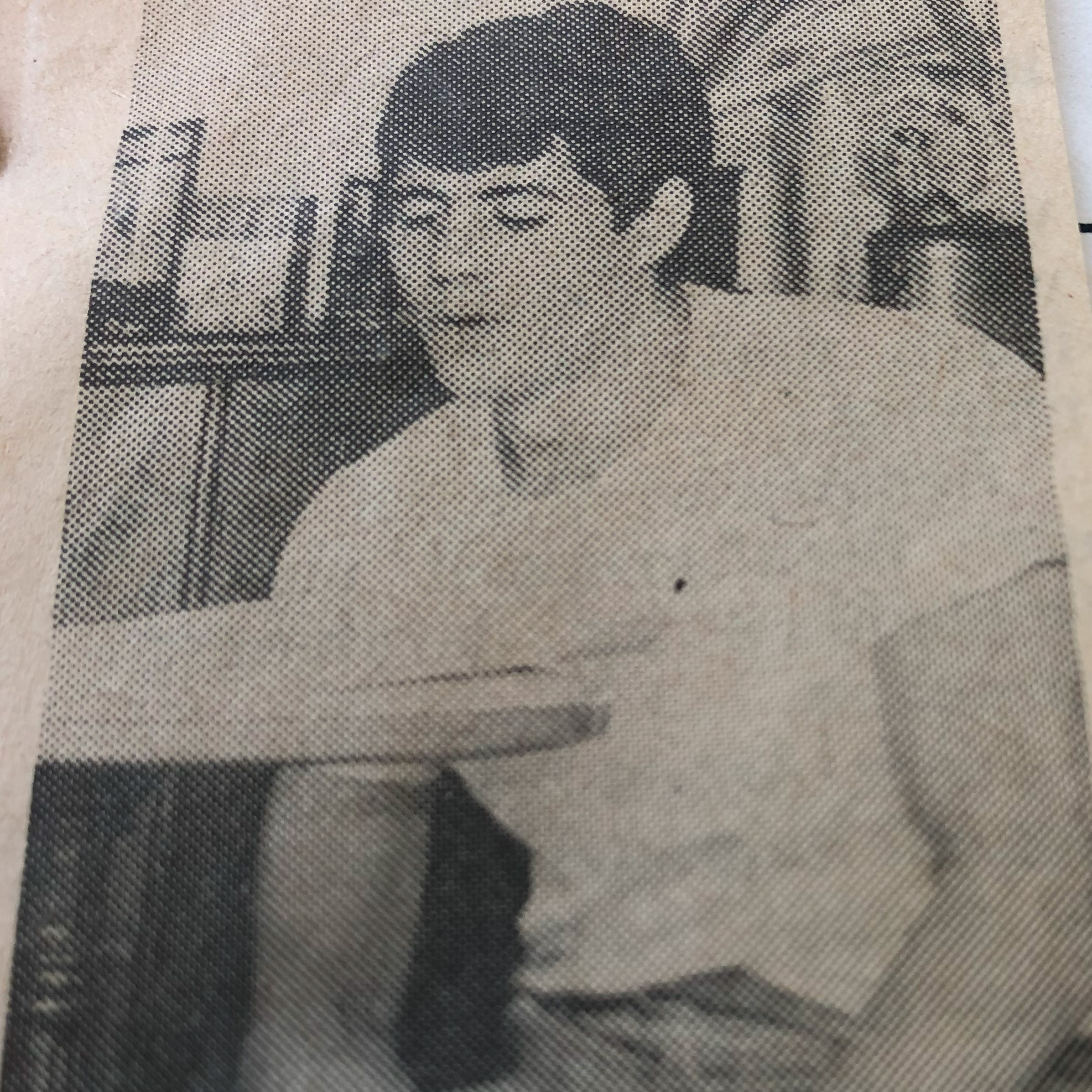
Die Prozesse der Welt schienen in Krasnokamensk zum Erliegen gekommen zu sein. Die Geschichte gähnte. Die Zivilisation machte sich dünn. Die Zeit floh westwärts.
mehr

“All of the body’s reactions have a genetic root that goes back billions of years. As soon as we leave the thermoneutral zone, everything revolves around restoring homeostasis. Almost all genetic variants have their origins in evolutionary events long before our journey starts.” Texas ‘Double Action’ Thunderbolt
mehr
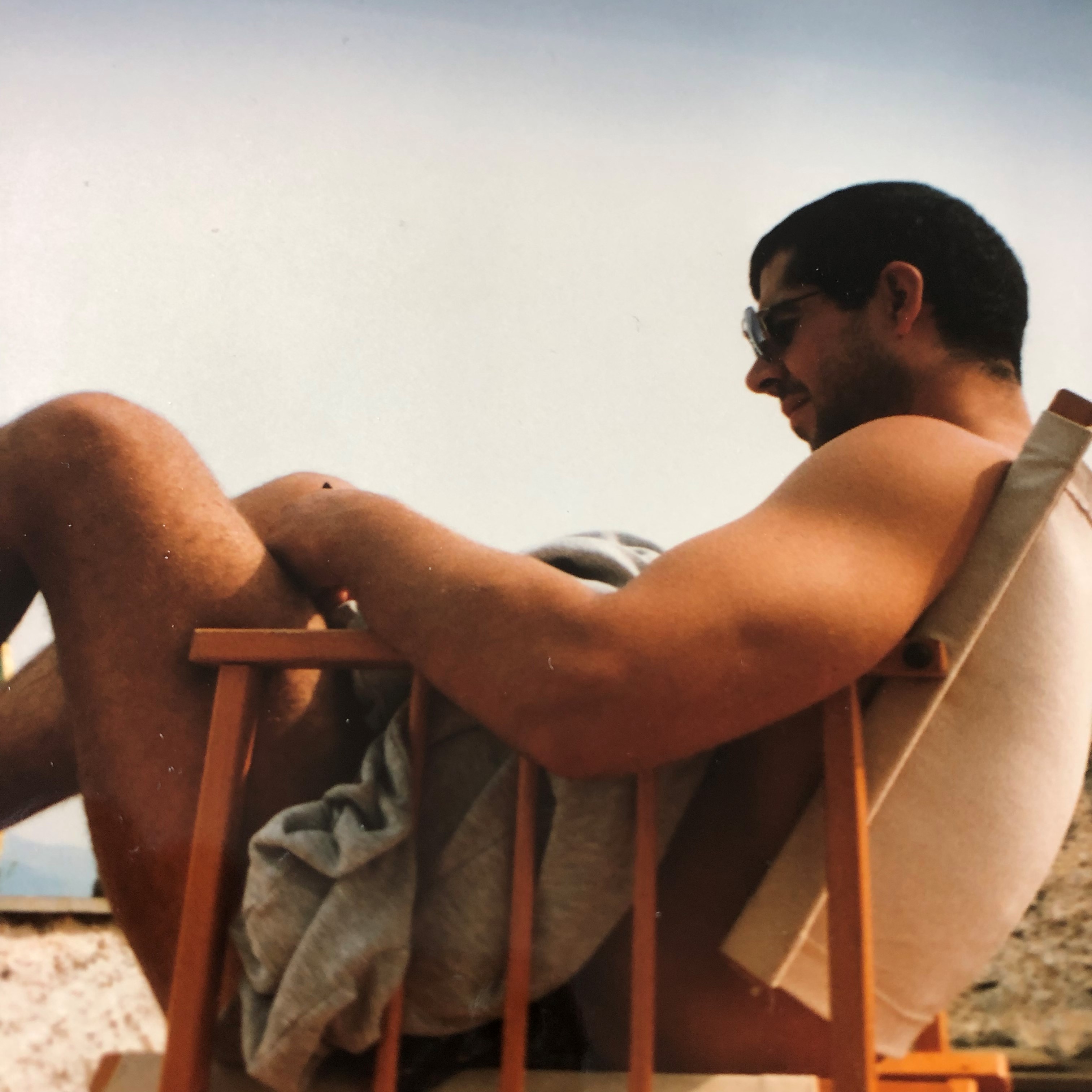
Elke hat ihre Seniorinnenform gefunden. Sie reüssiert als Grande Dame mit Kunstvereinabonnement und als handfest-humorvolle Gartenfreundin. Da steht eine Fünfundfünfzigjährige, so straff und elastisch, dass man mit ihr einen Fit-ab-Fünfzig-Unterichtsfilm drehen könnte.
mehr

An einem Frühlingstag im Jahr 1612 duellierte sich Miyamoto Musashi mit Sasaki Kojirō auf Ganryū-jima, einer Insel in Rufweite der Burg. Zur Poesie der Begegnung zählt ein langer Riemen über psychologische Kriegsführung. Musashi, damals ein alter Hase von dreißig Jahren, ließ seinen Gegner warten, das heißt schmoren. Er trat mit einem Holzschwert an, geschnitzt aus einem Ruder.
mehr

Der untypische Edamer fällt nicht nur mit hellseherischen Fähigkeiten auf. Er verfügt über Gaben, wie man sie im europäischen Kulturkreis der Hexerei zurechnet. Tatsächlich versucht Jakobs leiblicher Vater, der sagenhafte Captain Cannonball, via Voodoo eine Fernverbindung aufrecht zu erhalten. Geprägt vom calvinistischen Geist in einer Spielart des niederländischen Provinzpuritanismus ...
mehr
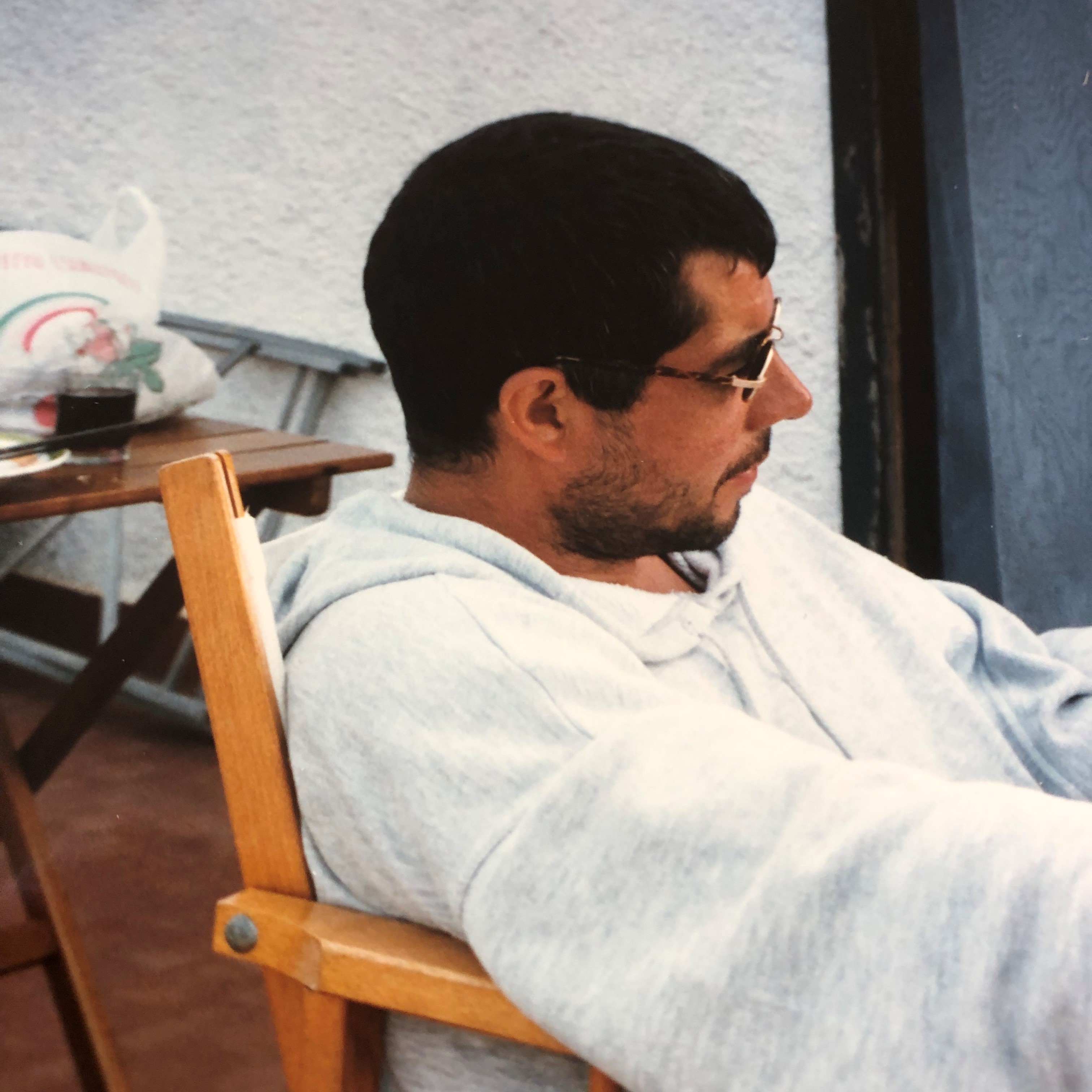
1989 trennt sich Elke von Einar. Knall auf Fall heiratet sie ihren Führungsoffizier Wotan ‚Stalin‘ Freiling. Das Paar lebt zunächst in Berlin. 2000 lässt es sich an der baltischen Riviera nieder und steigt da in das von Ex-MfS- und Stasi-Leuten kontrollierte Immobiliengeschäft ein.
mehr
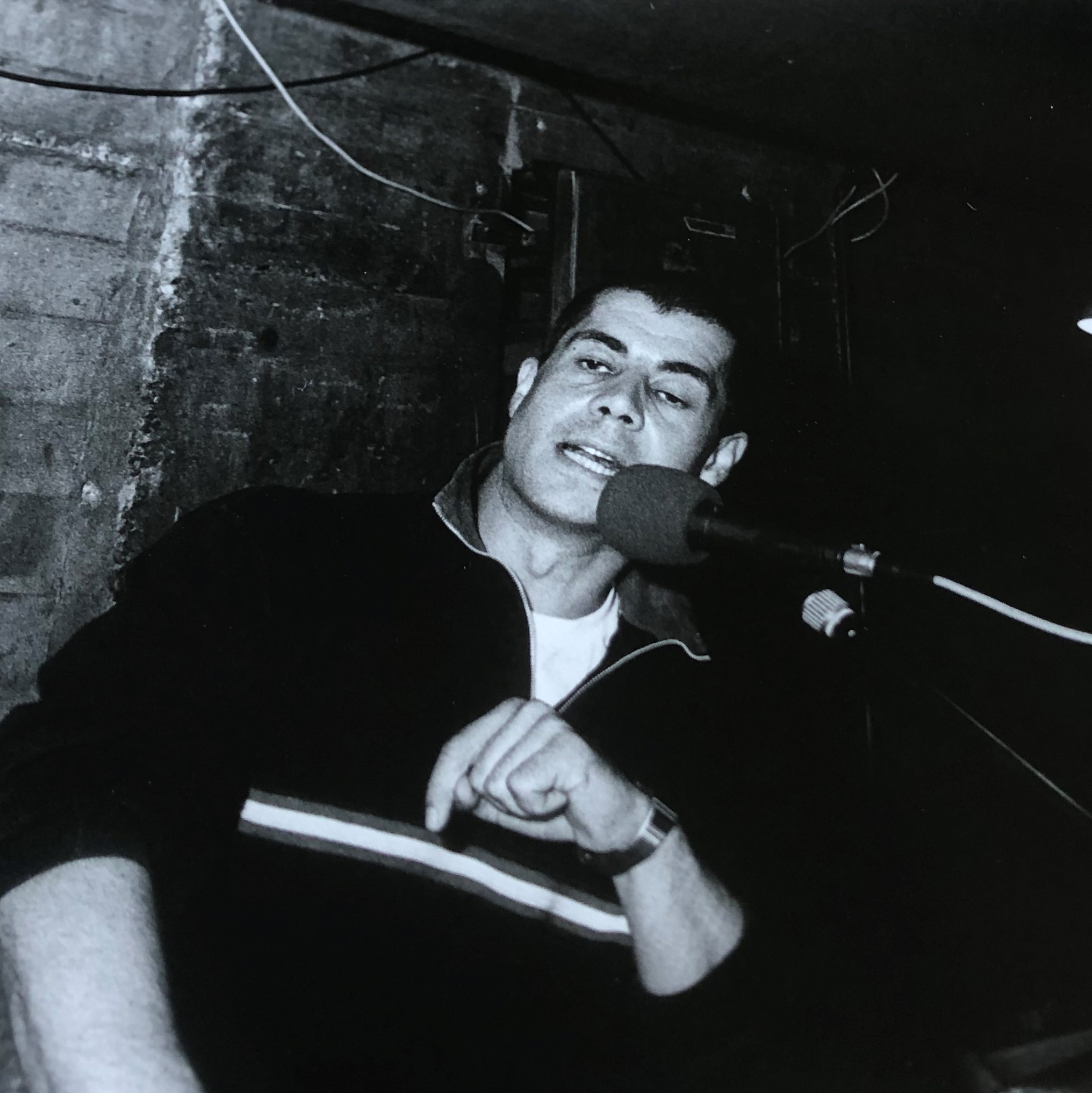
„Nach der Handicap-Hypothese haben die Männchen mit den auffälligsten Farbtrachten schon deshalb gute Chancen bei den Weibchen, weil sie noch am Leben sind.“ Axel Buether
mehr

„Wir haben das große Gehirn, um herauszufinden, was andere gegen uns im Schilde führen“, sagt Gerhard Roth. Der Hirnforscher nennt das „machiavellistische Intelligenz“. Alle Handlungsbegründungen ergäben sich aus unfreien, da im Gehirn vor-geschriebenen Legitimationsabsichten gegenüber der Horde.
mehr

An manchen Tagen nahmen wir zehn Millionen Dollar ein. Nicht nur Akteure der Trump-Liga beschworen uns, ihr Geld zu nehmen, sondern auch die Roy Blunts und Tom Cottons dieser Welt. Wir waren so übersteuert, dass wir es nicht nötig fanden, jedem etwas anderes zu erzählen. Wir hatten einen Standardtext, den wir vor allem June abspulen ließen. Sie figurierte als Königin im Bienenstock des ...
mehr

“‘Ti’ (手) means to connect two perfect points with one perfect movement.” Onaga Yoshimitsu Kaichō
mehr
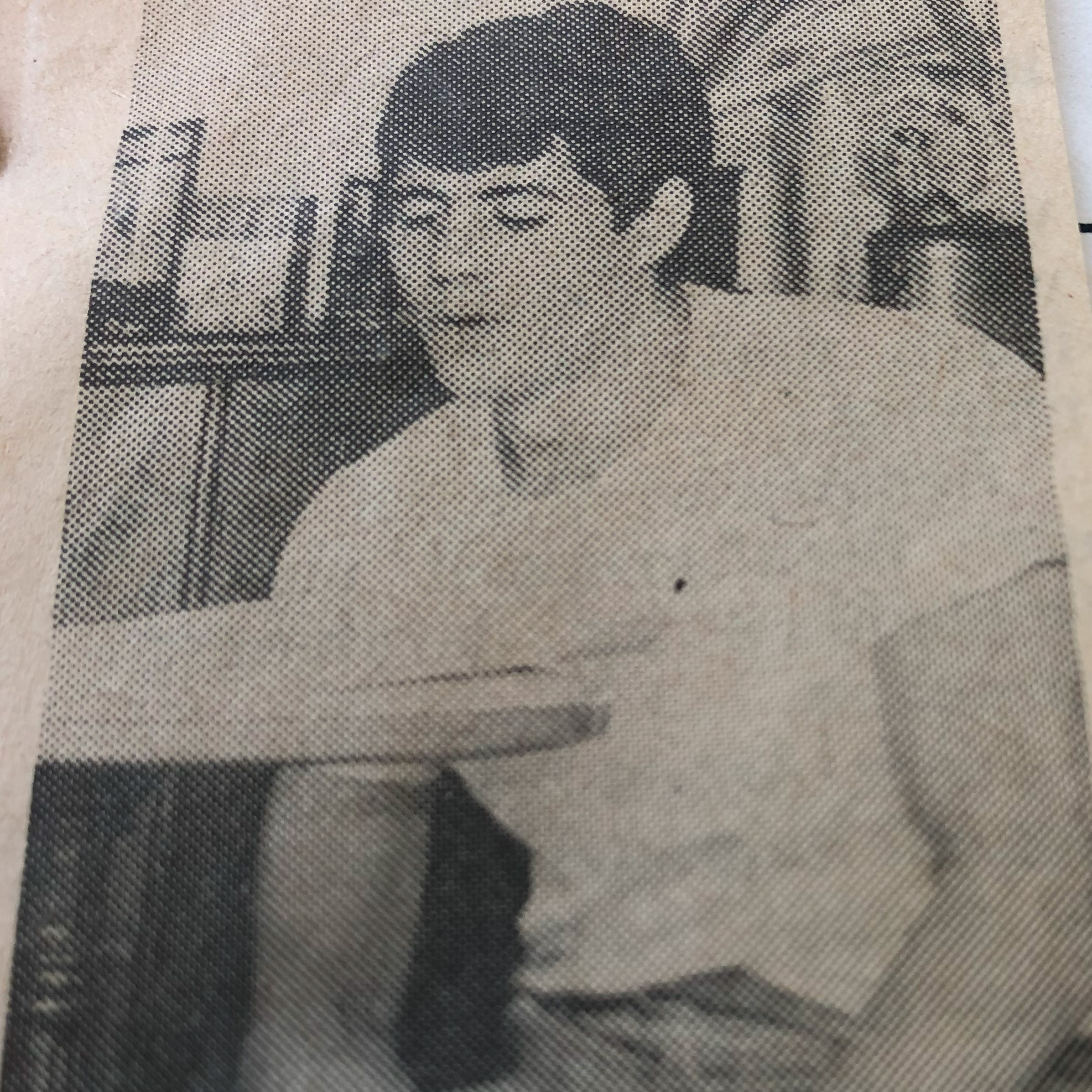
Gerda hat ein klugscheißendes Kind ohne natürlichen Charme am Hals, und einen verschrobenen Mann, der vor seinem Vater buckelt. Sie hat einen Schwiegervater, der sie hartnäckig und vulgär begehrt, und eine Schwiegermutter, deren Leidensmiene sie kaum erträgt. Ihre eigenen Eltern sind unbrauchbar. Sie platzen aus allen Nähten der automatischen Anpassung und des guten Willens. Sie sind der Bundesrepublik fremd geblieben, als leblos-gescheite Ex-Persönlichkeiten.
mehr
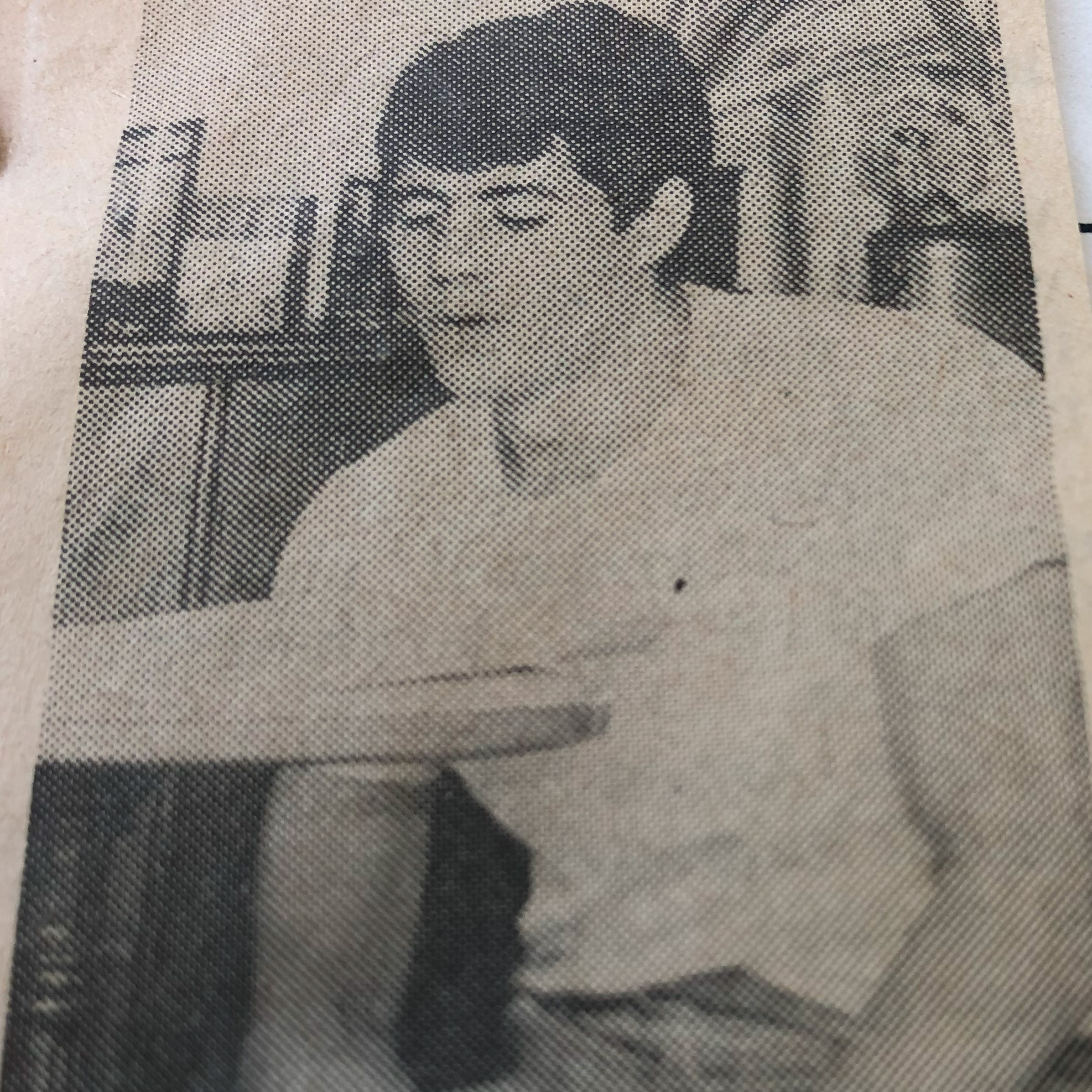
Eines Tages bemerkt Kressin Reste eines Lagers. Eine Plane, die dem Windschutz dient, weht von einem Ast. Weggeworfenes und Liegengebliebenes vermehrt sich schlagartig. Die Spuren der Verwahrlosungen führen zu weiteren Schlaf- und Feuerstellen, die mit Müll möbliert sind. Plötzlich zieht das auf der unteren Stufe des Mittleren Miozäns der Landschaft eingeprägte Becken menschliches Elend an.
mehr
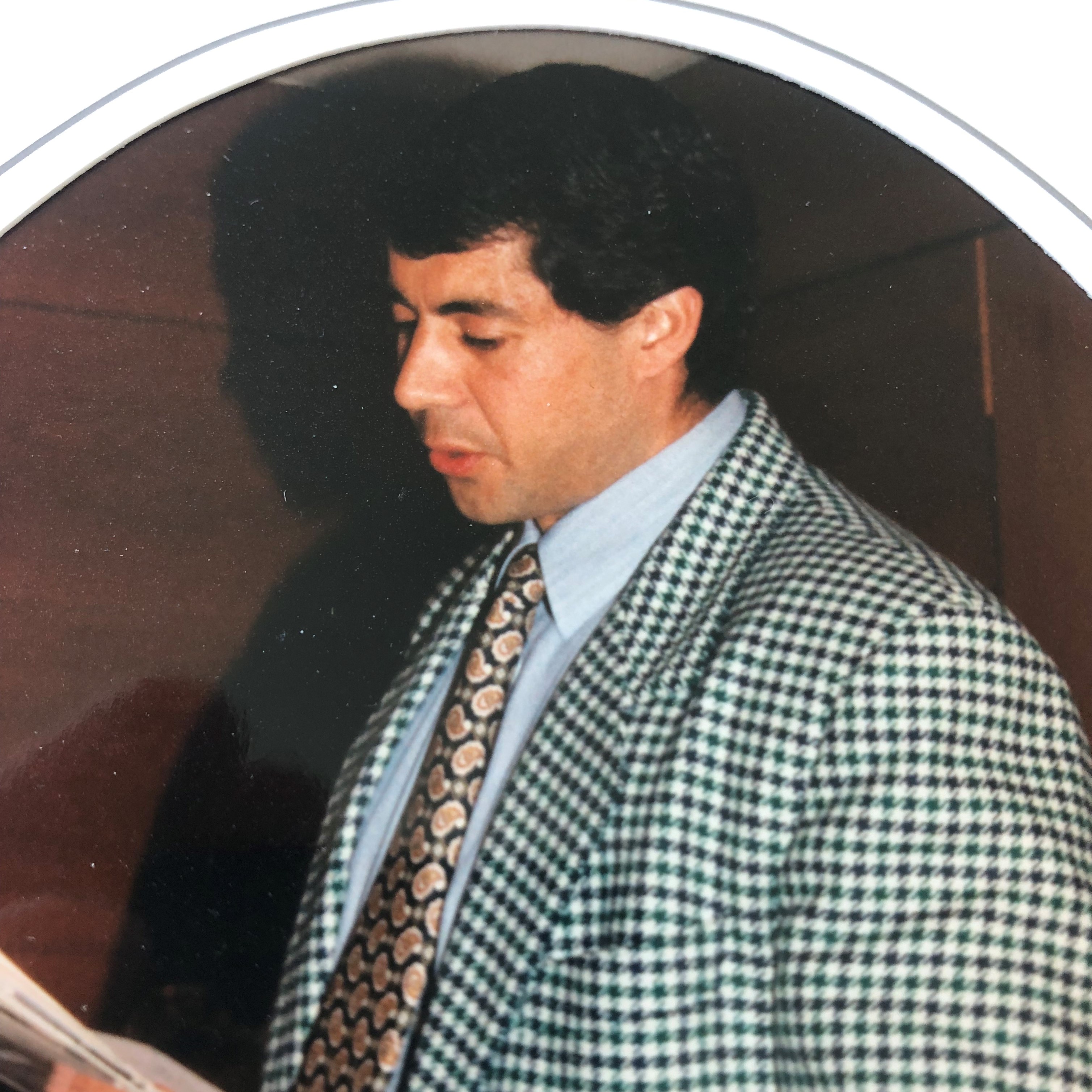
June kommt aus der Depression einer nordenglischen Bergarbeiter:innenstadt, die in der Keimzeit des britischen Neoliberalismus gegen die Wand gefahren wurde. Sie wuchs in einer sterbenden Gemeinschaft auf. Die proletarische Kultur gehörte zum Hörensagen und Sagenhaftem. Wettbüros, Spielhallen und Telefonläden okkupierten traditionelle Schauplätze einer im Verschwinden begriffenen, von betrunkenen Altvorderen hymnisch betrauerten Lebensform.
mehr
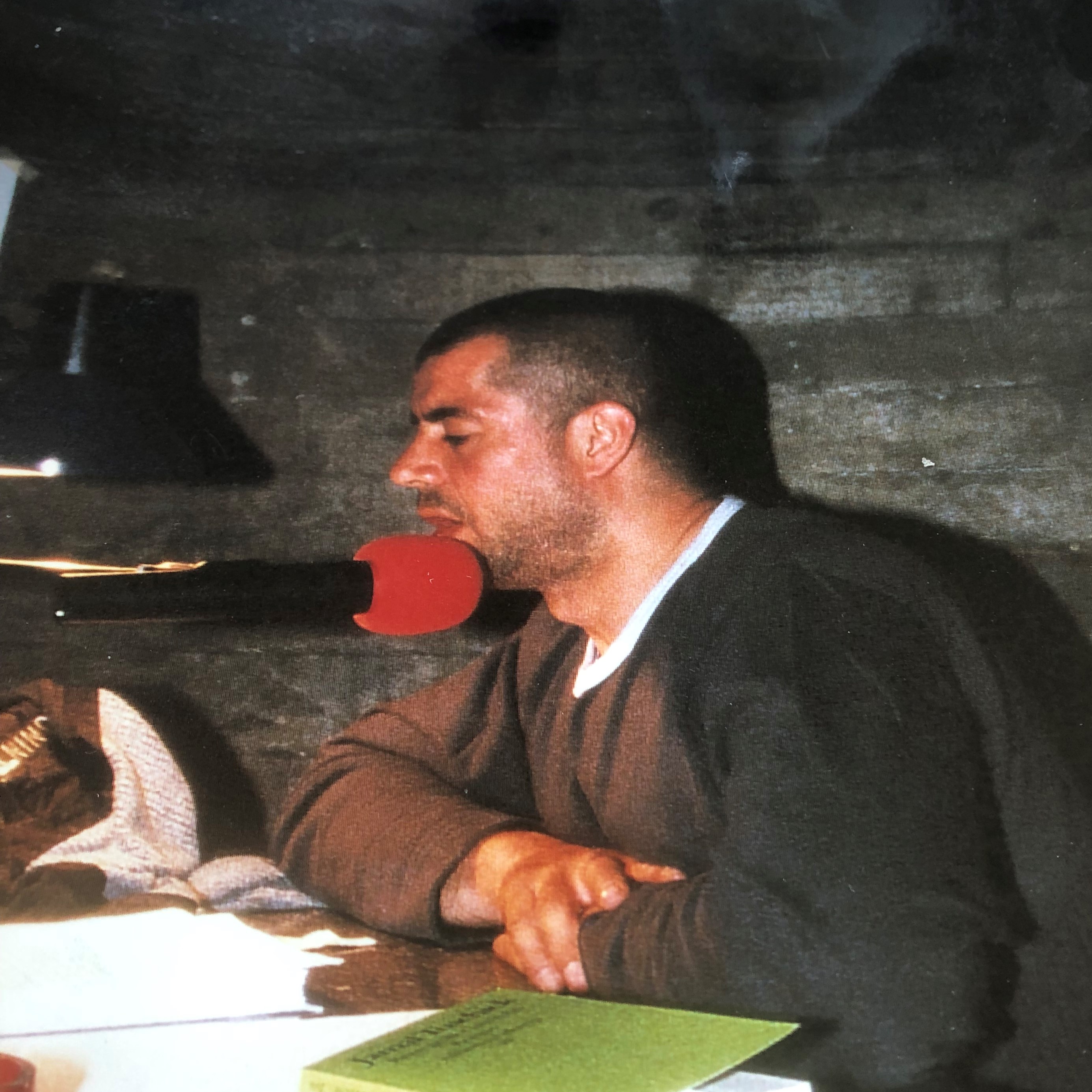
Ausgerechnet beim Tennis, einer Randsportart in der DDR, zieht sich Arina Nikola eine Sehnenentzündung am Innenschenkel zu. In der Physiotherapie verfällt sie einem Kindgreis mit goldenen Händen. Eine Adduktoren-Tendopathie spielt die hauptamtliche MfS-Mitarbeiterin (mit der Legende einer Designerin) dem Physiotherapeuten (und Yoga-Terminator) Binh in die Arme.
mehr
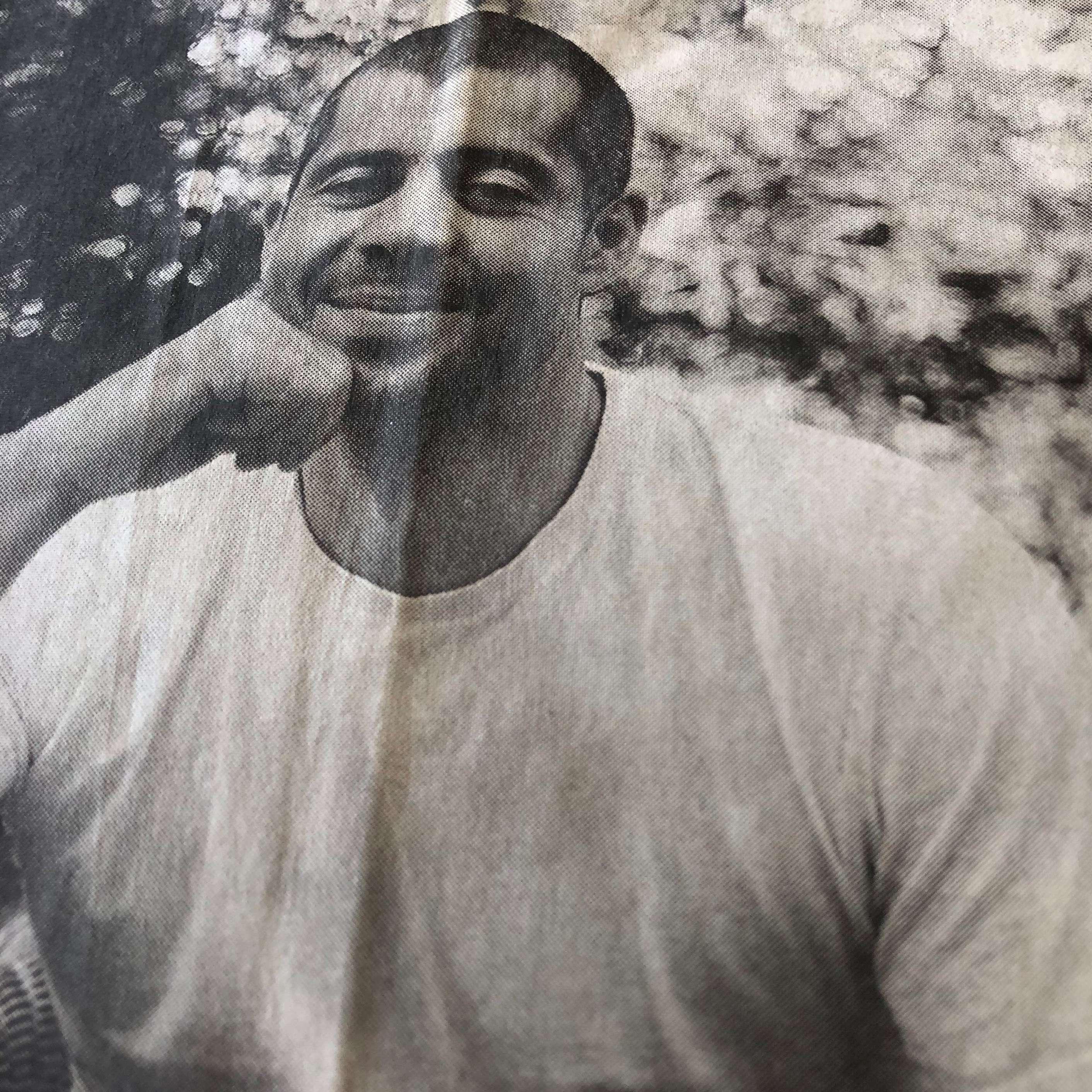
Brandt regierte gegen Wehner. Wehner wollte keinen Wandel durch Annäherung. Ihm gingen die Ostverträge zu weit. Er förderte die Aufrechterhaltung des Status quo. Er stand Erich Honecker näher als Brandt. Wehner hatte in Moskau mehr begriffen als Honecker im Zuchthaus Brandenburg-Görden.
mehr

“Relaxation is more important than information. Relaxation is the reward for successful adaption.” Das verkündet die Berlin-Rangers-Ausbilderlegende Tecumseh-Texas Thunderbolt. „Das Wesentliche im Universum ist nicht das Organische, sondern die Information“, widerspricht Heiner Müller. Im Weiteren sei „Optimismus nur ein Mangel an Information“. „Information ist Information, weder Materie noch Energie“, erklärt Norbert Wiener.
mehr
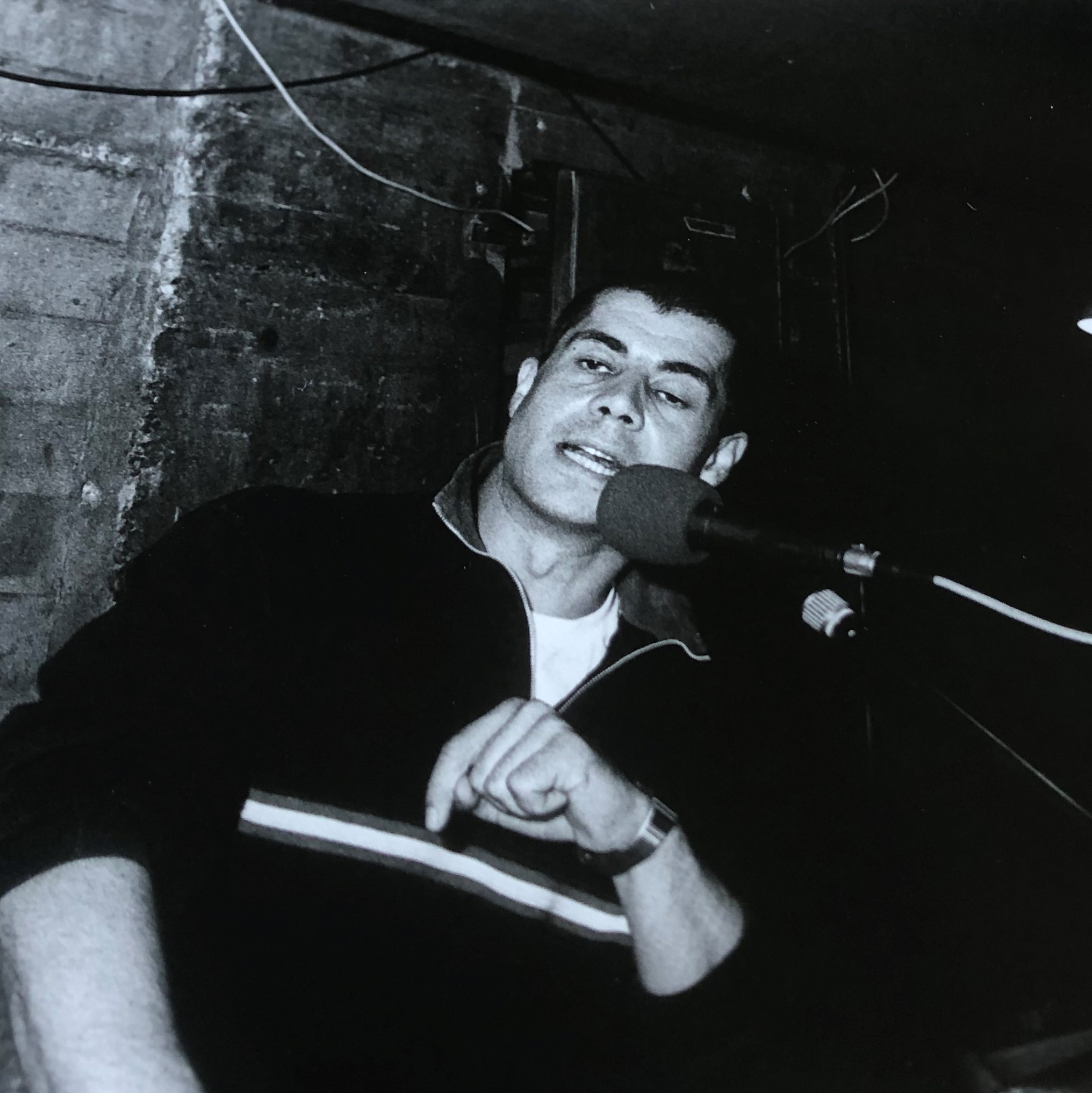
Zu den mysteriösen Todesfällen, die mit einem direkt von der DDR-Führung autorisierten Mordkommando in Verbindung gebracht werden, gehört der vorgebliche Unfalltod von Benedikt Achtleben. Der DDR-Außenhändler kam in der Nacht auf den 19. März 1984 im Treppenhaus seines Leipziger Messequartiers (sprich Barbaras Wohnung) ums Leben. Die polizeiliche Rekonstruktion des ‚Unfallhergang‘ ...
mehr
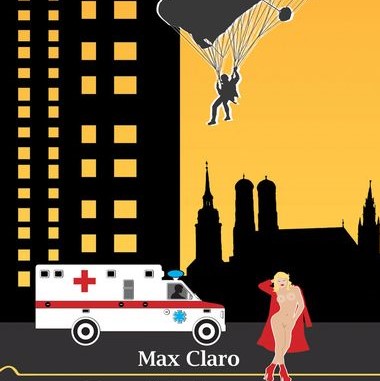
Wie leicht ist es, in unserem Rechtsstaat einen Bürger in die Psychiatrie zu verfrachten? Diese Frage beantworten sich die Münchner Rettungssanitär Peter Pfeifer und Thomas Baumann im Praxistest. Sie veranlassen einen Krawattenträger zum Krawall, übermannen, fixieren und sedieren den aller Wahrscheinlichkeit nach Unbescholtenen, ziehen einen Polizisten zur Bestätigung der Rechtmäßigkeit ihres Übergriffs heran und liefern jemanden auf einer geschlossenen Abteilung ab, der sich Doktor Uwe Bärlauch nennt.
mehr

Niklas Luhmann beschreibt Vertrauen als „einen Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität“. Tillmann leuchtet die mechanistische Erklärung ein. Er ist ein Freund simpler Lösungen - Simplicity is the ultimate sophistication.
mehr

Die Renaissance trennt die Kulturräume, sagt Heiner Müller. Die Neuzeit beginnt mit der Pest, sagt Egon Friedell. Der Hauptzweck der bürgerlichen Gesellschaft ist die Verdrängung des Todes, sagt Walter Benjamin. Das 19. Jahrhundert wohnte „die Ewigkeit trocken, in Räumen, die rein vom Sterben geblieben sind“. Beatles versus Rolling Stones. Ständig wird Tillmann gefragt und danach beurteilt, welcher Band er mehr Sympathie entgegenbringt.
mehr

In den 1950er Jahren tarnt sich der Revolutionsromantiker Heiner Müller als Materialist. Er ersetzt Liebe mit Leib, er fürchtet den Vorwurf der Dekadenz. Er übt seine Unterschrift. HM geißelt „eine plebejische Tradition“, macht Brecht Vorwürfe, kritisiert Schiller: „Seine Balladen sind Bildungsballaden, geschrieben von einem Gebildeten, nicht von einem Bildner.“
mehr

„Er war kein tüchtiger Mensch.“ Das sagt Heiner Müller über seinen Großvater. Für den sächsischen Schuster hatte alles sein Gutes.
„Gezwungen, trockenes Brot zu essen, lernte man es zu schätzen.“ Ein Leben lang duckt er sich weg, doch als es ans Sterben geht, verliert er die Geduld und will sein Brot mit Butter streichen. Seine Frau wähnt ihn ob der Hoffart schon auf der Schwelle zur Hölle ...
mehr

Bis zu seiner Republikflucht vor drei Jahren leitete Asbeck die von ihm im Auftrag der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) gegründete Asimex. Die Firma der „Firma“ stattet das Luxussegment der Intershops und Interhotels aus und versorgt Politbüromitglieder mit westlichen Spitzenprodukten. Asbeck war der erste Eventmanager der DDR. Reich machten ihn Schmiergelder von Westkonzernen, die in das DDR-Geschäft drängten. Die HVA ließ Asbeck gewähren. Von Asbeck erfuhr der BND, dass die DDR mit 26 Milliarden DM im Westen verschuldet ist.
mehr
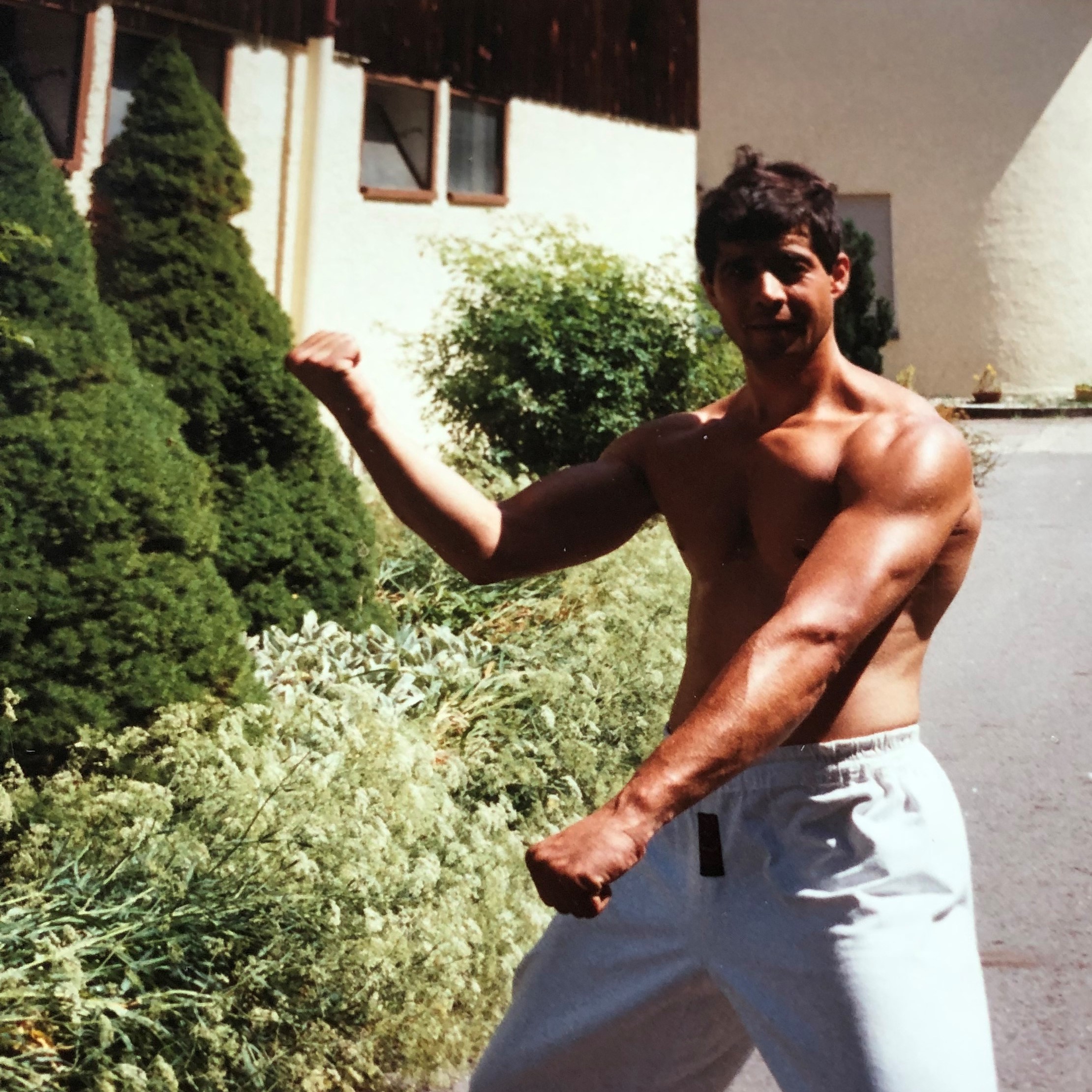
Irgendwann in den späten 1970er Jahren. In Leipzig war Herbstkleinmesse. Ich erinnere einen zum Bersten gutgelaunten Zweimeterbrocken in seinem Wurstwagen. Eine Kumpel-Riege belagerte die ambulante Bude. Alle waren aufgekratzt. Sie ließen mich erstmal nicht weiterziehen. Überwiegend heiter zogen sie den dahergelaufenen Westbürger auf. Sie verglichen ihre Errungenschaften mit Versionen aus dem kapitalistischen Ausland. In der westlichen Warenwelt kannten sie sich besser aus als ich.
mehr

Der Westberliner Chemielaborant (und IM des Berliner Verfassungsschutzes) Tillmann Eisenstein lernt 1984 auf dem Weg zur Leipziger Messe die im Modeinstitut der DDR beschäftigte, aus der DDR-Hauptstadt gebürtige Designerin Arina Nikola kennen. Die beiden verabreden sich für den nächsten Abend im Mitropa-Restaurant des Leipziger Hauptbahnhofs. Da bestätigen sie sich den ersten Eindruck. Die Chemie stimmt. Arina und Tillmann fliegen aufeinander.
mehr

Der beruflich ständig in der DDR beschäftigte und deshalb mit einem Dauervisum versorgte Chemielaborant und Berlin Ranger Tillmann Eisenstein begegnet Anfang der Achtzigerjahre auf einer Fahrt von Westberlin nach Leipzig der Designerin Arina Nikola. Die beiden gefallen einander in ihren Autos: einem Ford Mustang Fastback GT 390 in Dark Highland Green. Steve McQueen strapaziert den Schlitten als Lieutenant Frank Bullitt in der längsten Verfolgungsjagd der Filmgeschichte. Das Auto ist Tillmanns Ein und Alles. Arina cruist im Volvo 244 DL, einem Sondermodell, produziert seit 1977 für die DDR, eingeführt von Genex.
mehr
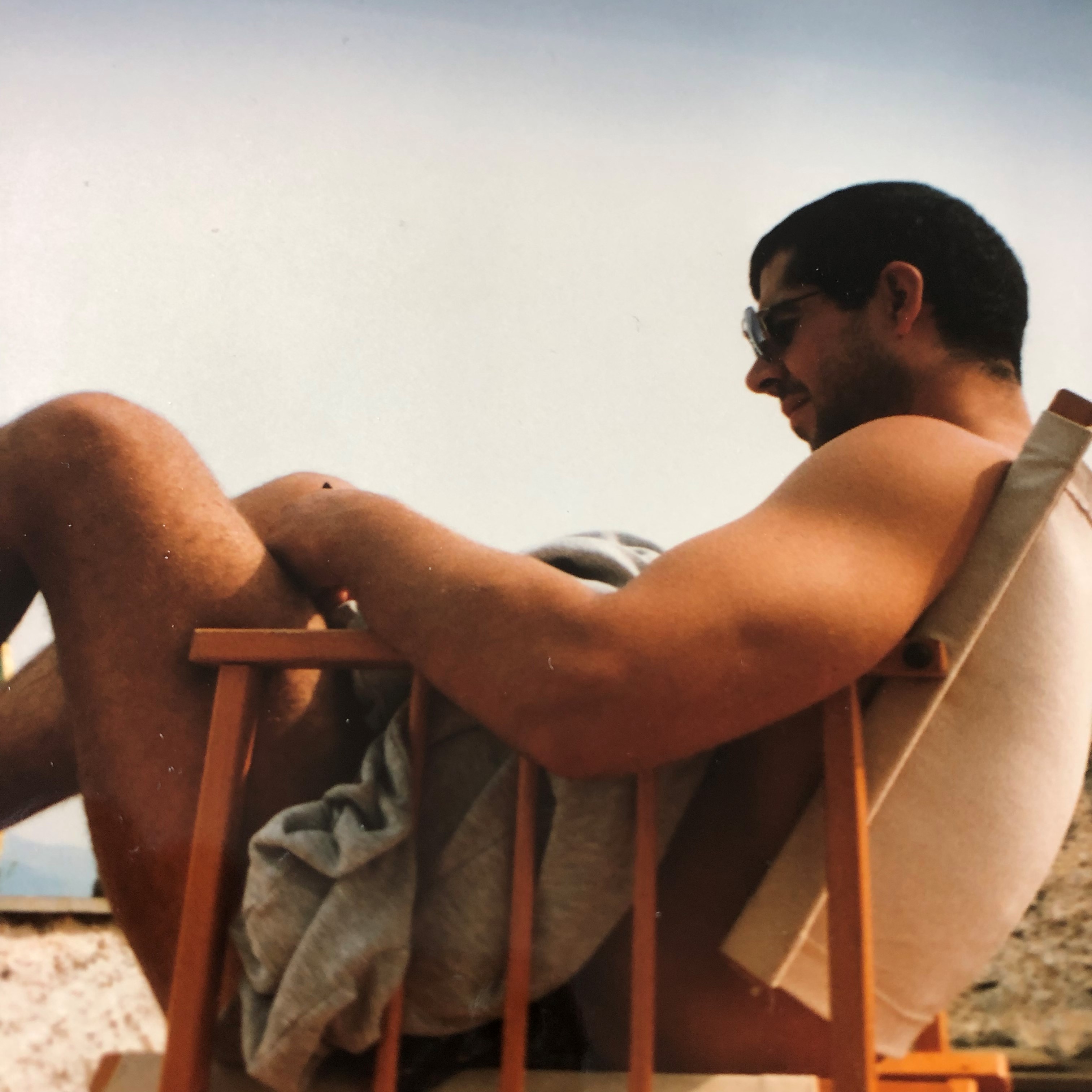
Der .. März 1982 ist ein Samstag, der den Sommer ankündigt. Noch wärmt die Sonne nicht; ein Kaltstrahler am wolkenlosen Himmel. Den Vormittag verbringe ich mit Wochenendbeschäftigungen. Ich drehe meine Runden mit dem Staubsauger, dann werfe ich einen, von jedem Staubkorn abgelenkten Blick in den ...
mehr
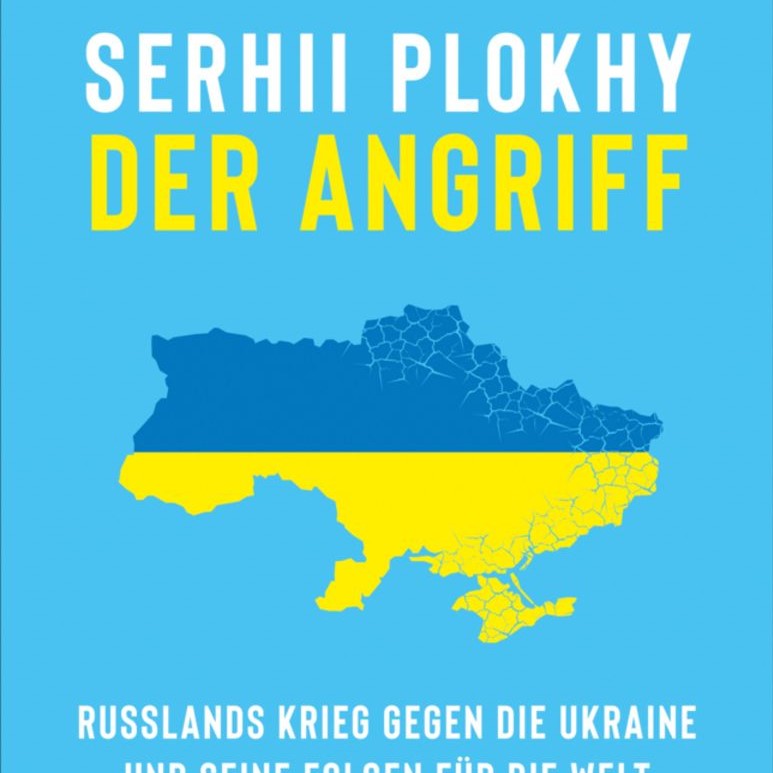
Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und ein Bildungsballungszentrum des Landes. Der Beschuss traf eine russisch geprägte Bevölkerung. Die Russen attackierten Bürger:innen, „die größtenteils Russisch sprechen, auf Russisch denken und auf Russisch träumen“ (Sergej Gerassimow, „Feuerpanorama. Ein ukrainisches Kriegstagebuch“).
mehr

„Es ist ein Jammer, aber ich glaube nicht, dass ich weiterschreiben kann.“
Das notierte Robert F. Scott kurz vor seinem Tod am 29. März 1912 auf dem antarktischen Ross-Schelfeis. Der Polarforscher unterlag dem Norweger Roald Amundsen in einem Rennen zum Südpol. In den ersten fünfzig Jahren nach der ‚heroischen Niederlage‘ stilisierte ihn die Nachwelt zum Helden. Dann begann die Deutungsfrostphase.
“The British ideal of plucky defeat.”
mehr
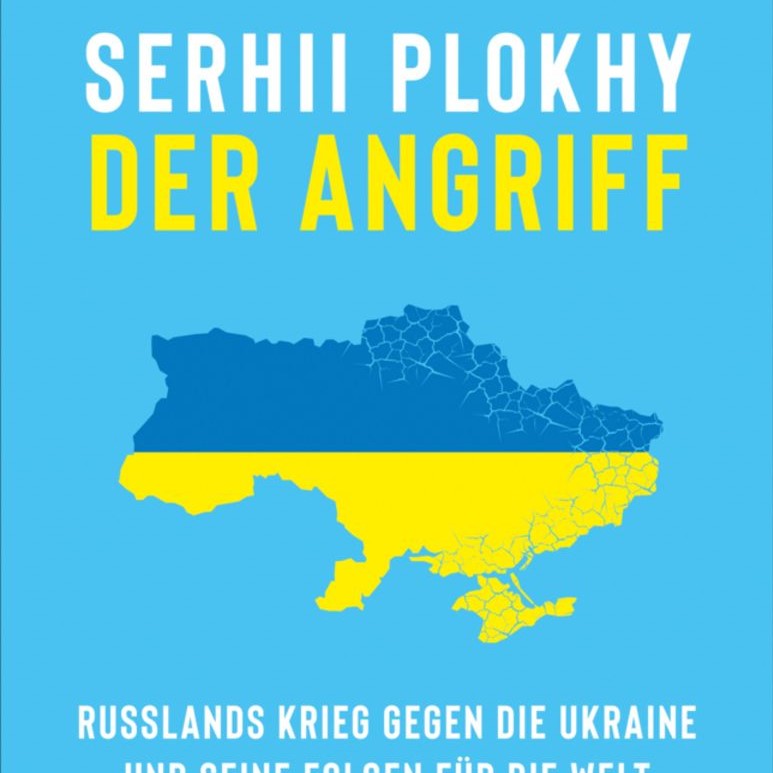
Plokhy schildert Szenen aus der invasiven Frühphase, als überforderte Angehörige des Expeditionsheers sich darüber beklagten, dass sie schon seit mehr als einer Woche im Einsatz waren. Ihre Kommandeure hatten ihnen einen dreitägigen Ausflug in Aussicht gestellt. Das Ziel ihrer Mission kannten sie nicht.
mehr
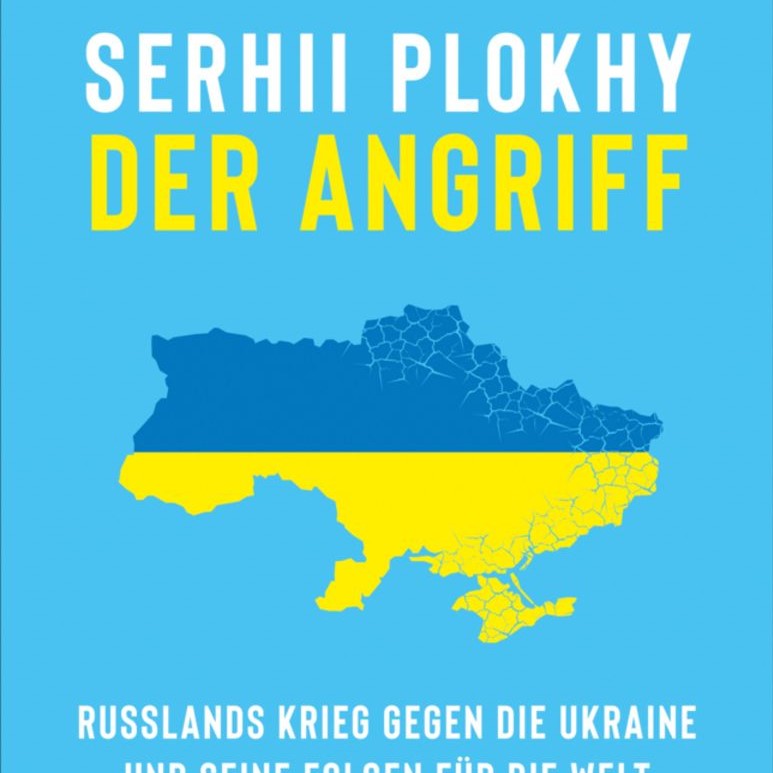
„Der Kampf findet hier statt; ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit.“ Selenskyjs Reaktion auf das amerikanische Angebot, ihn aus Kyjiw zu evakuieren; zitiert nach Serhii Plokhy
mehr
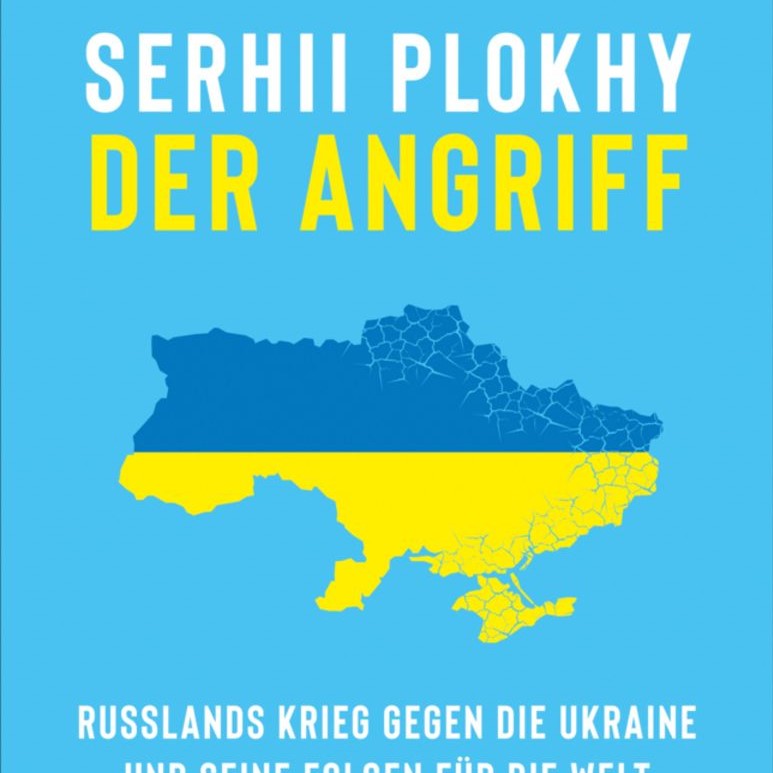
„Die acht Jahre der hybriden Kriegsführung Russlands gegen die Ukraine … verwandelten die Ukraine in ein anderes Land, als sie es 2014 gewesen war, und veränderten auch ihre Gesellschaft.“
mehr
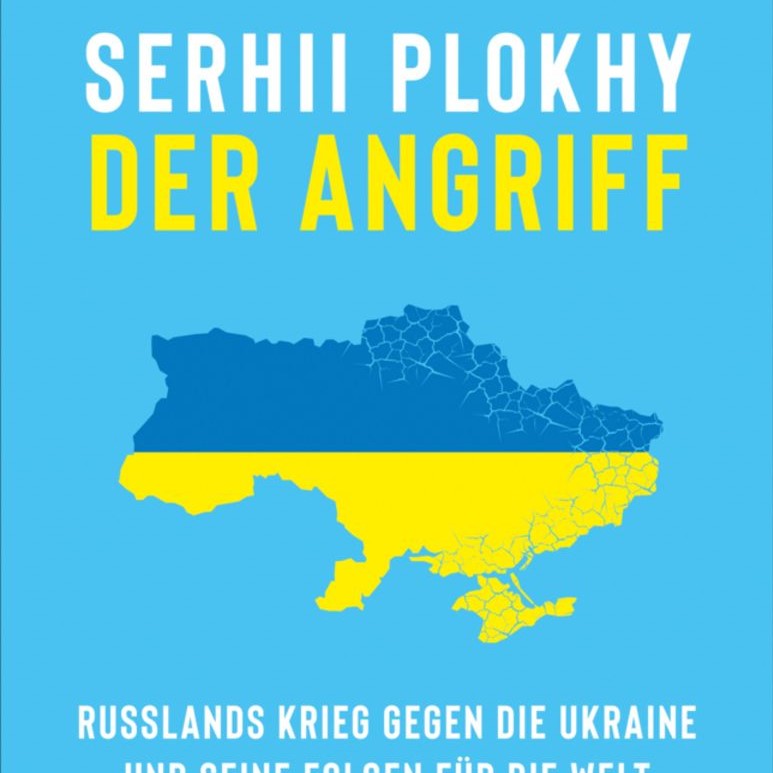
Putin deutet den historisch feststehenden Begriff „Neurussland“ um. Im 18. Jahrhundert bezeichnete das - von Katharina II. deklarierte - Gouvernement Neurussland die schwach besiedelte Gegend nördlich des Schwarzen Meeres. Das Territorium bot sich zaristischen Kolonisierungskampagnen an, die auch einer Befestigung der Grenze zum Osmanischen Reich dienten. In einer ahistorischen Ableitung nutzt Putin „Neurussland“ als Kampfbegriff.
mehr
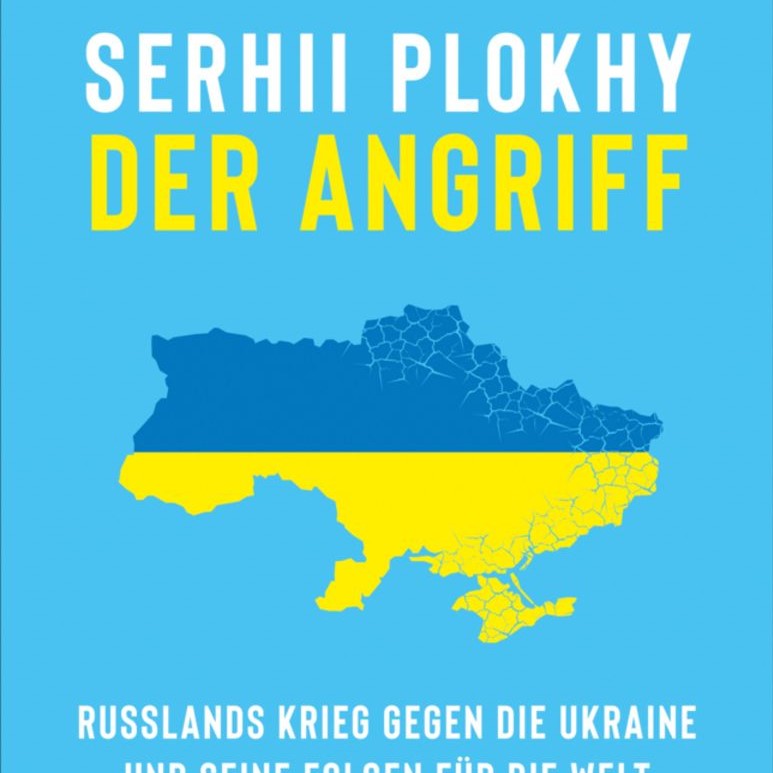
In den ersten Morgenstunden des 27. Februars 2014 stürmen Uniformierte in Simferopol das Parlament der Krim. Die Usurpatoren tragen keine Hoheitszeichen. Ministerpräsident Anatolij Mohiljow interpretiert den Vorgang richtig als machtergreifende Maßarbeit von Spezialisten. Die höchste Autorität der Krim, eingesetzt von dem nach Russland geflohenen, mit Haftbefehl gesuchten, frisch abgesetzten ukrainischen Staatschef Wiktor Janukowytsch, informiert telefonisch eine Regierungsstelle. Kyjiw enthält sich „klarer Anweisungen“. Die Administrator:innen sind quasi seit gestern erst im Amt. „(Sie) haben noch nicht die volle Kontrolle über die Streitkräfte und den Sicherheitsapparat.“
mehr
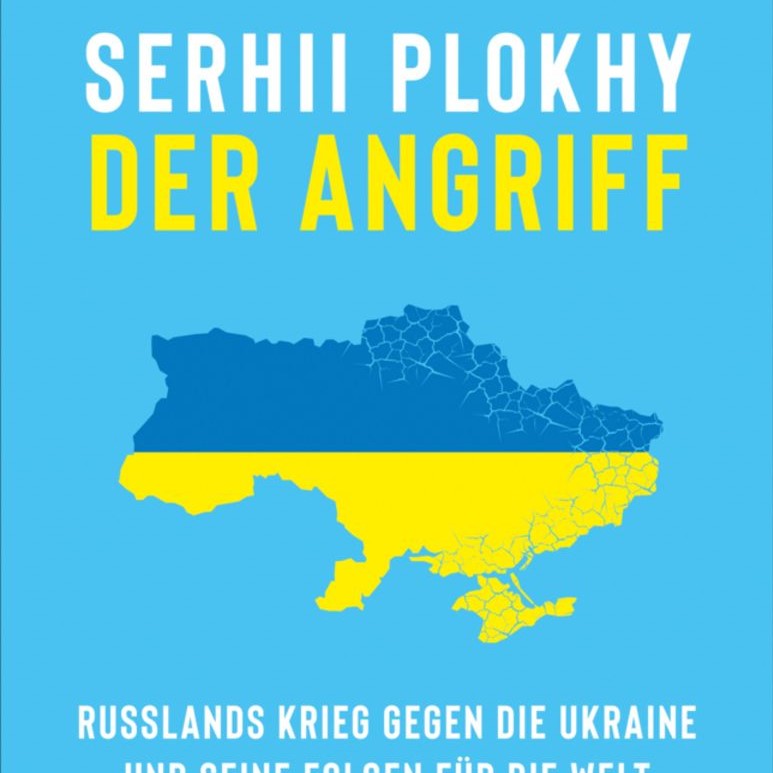
Der Harvard-Professor Serhii Plokhy zählt zu den Supererklärer:innen der Voraussetzungen jener gegen die Ukraine gerichteten, russischen Aggression, die manche Autor:innen als „Konflikt zwischen der Ukraine und Russland“ beschreiben. Auch der ehemalige Bundesrichter und SPIEGEL-Kolumnist Thomas Fischer deutet das einschlägige Verhältnis als „Konflikt der Ukraine mit Russland“.
mehr
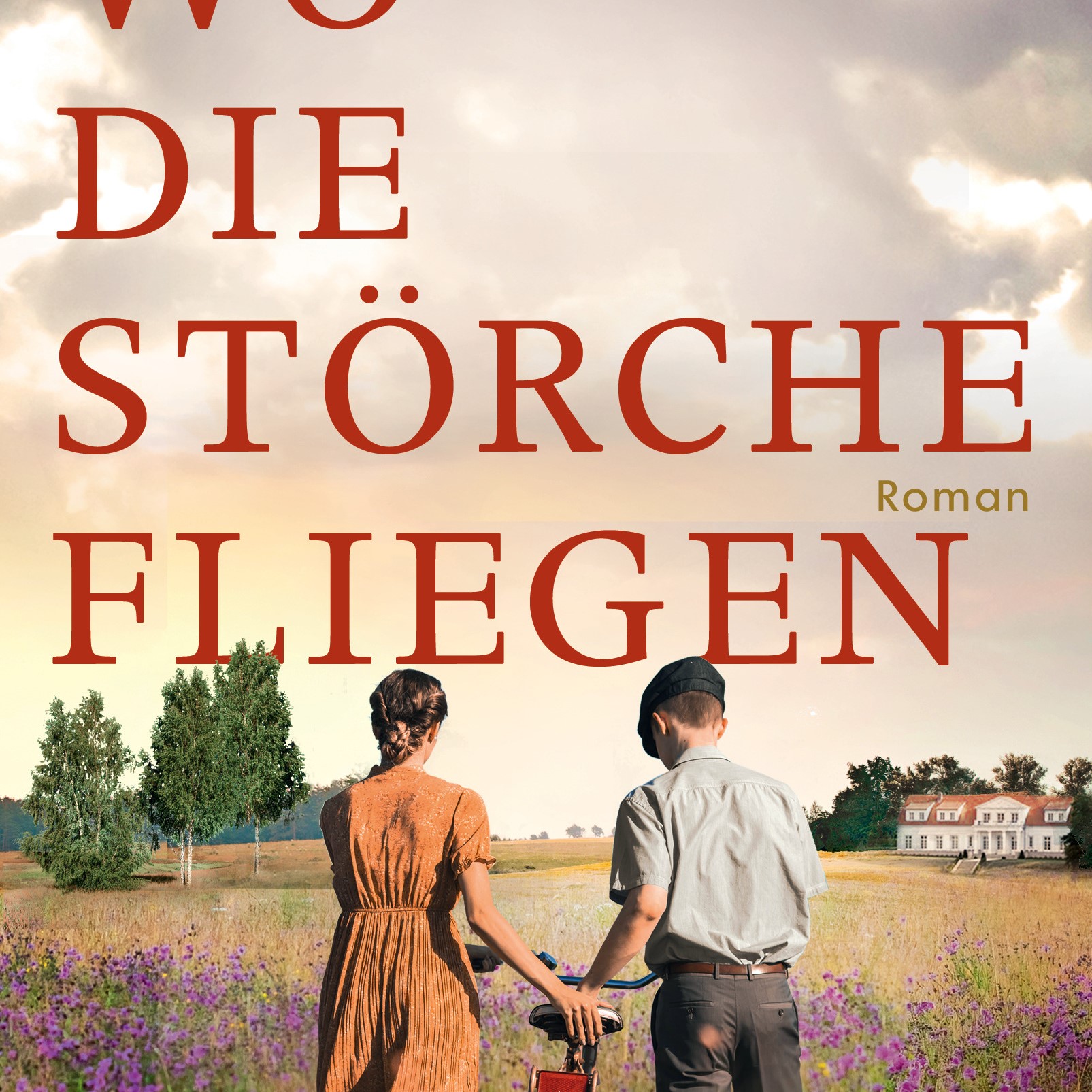
Zum Gut des Barons Dietrich von Westkamm gehören „Felder und Wälder bis zum Horizont“. Die Gutsherrntochter Gerda wächst in einem amerikanisch oder australisch dimensionierten Großbetrieb auf; isoliert gelegen in den Weiten Westpreußens. Das drei Zugstunden von der Provinzkapitale Danzig entfernte, protestantische Kirchspiel Lapienen gibt dem Anwesen seinen Namen.
mehr
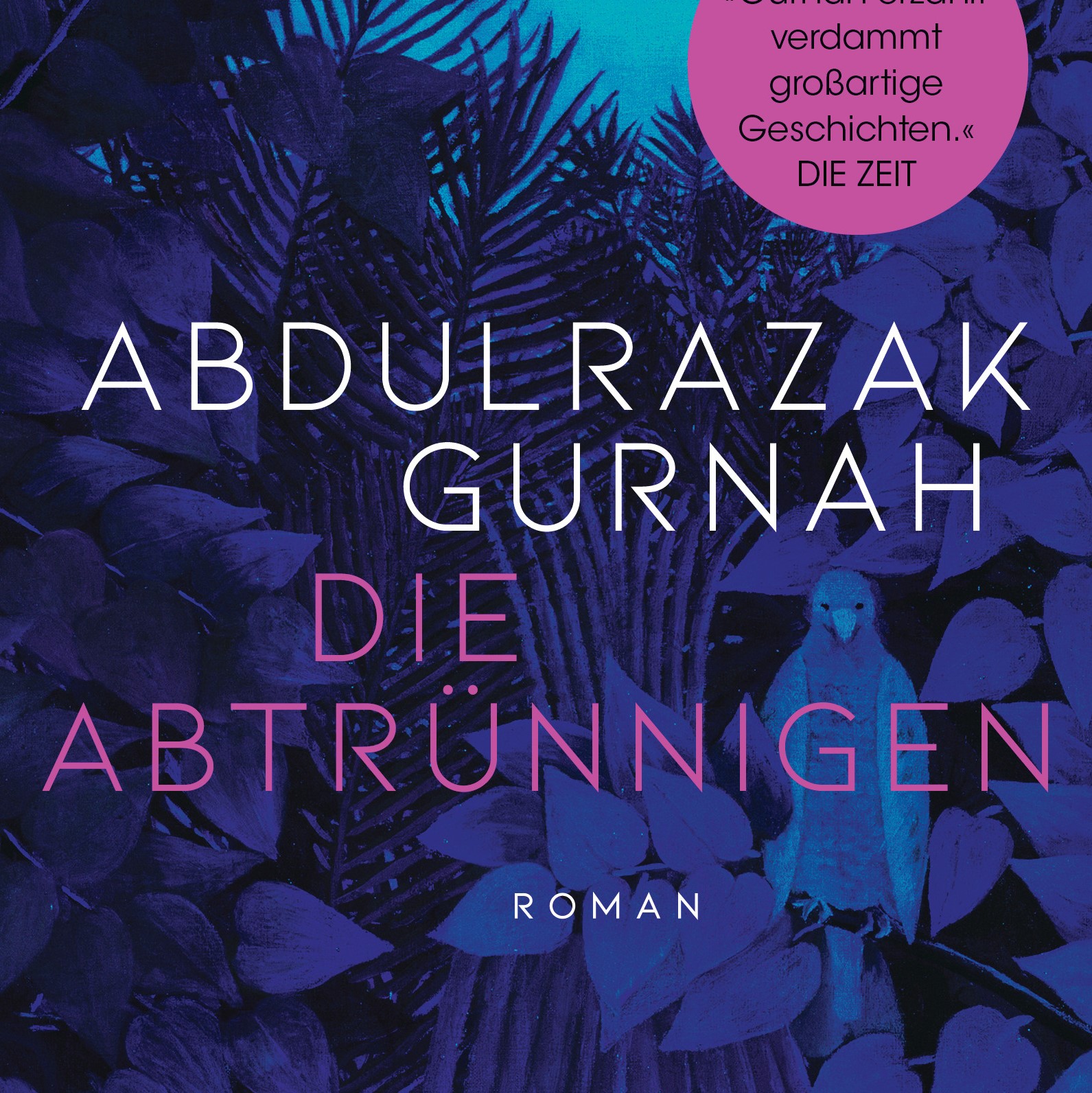
Mombasa 1899. Viele Bürger:innen haben noch nie einen Weißen gesehen. Sie werden von Leuten beherrscht, ausgebeutet und geringgeschätzt, die weit jenseits ihres sozialen Horizonts existieren. Zwei Briten repräsentieren vor Ort das Empire. Als Vertreter seiner Majestät fungiert Frederic Turner an erster Stelle.
mehr
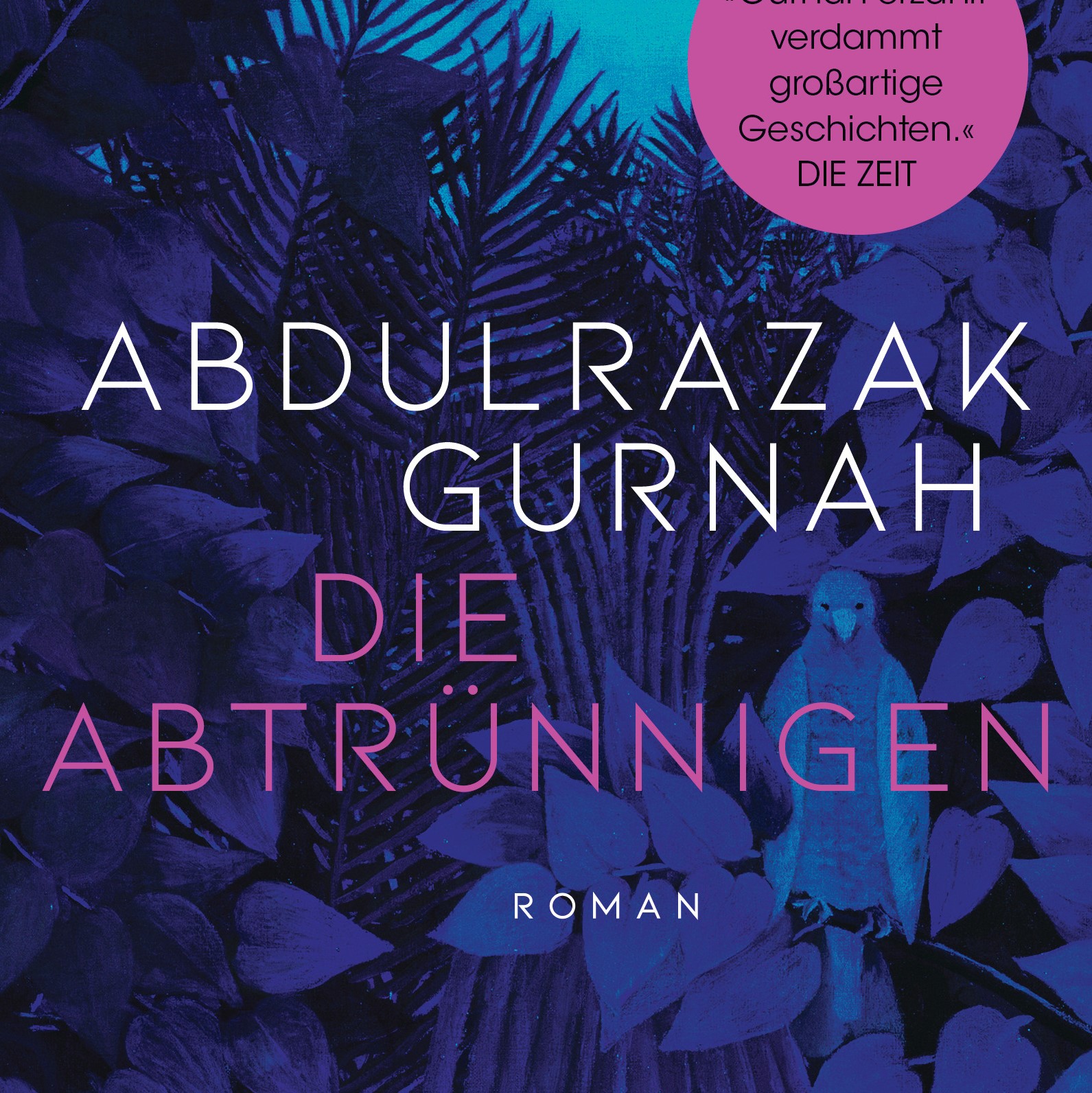
Jeden Morgen eröffnet Hassanali den Moscheebetrieb. Er reinigt die Stufen zum Gotteshaus und ruft die Leute zum Gebet. Gewissenhaft versieht der Krämer sein Muezzin-Ehrenamt. Eines Morgens findet Hassanali auf dem Platz seiner anspruchsvollsten Wirkung ein erschöpftes Gespenst, das bald seine dämonische Dimension verliert und sich als ein heruntergekommener, im Augenblick ohnmächtiger Europäer entpuppt.
mehr
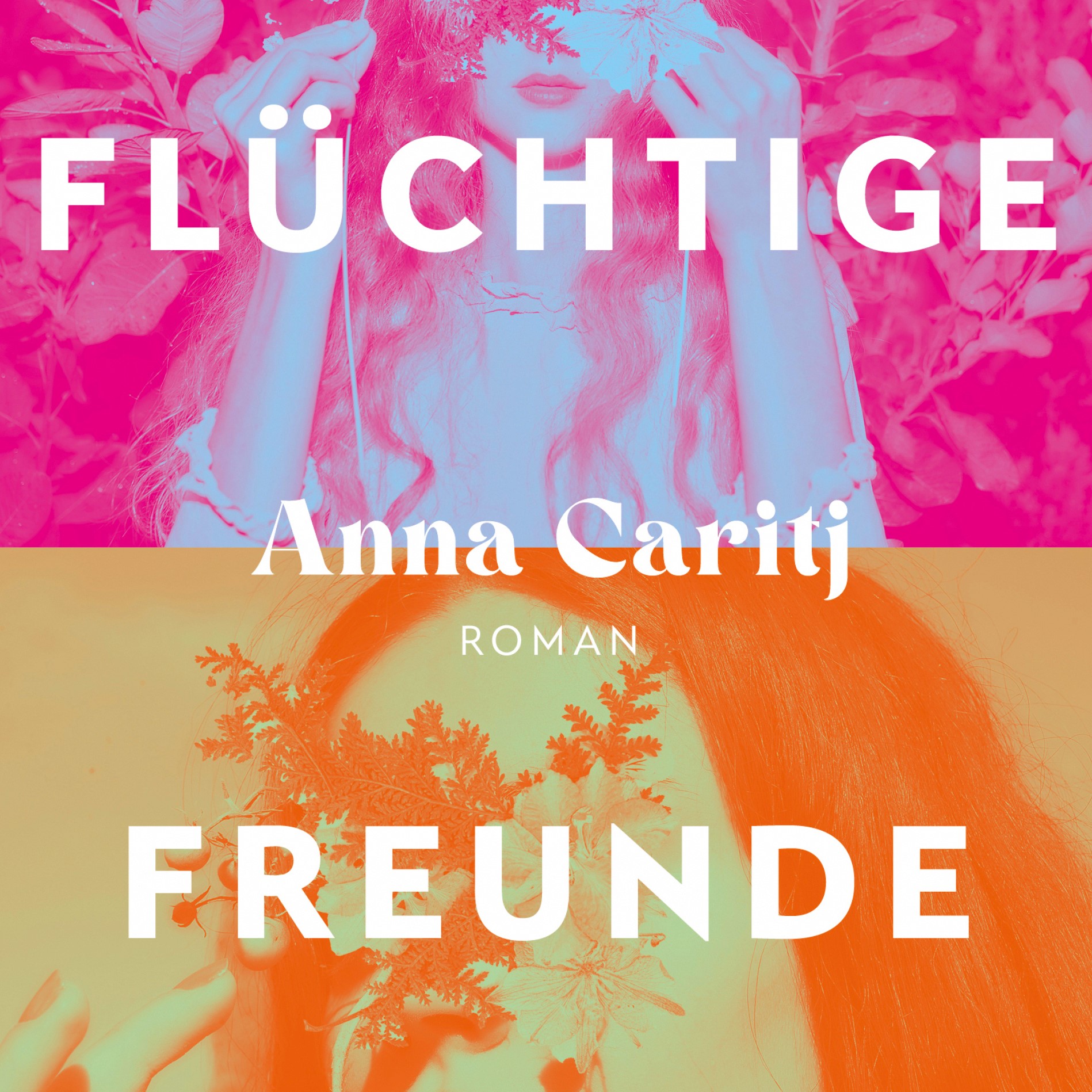
Sexistische, mit rüdem Selbstverständnis perpetuierte Camp-Codes irritieren Leda. Sie prüft die Valeurs, entschlossen jede unbestreitbar erforderliche Anpassung an die herrschenden Verkehrsformen zu vollziehen. Aufgewachsen mit einer alleinerziehenden, im Handlungsjetzt vor drei Jahren verstorbenen Mutter, unterstellt sich Leda auf der ganzen Linie soziale Defizite. Ständig bezweifelt sie ihre Kompetenz.
mehr
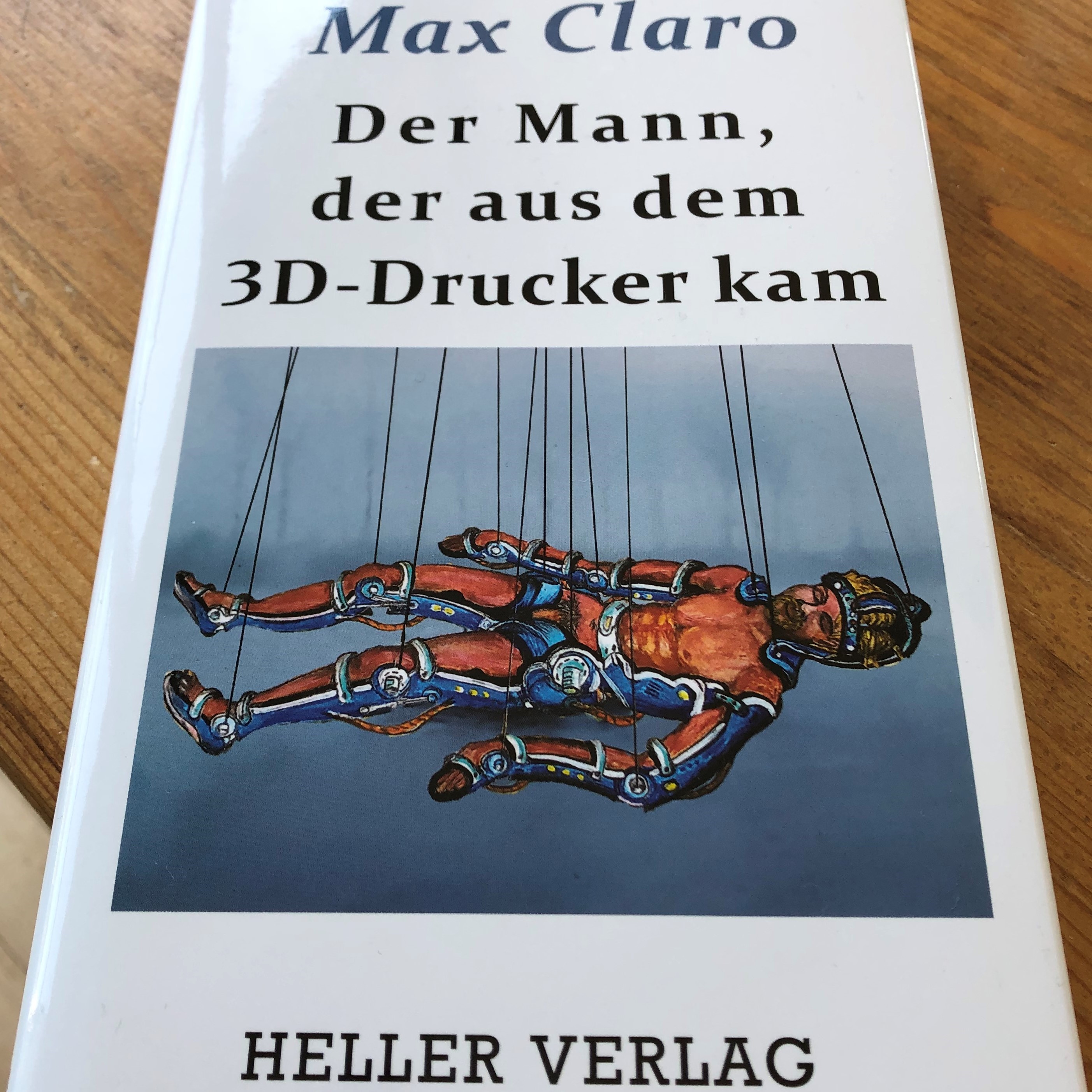
Im Alter von siebzig Jahren beschließt der 1990 in Gmund am Tegernsee geborene Walter Fabricius, seinem Leben ein selbstbestimmtes Ende zu setzen. Die Hemingway-Lösung verwirft er, weil er seinen Kindern nicht zumuten möchte, das väterliche Hirn „von den Wänden zu kratzen“.
mehr
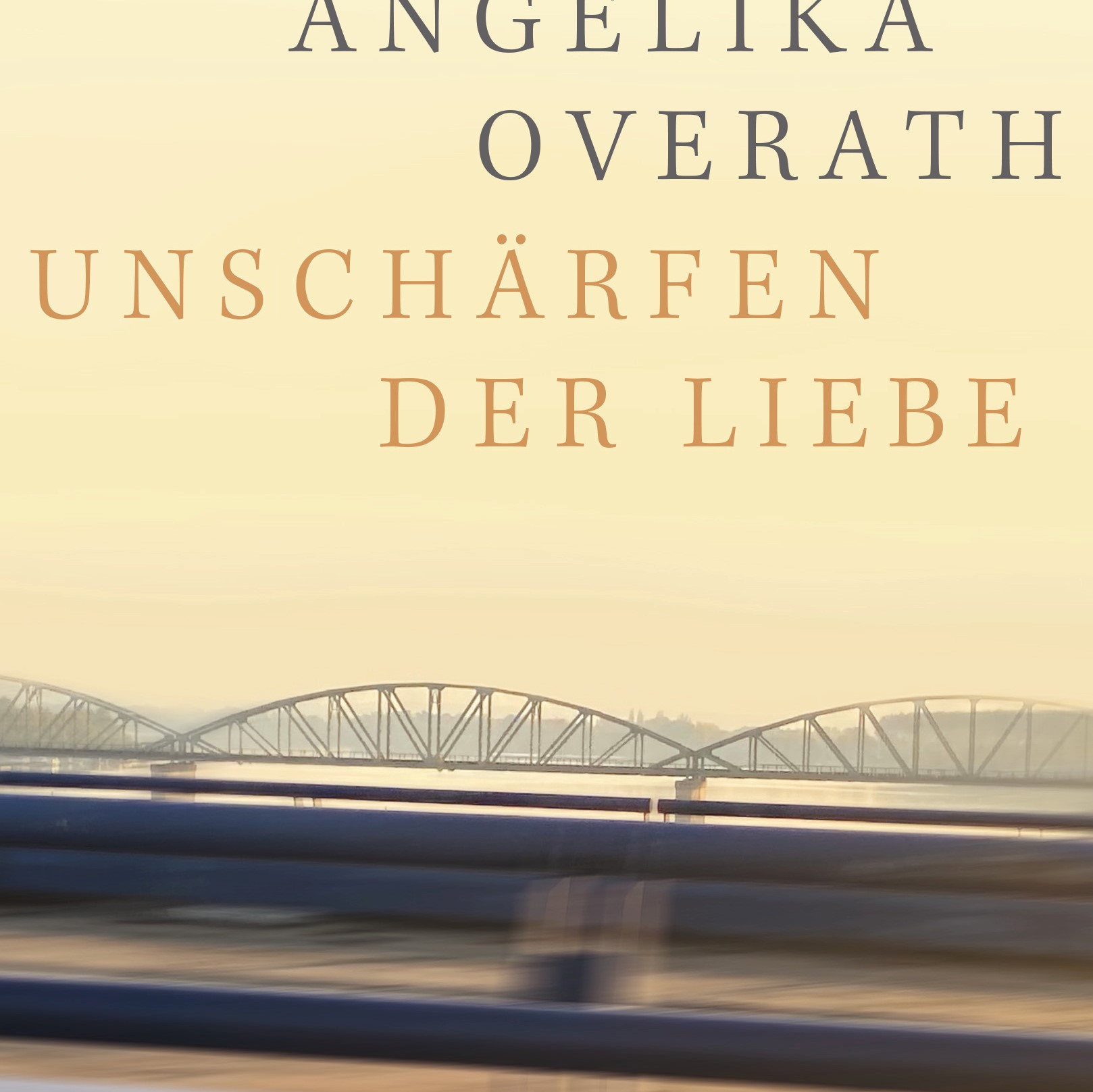
In einer elegischen Verdichtung bedenkt Baran die ruinöse Verfassung seiner Verhältnisse. Ein eskapistischer Lebensentwurf vergammelt in der rissigen Hülle der fortgeschrittenen ersten Lebenshälfte.
mehr
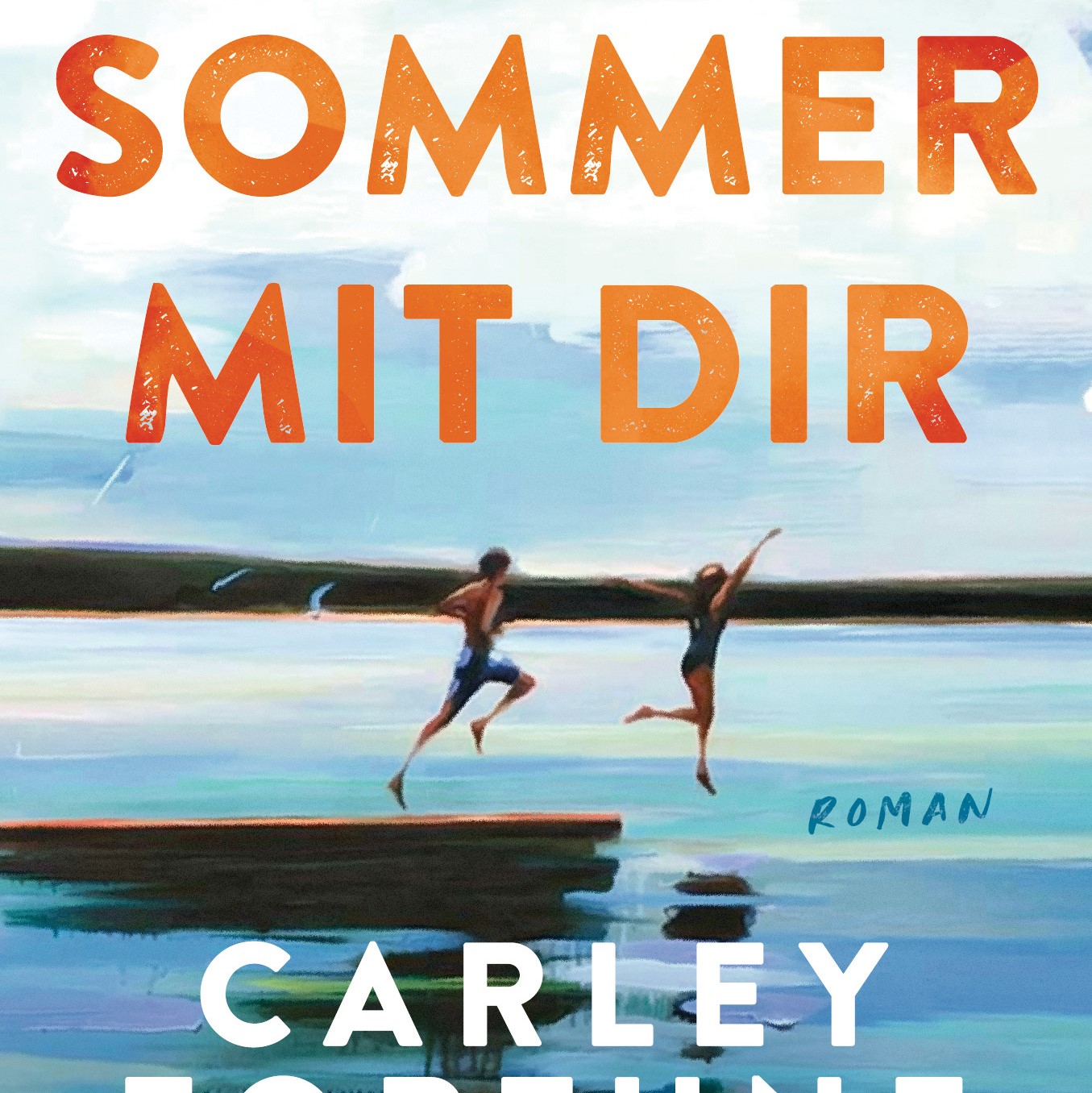
Gemeinsam navigierten sie durch die Untiefen des pubertären Begehrens. Persephone Fraser aka Percy aka Pers aka P. und Samuel ‚Sam‘ Florek entdeckten und erkundeten die Liebe vor allem im Rhythmus und in den Routinen von Percys Sommerferien. In der Retrospektive verschmelzen die sonnigen Auszeiten zu einem ewigen Sommer der Liebe.
mehr
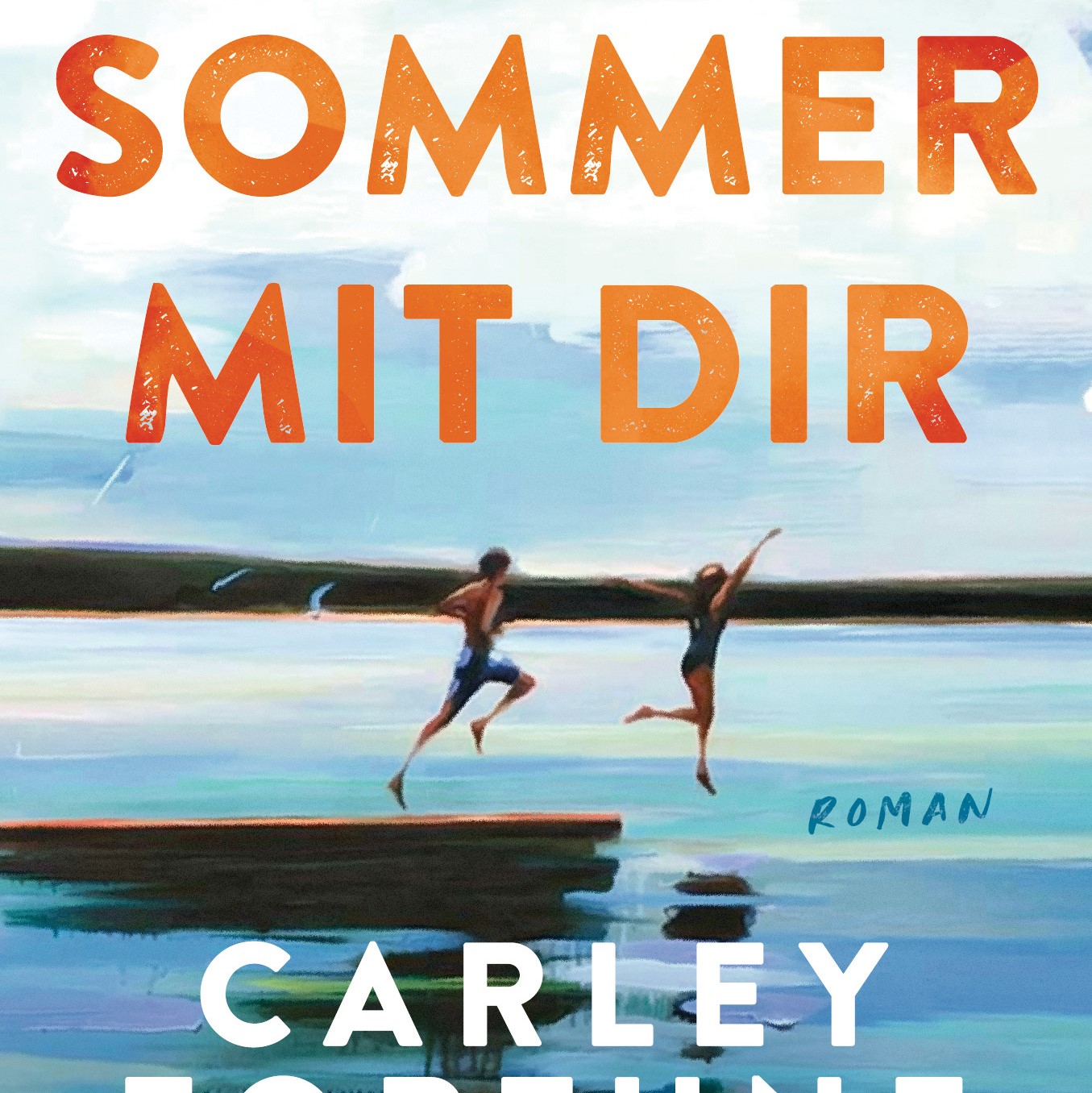
Persephone - Zweifellos haben sich die Eltern bei der Namensgebung etwas ungeheuer Ambitioniertes gedacht: Die mythische Persephone ging aus einer göttlichen Inzestzeugung hervor. Demeter, ihre vielleicht nicht ganz so bekannte Mutter, verdankt sich einer erotischen Kollision der Titanen Kronos und Rhea. Kronos war dafür berüchtigt, seine Nachkommen zu fressen. Das gelang ihm nicht in jedem Fall. Persephone entstand in der geschwisterlichen Verbindung von Demeter und Zeus. Folglich steht Persephone für Power im göttlichen Maßstab.
mehr
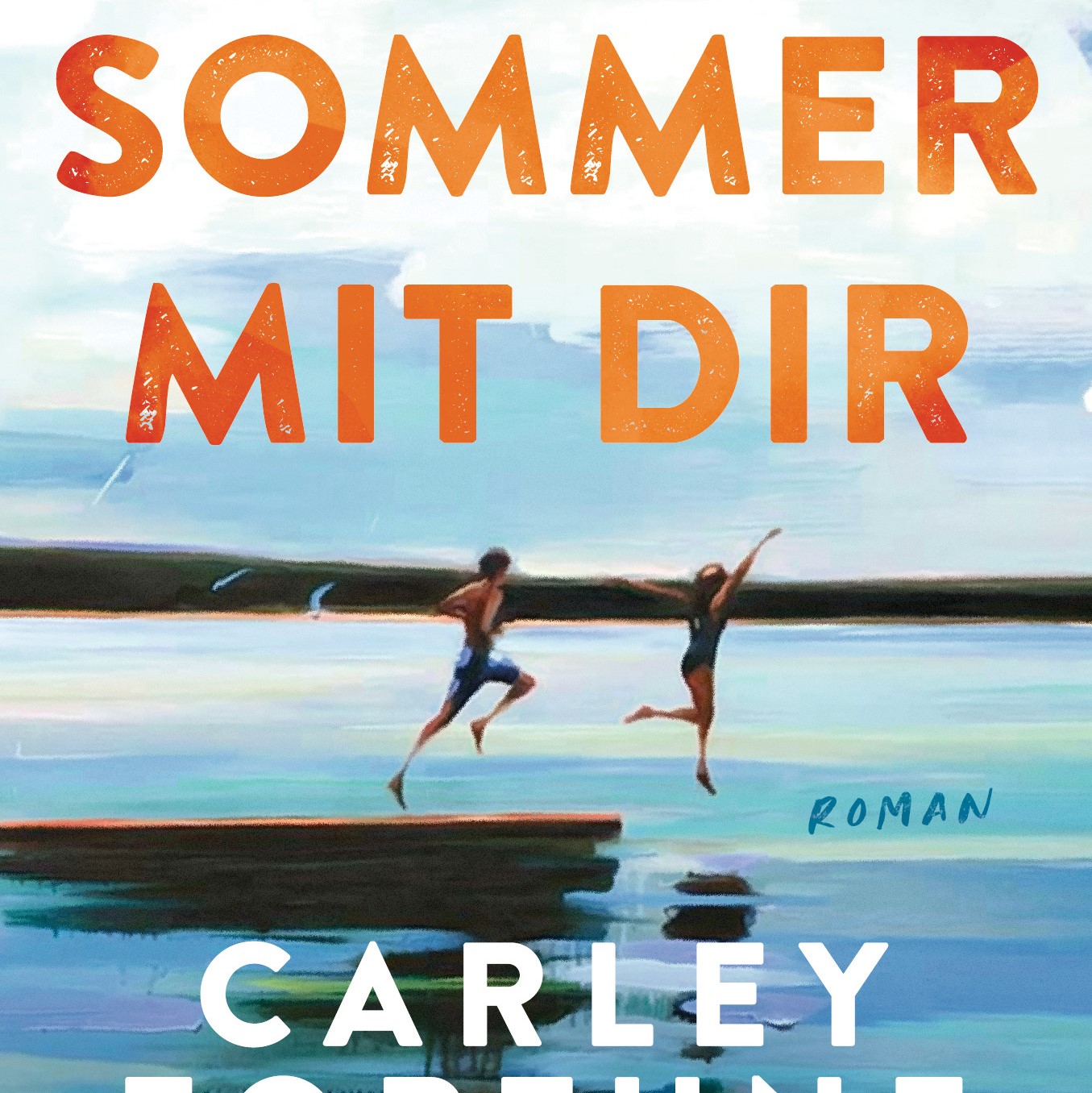
Ein trauriger Anlass führt Persephone an einen Sehnsuchtsort ihrer Jugend. Sie fährt zur Beerdigung von Sue Florek nach Barry’s Bay. Telefonisch informiert vom Tod seiner Mutter wurde sie von Charlie. Der Anruf vom falschen Bruder beendete eine Funkstille von zwölf Jahren. Er rüttelte an Persephones existenziellen Grundfesten. Die Dreißigjährige war nie länger als sieben Monate mit einem Mann zusammen. Sie lässt es gern locker angehen. Ab und zu braucht sie eine „Abwechslung von ihrem Vibrator“.
mehr

Teichmann schläft beruflich mit einer hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiterin. Die leidenschaftliche Tschekistin und promovierte Psychologin Inge Schneider verkehrt nicht genauso professionell mit dem West-Romeo. Bis über beide Ohren ist sie in den (in Texas geborenen und in Frankfurt am Main aufgewachsenen) Superlover aus dem Westen verliebt. Inge unterwandert gemeinsam mit ihrem (echten) Ehemann Klaus, genannt ‚Nico‘, die Pankower Kunst- und Kulturszene. Das Ehepaar I. und K. Schneider, wohnhaft in der Dimitroffstraße, unterhält einen der exklusivsten Ostberliner Salons.
mehr

Der junge Heiner Müller schreibt Gedichte, wenn ihm für dramatische Arbeiten der Atem fehlt. Die poetische Produktion hat eine gymnastische Funktion. Müller als Akrobat Schön. Er turnt auf der Grammatikmatte. Er exekutiert Streck- und Dehnübungen. - Aufschwünge und pointierte Abgänge. Das alles stets vor dem Hintergrund eines antiken Prospekts wie vor geträumten Alpen.
mehr

Eine Sächsin zeigt mir ihr Berlin. In der Rückerklause am Rosenthaler Platz hängen Jungen und Mädchen aus allen mitteldeutschen Provinzen ab. Sie haben das Nachtasyl im Blut. In Berlin klumpen sie sich zu einem Haufen und saufen. Sie sind auf Trebe und machen Platte, obwohl es das in der DDR gar nicht gibt. Doch gibt es da nomadische Zustände und eine Poesie für Stromer:innen aus Passion. Oft sind sie Heimen entsprungen und bis zur Flucht vom Gruppendruck der Schlafsäle unsanft erzogen worden.
mehr

Am liebsten trieben sich Studiosos Collegii Carolini im Reinhardswald und in anrüchigen Randgemarkungen herum. Da lagen Wüstungen schon lange in ritterlicher Schwermut brach- und danieder. Zerfallene Kirchen und Burgen - die Studierenden gingen in Ruinen auf Sauenhatz. Sie jagten mit schrecklichen Hunden, wahren Bestien, die mit dem wilden Dasein liebäugelten. Nach alter Art jagten die Studierenden mit Lanzen. Sie gingen sich gegenseitig an die Gurgel in der Festlichkeit eines andauernden Rausches.
mehr
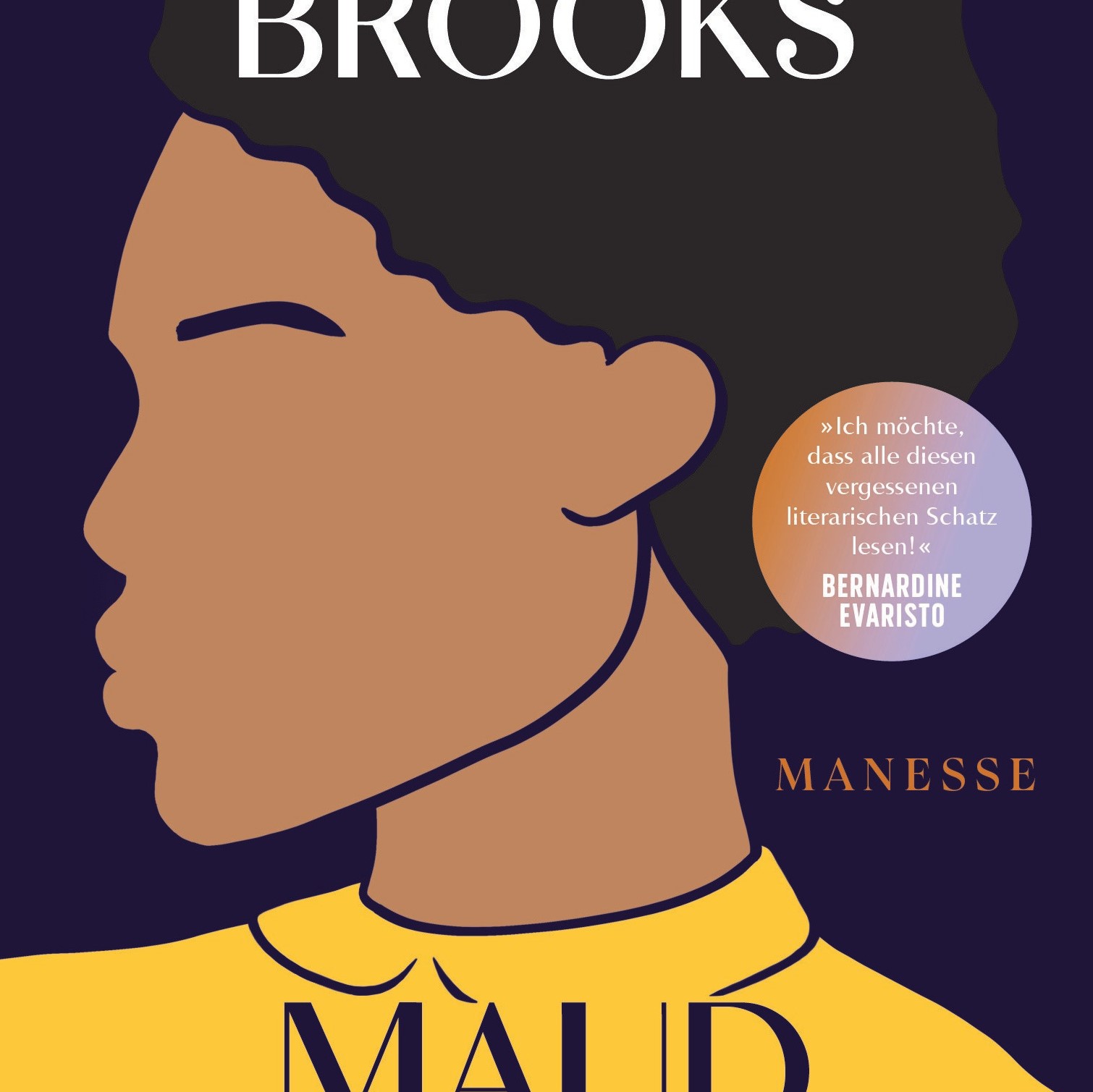
Gwendolyn Brooks (1917 - 2000) erzählt die erstmals 1953 veröffentliche, in den 1940er Jahren angesiedelte Geschichte von Maud Martha in ergreifenden Miniaturen, die an Votivmalerei erinnern. Zum Zeitpunkt der Niederschrift verkörperte die Autorin den Stolz und die Emanzipationserwartungen vieler Schwarzer Amerikaner:innen. Drei Jahre zuvor war Brooks‘ - als erste Schwarze Dichterin - mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden.
mehr
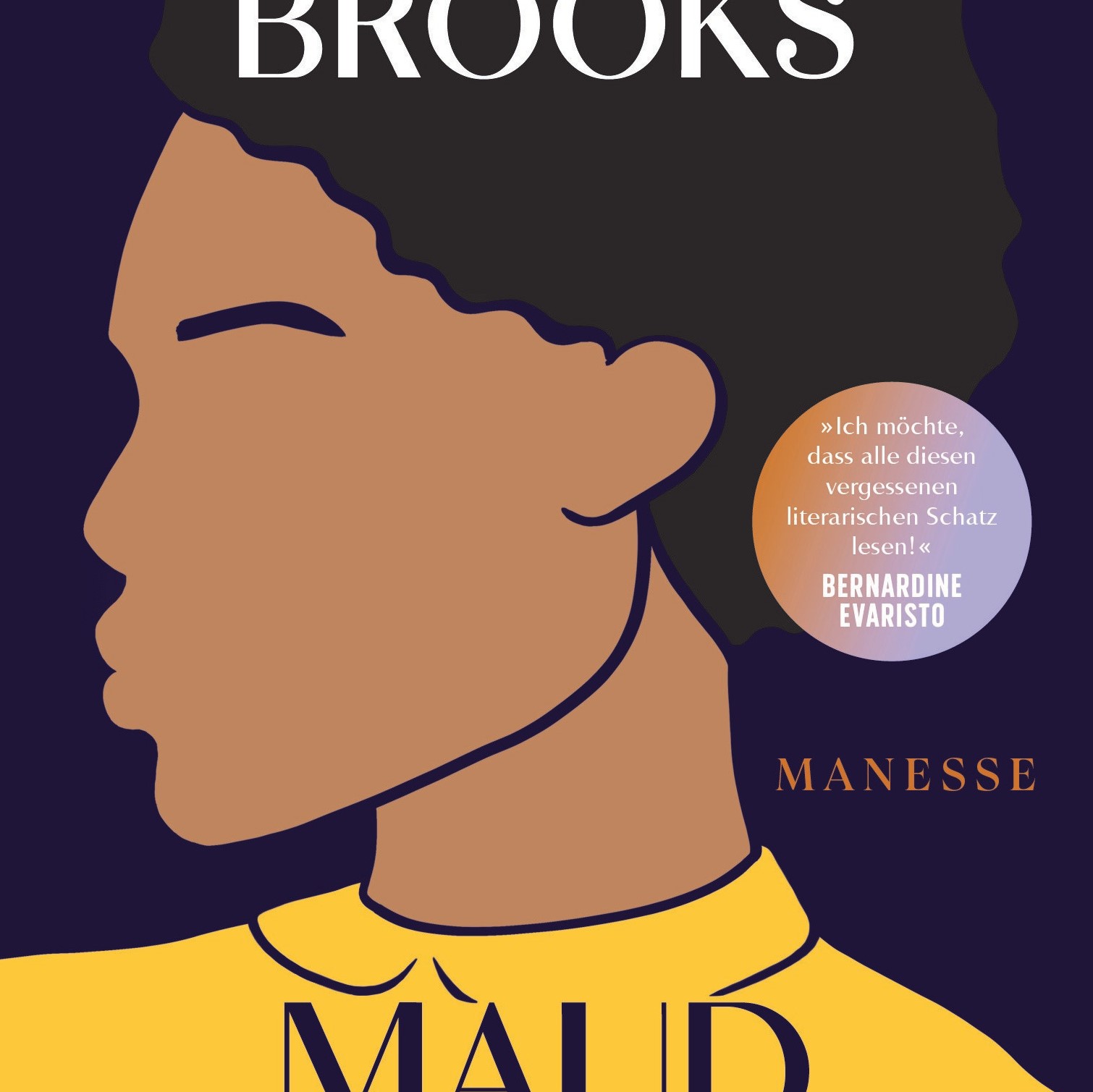
“I’m from the south side of Chicago. That tells you as much about me as you need to know.” Michelle Obama
mehr
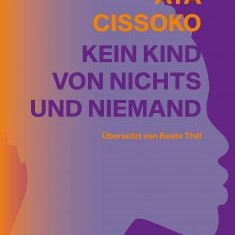
Wieder und wieder beschwört die Autorin den Namen ihrer Mutter - Massiré Dansira. Deren Geburtsdorf - Kakoro Mountan - erscheint als verlorenes Paradies und Schauplatz einer verlorenen Zeit der eindeutigen Bambara-Identität; obwohl die Ursprungskultur von den französischen Kolonisatoren in einer permanenten Abwertungskampagne geschwächt wurde. „Die Sieger hatten die Geschichte umgeschrieben.“
mehr
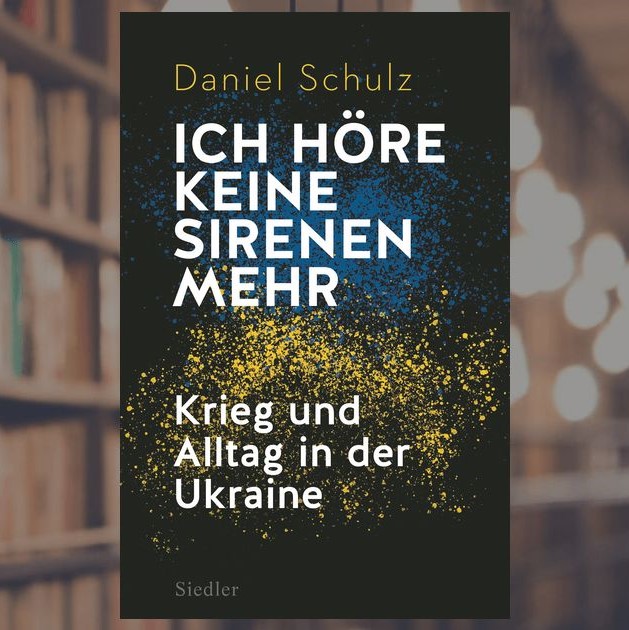
„Time“ handelt Olga Rudenko als „Next Generation Leader“. Das amerikanische Nachrichtmagazin widmete der ukrainischen Journalistin eine Coverstory. Im Mai 2022 trifft Schulz den publizistischen Shooting Star in Kyjiw. Die Chefredakteurin der Kyiv Independent, einer Sezession der Kyiv Post, gilt als Garantin einer quellenbasierten, streitfest recherchierten Berichterstattung. Aktivistischem Haltungsjournalismus bietet ihr Periodikum kein Forum. „Wir erlauben es uns selten, emotional zu werden.“
mehr
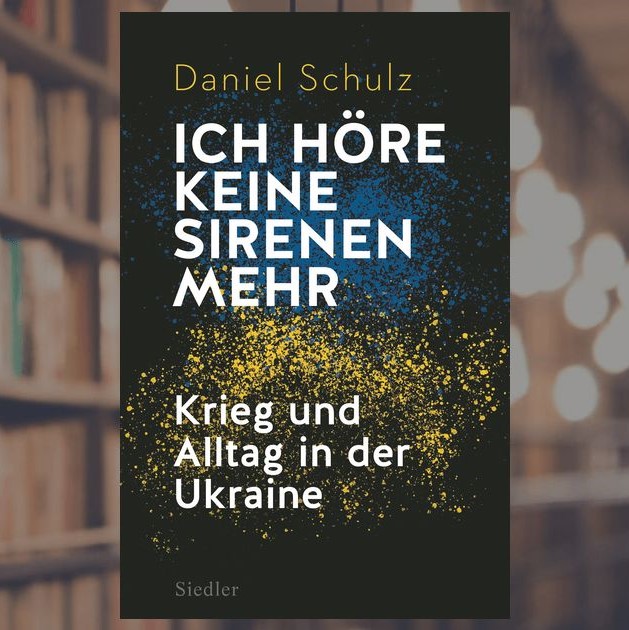
Ihn interessiert „der Alltag des Krieges abseits der Kämpfe“. Seinen ersten Alarm - als einer peripheren Folge von Vladimir Putins „Spezialoperation“ - erlebt der Journalist Daniel Schulz am 7. März in Tscherniwzi. Die Bevölkerung der weit vom Schuss im Westen der Ukraine gelegenen Stadt, reagiert indifferent. Schulz schlägt vor, einen Bunker aufzusuchen. Ihm wird erklärt, dass es keine Bunker gibt.
mehr
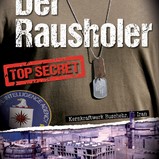
Da Nang im Dezember 1971. Michael Miller, ein in München geborener Fallschirmjäger, Einzelkämpfer und Sanitäter der 101st Airborne Division, begegnet Captain Winslow „Barry“ Meeker in einem Zelthospital. Ohne Einsicht in die bevorstehende amerikanische Niederlage strebt Barry zurück an die Front. Fast zwei Meter groß, raucht und trinkt der polyglotte, zweimal angeschossene, mit einem donnernden Ego gesegnete Hubschrauberpilot alle Teufel unter den Tisch, um „auch noch nach zehn Dosen Bier stocknüchtern“ aus dem „Steppenwolf“ zu zitieren.
mehr
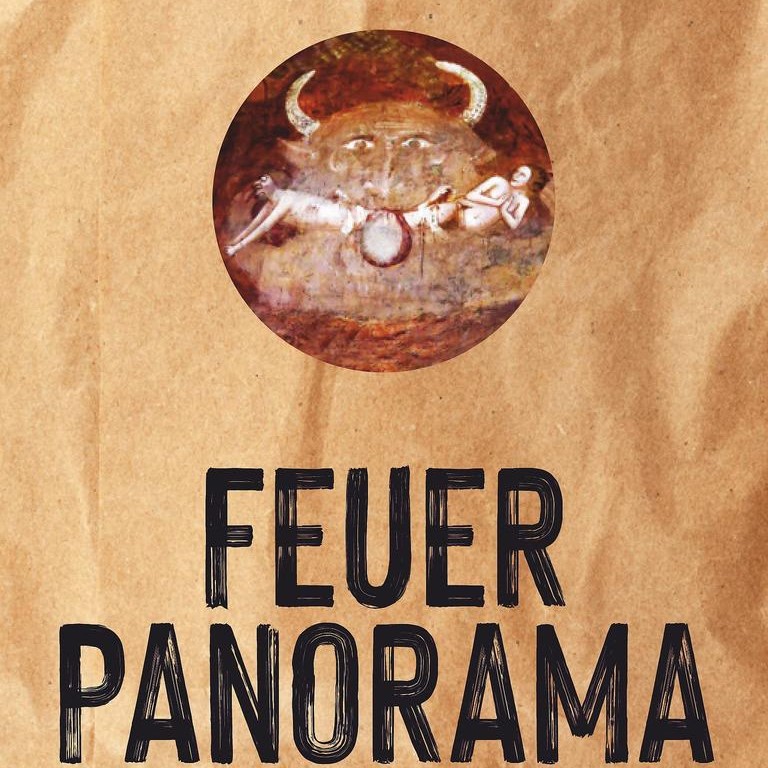
Schnell ändern sich die Routinen. Die Belagerten avancieren zügig zu Kenner:innen der Kriegsmaterie. Eben noch waren sie vollkommen zivil. Jetzt weiß Sergej Gerassimow, wo der Hase im Pfeffer liegt, wenn ein Mann erzählt, dass sein Haus von einer Rakete getroffen wurde, die zum Glück nicht explodiert sei; aber trotzdem „drei Stockwerke durchschlagen habe“.
mehr
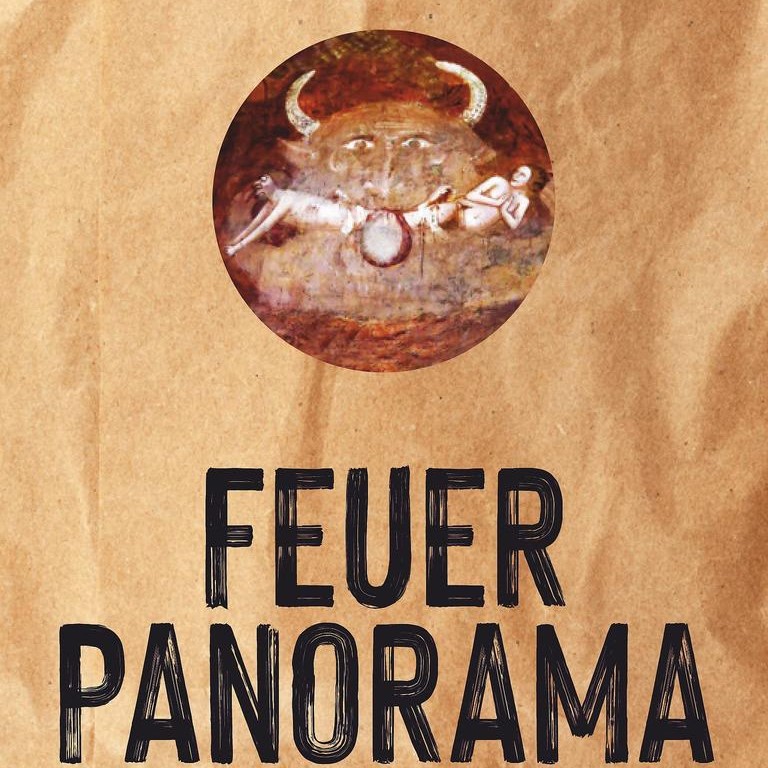
Entgangen zu sein scheint Sergej Gerassimow, dass er auch von einem Namensvetter angegriffen wurde. Auf der anderen Seite des Geschehens agierte Witali Petrowitsch Gerassimow im Rang eines Generalmajors als stellvertretender Kommandeur der 41. Armee.
mehr
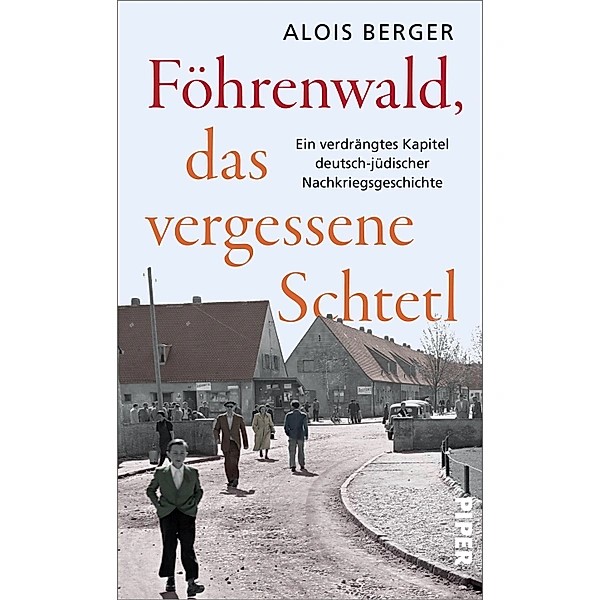
In Föhrenwald nutzte die Haganah eines ihrer ureigensten Kampfmittel. Deutschstämmige Kombattant:innen konnten mit den Verhältnissen vor Ort verschmelzen. Denken Sie an die orientalische Variante - die Mista'aravim. Das war zunächst eine Weiterentwicklung jüdischer Selbstverteidigungsformate im Geist von HaSchomer, der im frühen 20. Jahrhundert im osmanisch beherrschten Palästina als „Wächter“ agierte und als Vorgänger der Haganah historisch wurde.
mehr
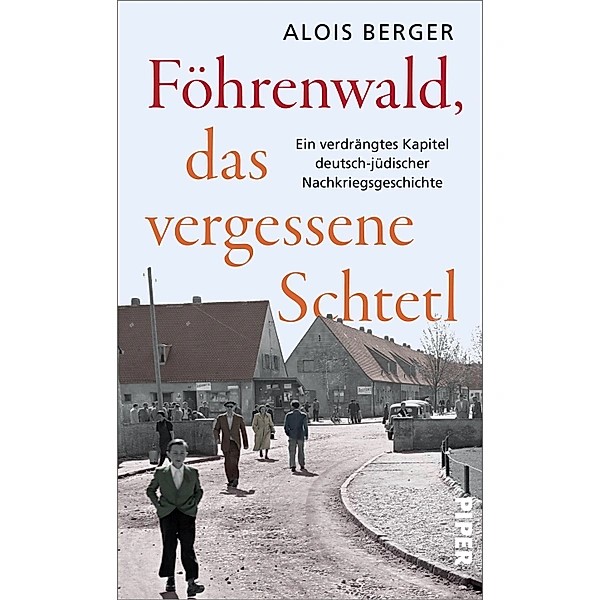
Das als letztes Schtetl Europas in die Geschichte eingegangene Displaced-Persons-Camp Föhrenwald (in Wolfratshausen) war die Schrumpfversion eines jüdischen Freistaats im Freistaat Bayern. David Ben Gurion hatte 1945 vom amerikanischen Militärgouverneur Dwight D. Eisenhower für die Sh'erit ha-Pletah, die Shoa-Überlebenden, einen Landstrich als eigenstaatlichen Raum gefordert. Die Enklave sollte als Reparationsleistung verstanden werden.
mehr
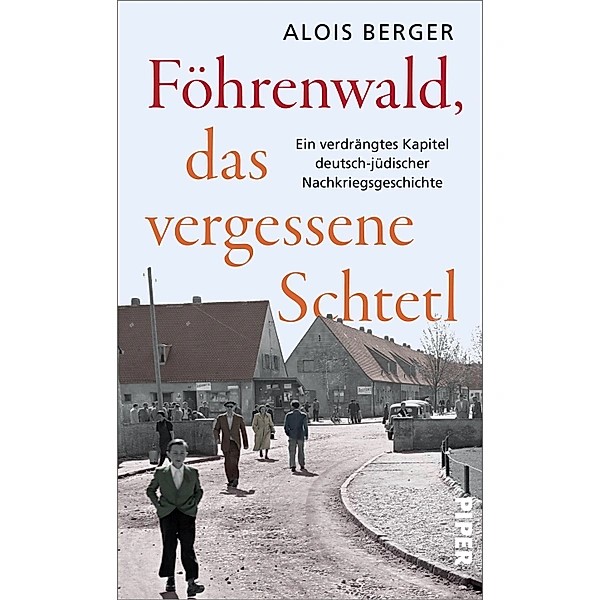
“Security will not exist if our nation’s women to not know how to fight.” David Ben Gurion
mehr
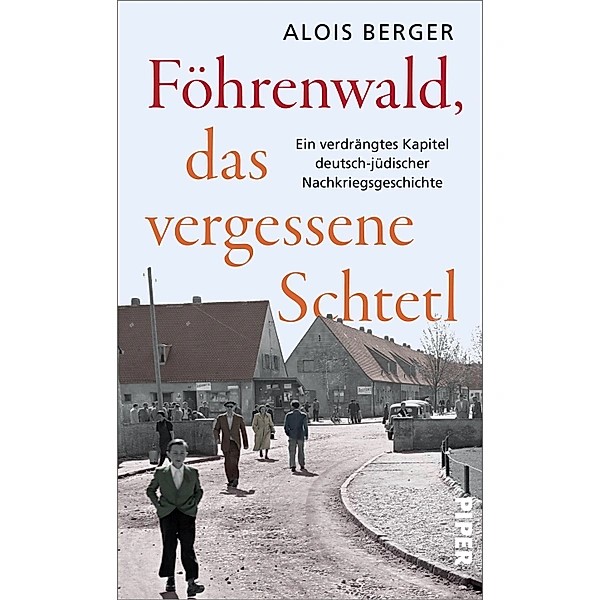
Alois Berger verschränkt die Geschichte des oberbayrischen Displaced-Persons-Camps Wolfratshausen-Föhrenwald mit seiner eigenen Biografie. Er wuchs in Wolfratshausen auf. In seiner Kindheit und Jugend entging ihm die mehrheitsgesellschaftliche Überformung einer historischen Präzedenz im Holocaustkontext. In der Konsequenz administrativer, von der katholischen Kirche dynamisierter Strategien wurden städtische Schicksalsspuren von Shoa-Überlebenden dem Vergessen anheimgestellt. Einvernehmlich breiteten die Bürger:innen den Mantel des Schweigens über ein Kapitel ihrer Stadt- und Schuldgeschichte.
mehr
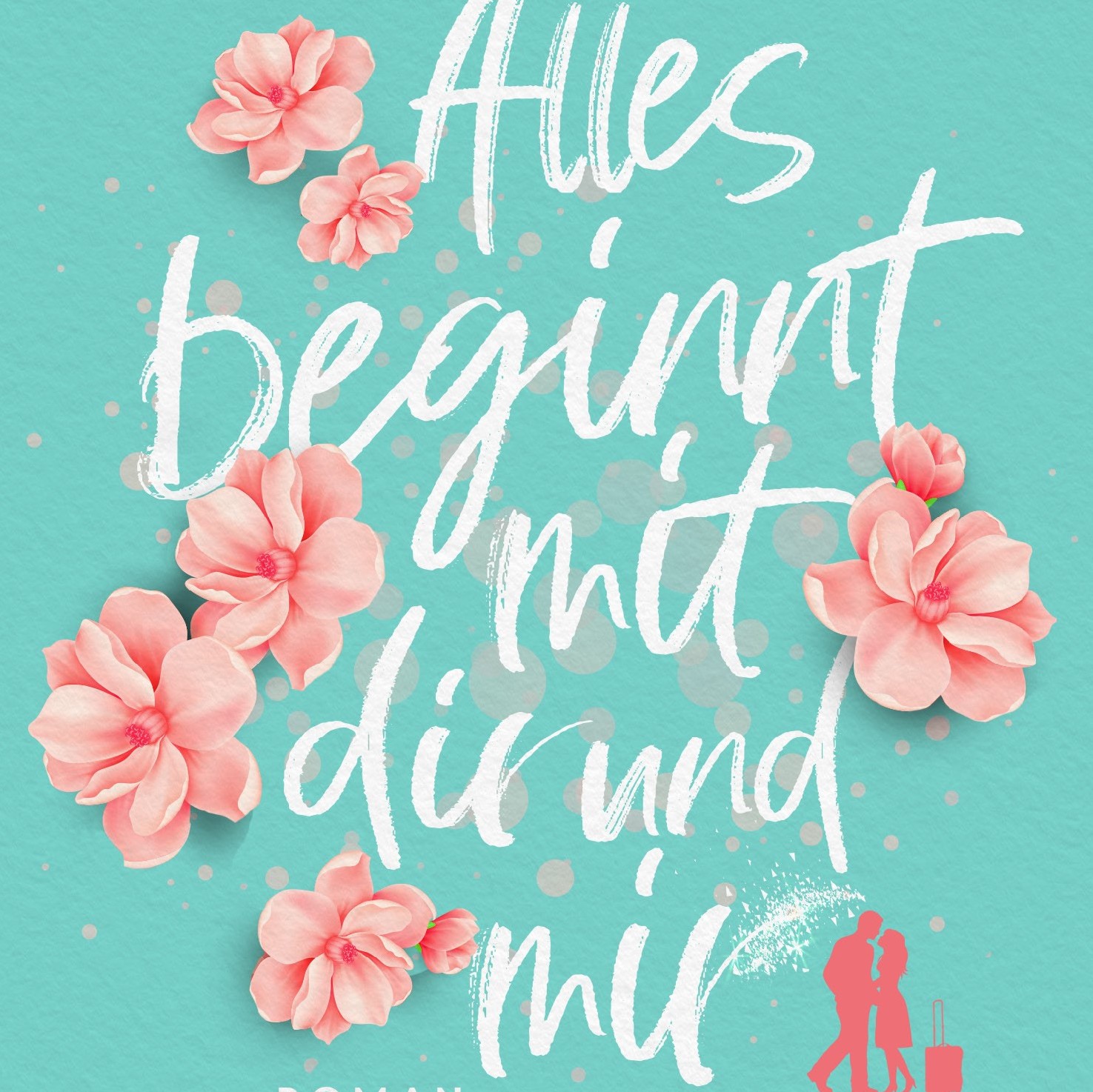
Laura Le Quesne, 29, verkörpert die Post-Boomer-Tochter wie aus einem Bilderbuch geplatzter Träume. Die alleinerziehende Mutter klapperte mit Laura in einem klapprigen Mini „Flohmärkte und Vintage-Messen“ ab. Sie fand jeden „Schatz“ eines Kofferraumverkaufs. „Mit den Augen einer Elster“ inspizierte sie aufgegebene Bestände. Für Laura erfand sie Legenden, die sich um den Ramsch der Anderen rankten. Je häufiger der Schrott die Besitzerin wechselte, desto größter sollte seine Bedeutung sein.
mehr
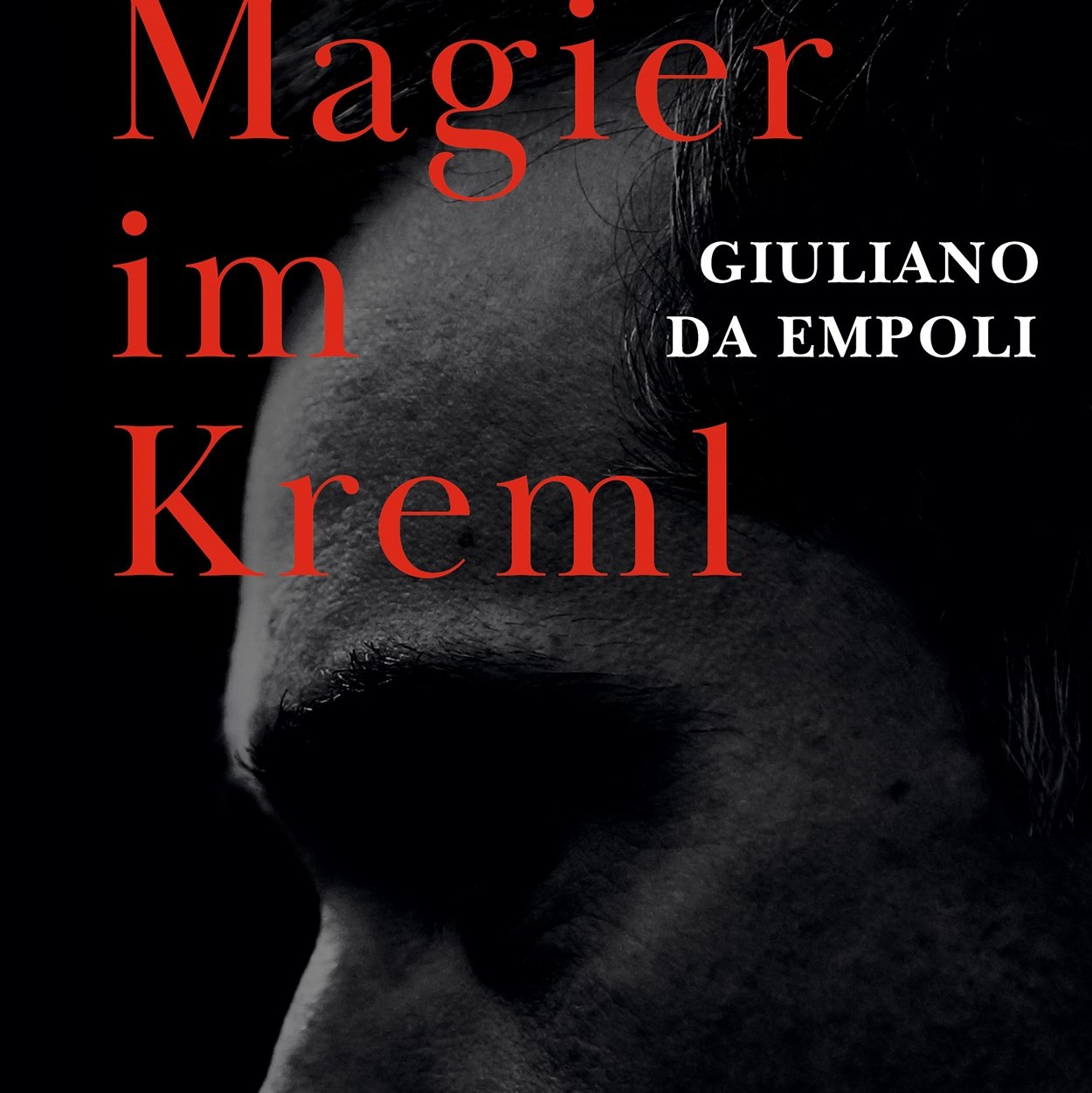
In einem langen Monolog definiert Putins privatisierender Ex-Berater Wadim Baranow den historischen Rahmen, in dem der russische Präsident handelt. Putin verfolgt eine Traditionslinie von Stalin bis zu Iwan IV., dem ersten Moskauer Großfürsten, der sich (im 16. Jahrhundert) zum Zaren ausrufen ließ. Er argumentiert mit einer tausendjährigen Reichshistorie und einer russischen Welt, die nur vorübergehend als Sowjetunion firmierte, indes ewig ist in ihren weit gesteckten Grenzen.
mehr
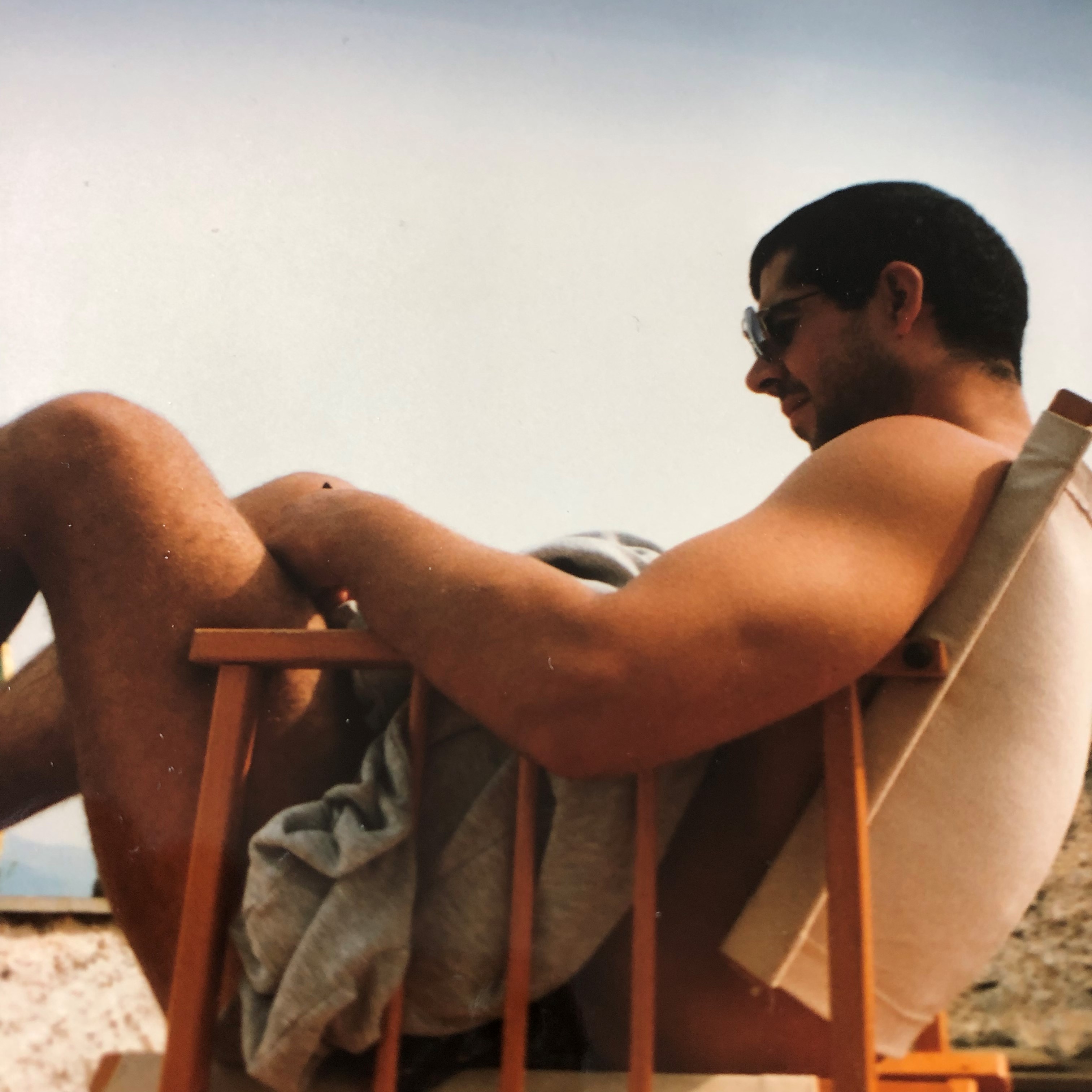
Das ist die Quintessenz: Der Pelz und die Peitsche verleihen Aurora keine Macht. Sie ist bloß Erfüllungsgehilfin eines Kolossalphantasten, dessen Ruhm die Epoche überstrahlt. Er hält ihr mangelndes Engagement vor. Aurora ist ihm nicht genug behilflich. Sie verweigert jeden „energischen“ Liebhaber, mit dem sie L. in einer Inszenierung effektvoll betrügen soll. Sie versagt in der Rolle einer tätigen Muse. Leopolds obsessives Dauerfeuer zerstört die Leichtigkeit ihres Seins. Aurora erlebt ihren Alltag als Strapaze.
mehr
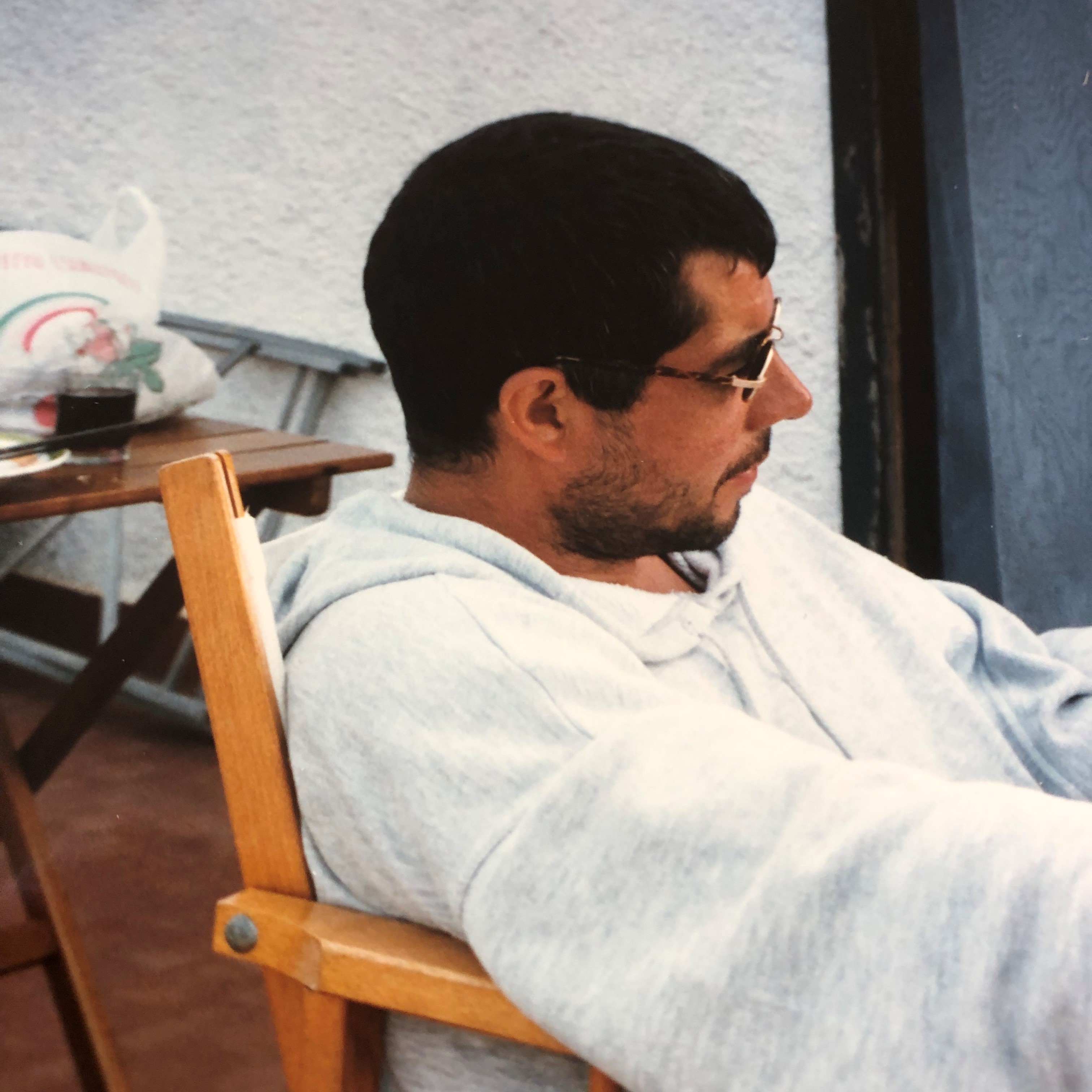
„Zu solchem Pelz und solchen Stiefeln gehörte ein Liebhaber. Es war unbegreiflich, dass ich keinen finden konnte! Ich war ja eine reizende Frau ... woran lag es? An den Männern natürlich. Man wagte sich nicht an mich heran, weil mein Gemahl den Ruf eines Kampfhahnes hatte … Wie sollte man den Männern begreiflich machen, daß sie nichts zu fürchten hätten?“ Wanda von Sacher-Masoch in ihren Memoiren
mehr

Als nächstes fasst L. den Besitzer einer Zuckerfabrik als „energischen“ Liebhaber seiner Frau ins Auge. Die Rede ist von Bruno Bauer, Husar der Reserve. Auch diese Konstellation zerschlägt sich. Damit wir uns richtig verstehen, L. möchte „die Geschichte aus einer gemeinen Untreue zu einem poetischen Erlebnis gestalten“. Dieser Entwurf überfordert die Schmierenkomödianten und Knallchargen in den königlich-kaiserlichen Kulissen. Sie kennen nur das Casino-Gedöns, den Café-Schmäh, die Billardsaal-Vendetta und Kasernenhof-Ranküne.
mehr

Zuhause bereitet Aurora ihrem maladen Mann mit dem Schlossrapport und Reisebericht eine Enttäuschung. Wieder einmal zerschlägt sich für L. die Hoffnung, seine Frau könne ihm das Vergnügen der Zeugenschaft eines - mit einem Dritten energisch vollzogenen - Geschlechtsaktes gewähren. „Ich brachte meinem Dichter wieder eine Enttäuschung nach Hause“, sagt sie selbst lapidar, aber nicht lieblos.
mehr
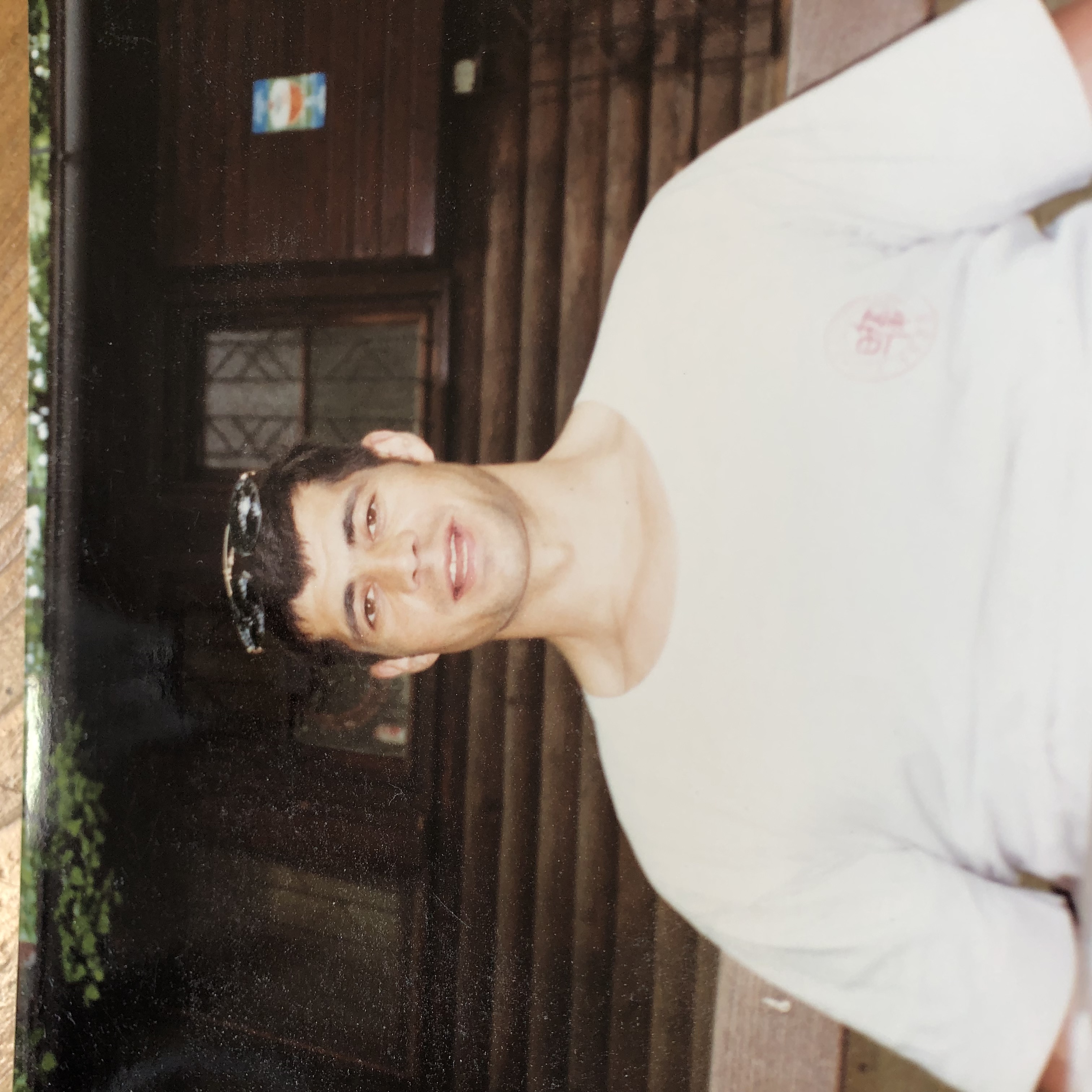
Aurora und ihre Freundin Anna-Catherine Strebinger genießen die pikante Gastfreundschaft des weitgereisten und hoch aufgestiegenen polnischen Grafen Ladislaus Koszielski, der nach Jahrzehnten im militärischen und diplomatischen Dienst eines Sultans als Sultan von eigenen Gnaden - mit einer sagenhaften Prachtentfaltung - in der Steiermark auf Schloss Bertholdstein residiert.
mehr
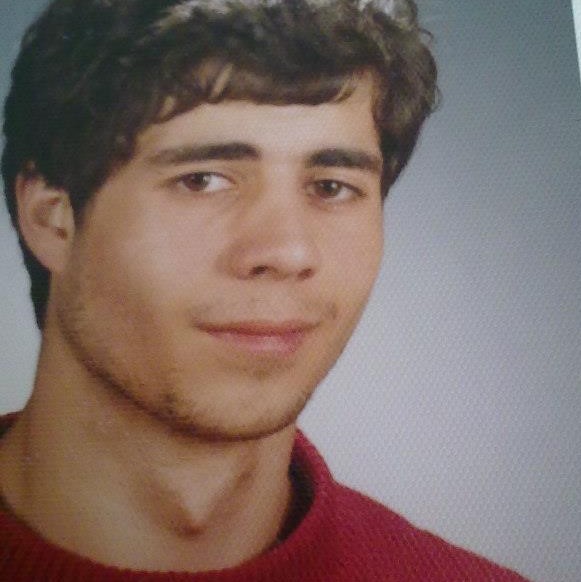
So einen Gebirgssultan von eigenen Gnaden kann sich die zur Konfabulation begabte, in Graz gestrandete, mit den Sacher-Masochs auf vertrautem Fuß stehende Abenteuerin Anna-Catherine Strebinger nicht entgehen lassen. Sie schreibt dem Pascha.
mehr

Die Freiheitsversprechen der Kunst funktionieren wie Druckventile. Die Psychoanalyse munitioniert bourgeoise Rebell:innen. Der Radical Chic gebietet es, sich zu exaltieren. Seine Herolde verehren den Schreibritter Leopold von Sacher-Masoch. Dessen Gattin, unsere Heldin Aurora, begrüßt die Groupies aller Geschlechter in ihrem Haus.
mehr

Nichts reizt L. mehr als eskapistische Manöver. Was den bürgerlichen Instinkt verstört, das zieht ihn an. Er will verführt werden und unterdessen die ganze Bandbreite zwischen Liebreiz und Infamie erleben. Ihn lockt die böse Kraft begnadeter Tentatrices. Der Webfehler in dieser Konstellation besteht darin, dass L. selbst für andere zum Versucher wird. Er ist ein Matador der Manipulation, klingend frei von jedem Verantwortungsgefühl. Wer sich der Gewalt seines Begehrens nicht gewachsen zeigt, geht auf eigene Rechnung vor die Hunde.
mehr

Das ist die Quintessenz: Der Pelz und die Peitsche verleihen Aurora keine Macht. Sie ist bloß Erfüllungsgehilfin eines Kolossalphantasten, dessen Ruhm die Epoche überstrahlt. Er hält ihr mangelndes Engagement vor. Aurora ist ihm nicht genug behilflich. Sie verweigert jeden „energischen“ Liebhaber, mit dem sie L. in einer Inszenierung effektvoll betrügen soll. Sie versagt in der Rolle einer tätigen Muse. Leopolds obsessives Dauerfeuer zerstört die Leichtigkeit ihres Seins. Aurora erlebt ihren Alltag als Strapaze.
mehr

Charles Baudelaire nannte George Sand eine „Spießerin der Unmoral“. Er unterstellte ihr die Urteilstiefe einer „Gardienne“. Darüber würde ich kein Wort verlieren, wäre es nicht Baudelaire gewesen, der, so erklärt es Hans Mayer, „die Dialektik von Skandal und bourgeoiser Gleichschaltung im Fall Georg Sand“ aufdeckte. War Leopold von Sacher-Masoch ein Bruder Sands im Geiste einer Revolte der nackten Persönlichkeit?
mehr

Das Habsburger Bürgertum existiert im Spannungsfeld zwischen feudaler Restauration und bürgerlichem Aufbruch. Spielarten eines kontinentalen Viktorianismus konkurrieren mit dem alpinen Biedermeier-Puritanismus unter der Glocke des Königlich-Kaiserlichen Imperialismus. Der Monarch, das adlige Gefolge und die Bourgeoisie sind sich so weit einig. Soziale Ingenieur:innen basteln am psychologischen Rahmenprogramm für den Gründerzeitturbo. Sie montieren Sicherheitsgurte an die Sitzschalen für den Gesellschaftsexpress. Überall vernimmt man schon den Motorengalopp der Zukunft.
mehr

Der Marquis de Rochefort ... lässt es auf der ganzen Linie einer ausgebauten Persönlichkeit krachen. Der Zeitungsmann zieht sich seine Debütblessuren beim Figaro zu. Er gründet La Lanterne und sorgt mit dem Blatt für den Spiegel-Skandal seiner Zeit. Für seine Überzeugungen geht er ins Gefängnis. Nach seiner Freilassung exiliert Rochefort nach Brüssel, wo er ein europäisches Periodikum in Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch unter die Völker bringt. Bei jeder Gelegenheit duelliert er sich.
mehr

Die Kurstadt an der Mur ist ein Hotspot der feinen Habsburger Gesellschaft am Vorabend einer dramatischen Zeitenwende. Schnitzlers „Reigen“ in der Endlosschleife - Artefakte des Ancien Régime bröckeln zwischen den Emanationen der Belle Époque. Es herrscht aber auch Gründerzeitfuror und Fin de Siècle. In der Gleichzeitigkeit von Hausse und Baisse stehen die Sacher-Masochs mit bedeutenden Persönlichkeiten der Epoche auf vertrautem Fuß, während Aurora gleichzeitig fürchten muss, nicht genug zu essen für ihre Kinder auf den Tisch zu kriegen.
mehr

1876 verbringt die Familie ihre Sommerferien in Frohnleiten. Die obersteirische Kurstadt liegt zwischen Bruck, wo die Sacher-Masochs zurzeit leben, und Graz, wo Aurora als Tochter eines württembergischen Militärbeamten, und Leopold als Sohn des landeshauptstädtischen Polizeichefs aufwuchsen, direkt an der Mur in einem hochalpinen Durchbruchstal. Die Kombination von genretypischem Panorama, provinzieller Urbanität und komfortabler Erreichbarkeit mit der Eisenbahn macht Frohnleiten zu einem touristischen Ziel ersten Ranges.
mehr
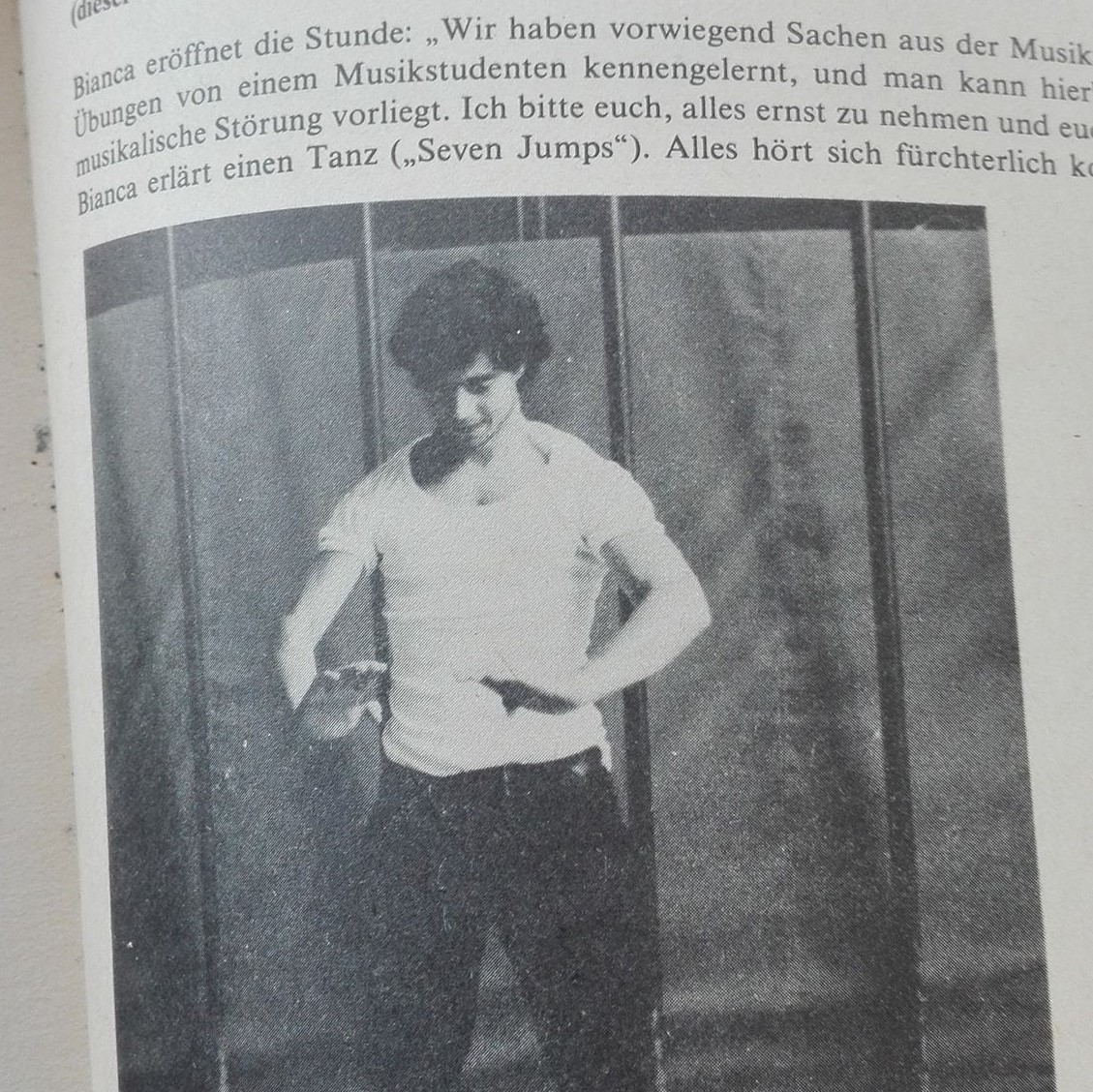
Leopold von Sacher-Masoch ist über seine biografische Person hinaus eine Spielfigur des Habsburger Biedermeiers. Seine Obsessionen haben die Sprengkraft von Feuilletons.
mehr
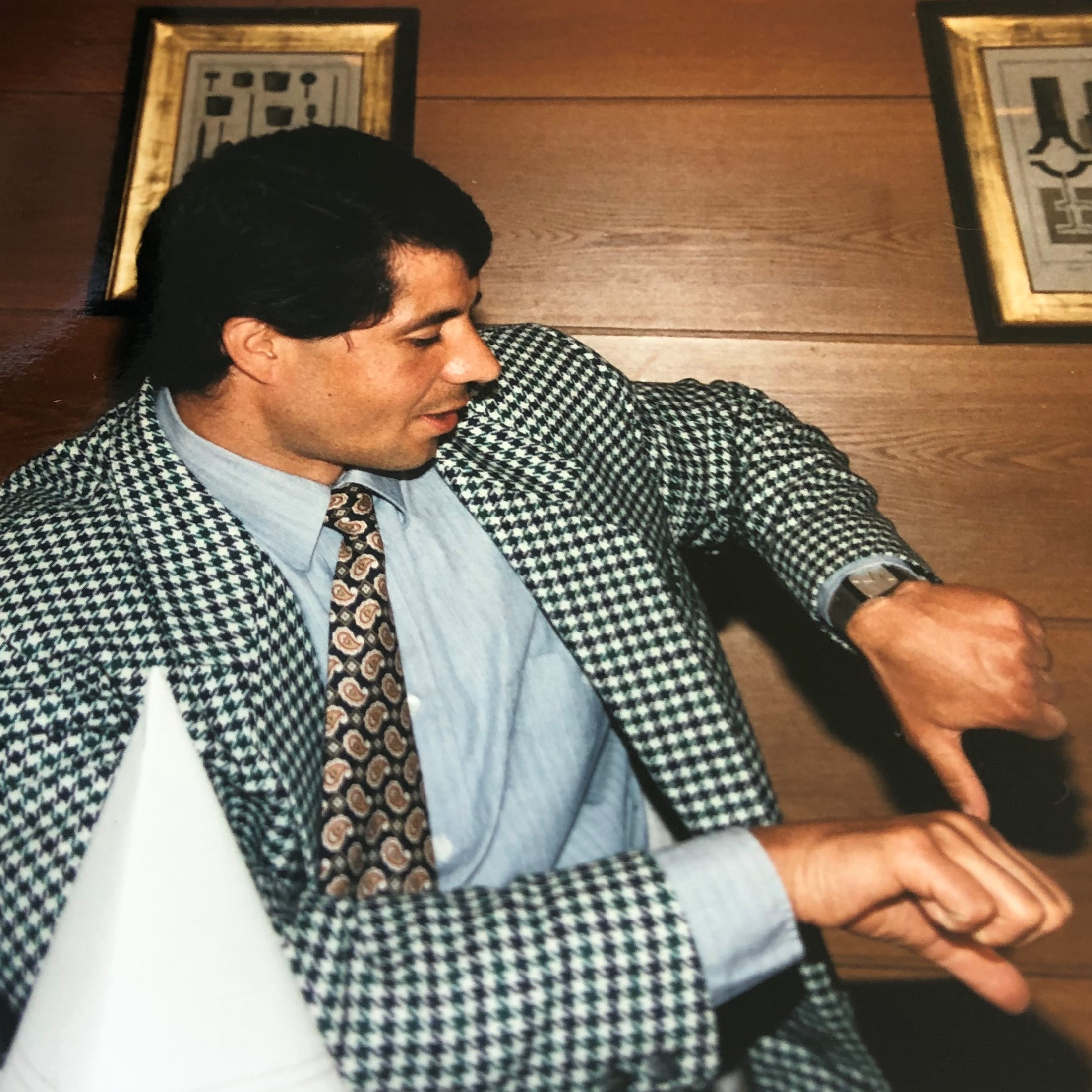
The leopard has the solution in its blueprint. If you are not a leopard, you will not solve the problem. You can‘t pet anyone to victory.
mehr

Aurora rechnet damit, dass Guinevere wie ein Vulkan ausbrechen wird. Die Schriftstellerin vermutet eine verborgene, gleichsam erdgeschichtliche Rücksichts- und Schrankenlosigkeit. Schlummert in Guinevere eine Kraft, die das Schwert aus dem Stein löst? Siehe Excalibur/Artussage.
mehr

„Mit Schrecken musste ich erkennen, dass ich meine stärksten Hoffnungen auf Irrtümern gebaut hatte. Seine große Liebe zu mir, die Liebe zu seinen Kindern, sein häuslicher Sinn - Irrtümer. Nichts würde ihn halten, wenn ihm fern von uns Befriedigung seiner Phantasien winkte.“
mehr

In Leopolds erotischer Sphäre dreht sich die größte Spindel um die Ausstattung. Der Renaissancekamin und die klassische Lektüre gehören zum physischen und psychischen Interieur. Der Schriftsteller L. agiert wie ein Schaufensterdekorateur, der in dicken Socken durch die Auslage wuselt. Eine marmorweiße Venus lässt er sagen: „Ja, Sie waren ganz verliebt in diese Toilette.“
mehr

Almost all genetic variants have their origins in evolutionary events long before our journey starts. And this is where epigenetics begins. If you understand that, you can rebuild yourself massively.
“There are no limits. There are plateaus, but you must not stay there, you must go beyond them. If it kills you, it kills you. A man must constantly exceed his level.” Bruce Lee
mehr

Aurora wirkt wie eine Schauspielerin in Leopolds Stücken mit. Ihre Dominanz ist so fadenscheinig wie ihre Alltagskleider. Während sich L. in seiner Prosa als solventer Edelmann spreizt, ist er in Wahrheit eher knapp bei Kasse; wenn auch - zunächst zumindest - gut betucht nach den Maßstäben der ins Elend gefallenen und mit Leopolds Hilfe ins bürgerliche Lager zurückgekehrten Aurora. Aus Dankbarkeit will sie L. die Möglichkeit „eines ehrenvollen Rückzugs“ bieten.
mehr
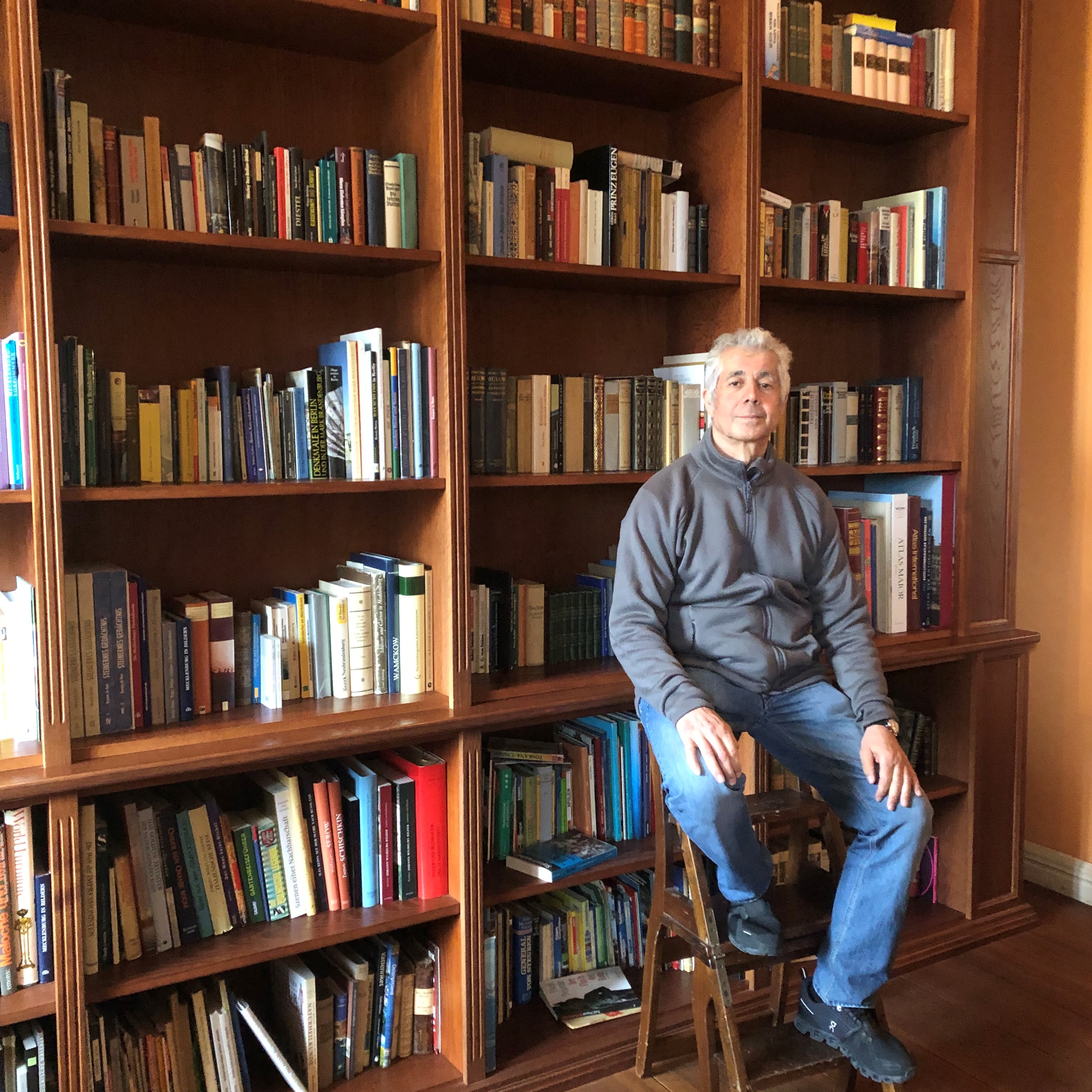
Zweifellos führt L. Regie. Er formt Aurora nach seinen Vorstellungen. L. ist, und das wird oft übersehen, u.a. Ausstattungsfetischist. Interieur und Inszenierung sind wesentliche Elemente seines Begehrens. Er baut Tableaus auf auch in seinen Briefen, die man richtig als Anweisungen für eine künftige Routine versteht. L. weist Aurora die Rolle zu, in der allein sie reüssieren kann. Will sie sich gesellschaftlich verbessern, muss sie sich nach Leopolds Wünschen richten.
mehr

Entschlossen, sich dem Ritter auf der Stelle „hinzugeben“, eilt Aurora R. (nach einem langen schriftlichen Anlauf) zur Wohnung ihres Brieffreundes und Wohltäters Leopold, den sie bis auf den Tod erkältet anzutreffen erwartet. Tatsächlich begegnet ihr L. in elegischer Aufgeschlossenheit. Ihn entzückt die juvenile Bravour der Besucherin. Revidieren muss er die Vorstellung, die ihm eine strenge Post eingab. Er hatte mit einer starken Dame gerechnet; mit einer angenehm furchteinflößenden Person.
mehr

„Mutter Courage ist schuld am Tod von all ihren Kindern. Man darf nicht zu viel Mitleid mit ihr haben.“ Helene Weigel 1954
mehr
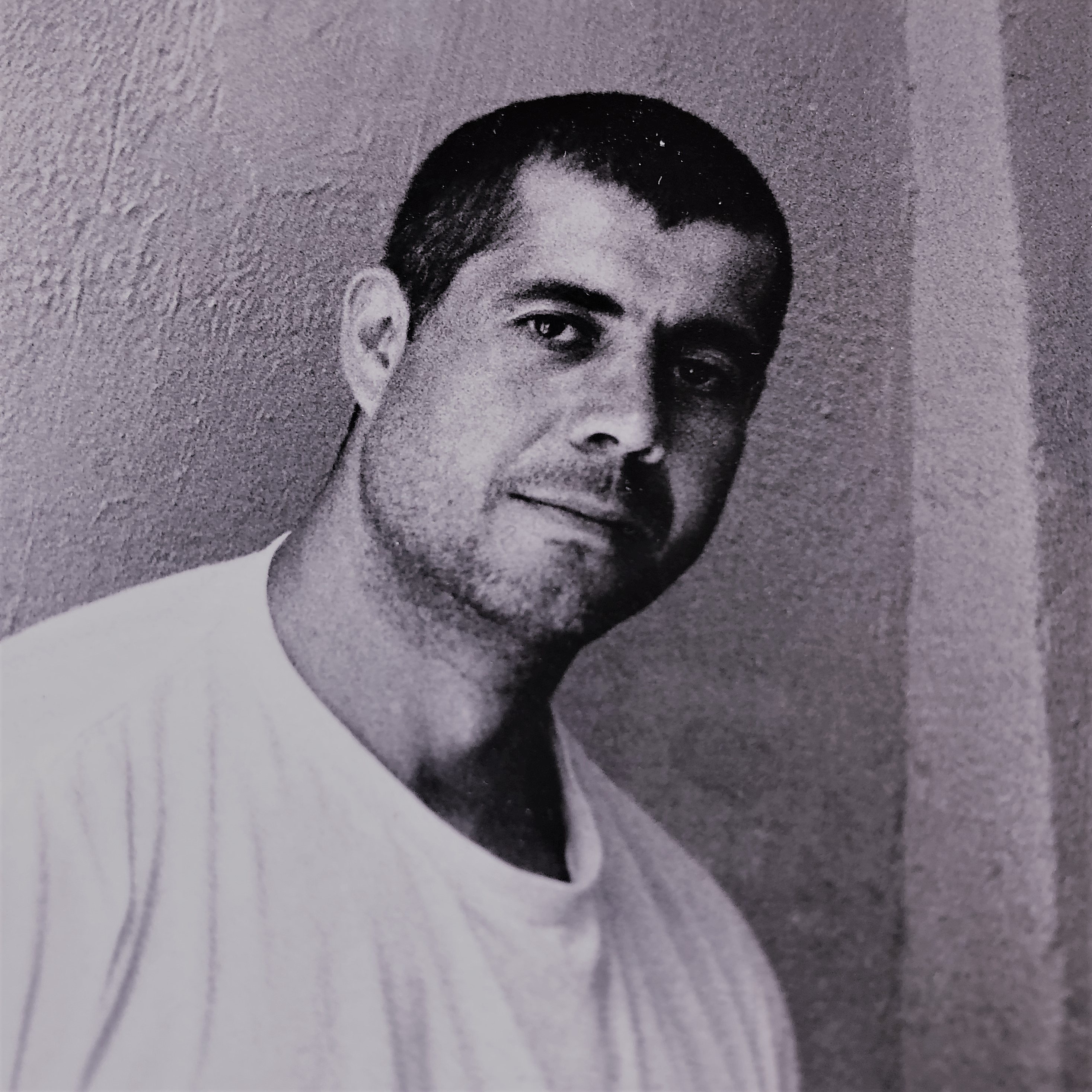
„Nun streitet sich das Publikum seit zwanzig Jahren, wer größer sei: Schiller oder ich, und sie sollten sich freuen, dass überhaupt ein paar Kerle da sind, worüber sie streiten können.“ Goethe zu Eckermann
mehr

Im 18. Jahrhundert waren Reisen nicht mehr nur feudales Vergnügen. Es gab die Grand Tour für den bürgerlichen Nachwuchs. In Kassel (Cassel) besuchte der Geck den Höhenpark mit dem Herkules auf der Spitze und begriff die Anlage als Sensation im englischen Stil. Beinah mühelos gelangte er in die Wohnung S.K.H. In einem Kabinett fand die Prüfung der Penelope statt - so wie sie Johann August Nahl der Jüngere (1752 - 1825) aufgefasst hatte.
mehr
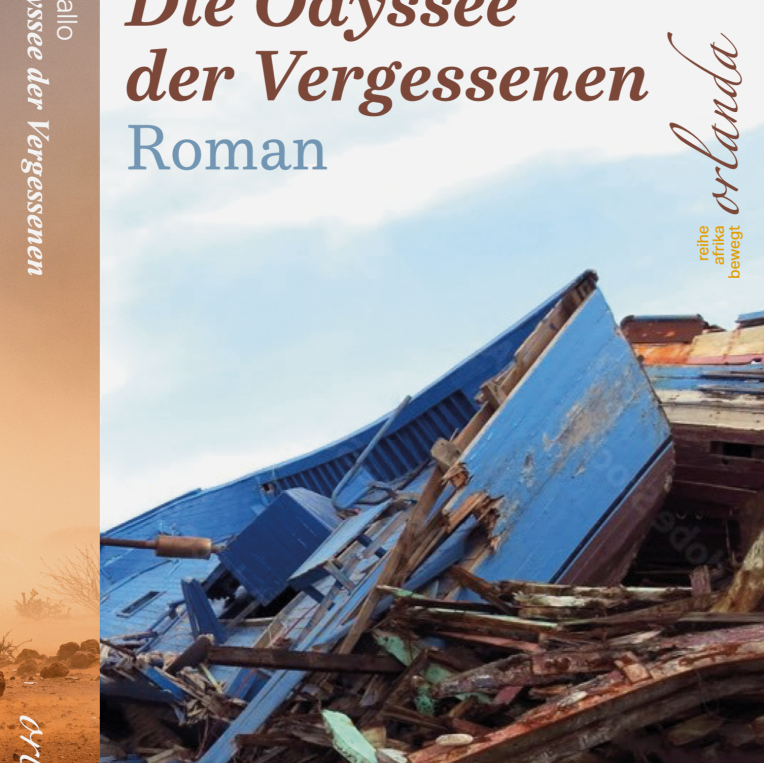
Sembouyane beschreibt Verhältnisse, in denen die Hölle verblasst. Der Erzähler sucht Zuflucht bei seinem Großvater, der sich in einem majestätischen Kapokbaum inkarniert hat. 2013 erlebt er zum ersten Mal die Liebe, wenige Stunden vor dem Beginn seiner Initiation in dem Wald, der sein Dorf einschließt. Als Sembouyane zurückkehrt, findet er den Schauplatz seiner Kindheit verheert. Unter den von Freischärlern Ermordeten sind seine Eltern und seine Liebste.
mehr

„Wenn es zu Ende ist, falls wir tatsächlich an unser Ende gelangen, hast du vielleicht eines Tages die Chance zu erkennen, wer wir gewesen sind. Und doch wird die Qual mich immer begleitet haben, und ich werde mich ewig fragen: Hätte ich dir noch mehr erzählen müssen?“ Youssef zu einer Tochter seines ‚Bruders‘ Iseul
mehr
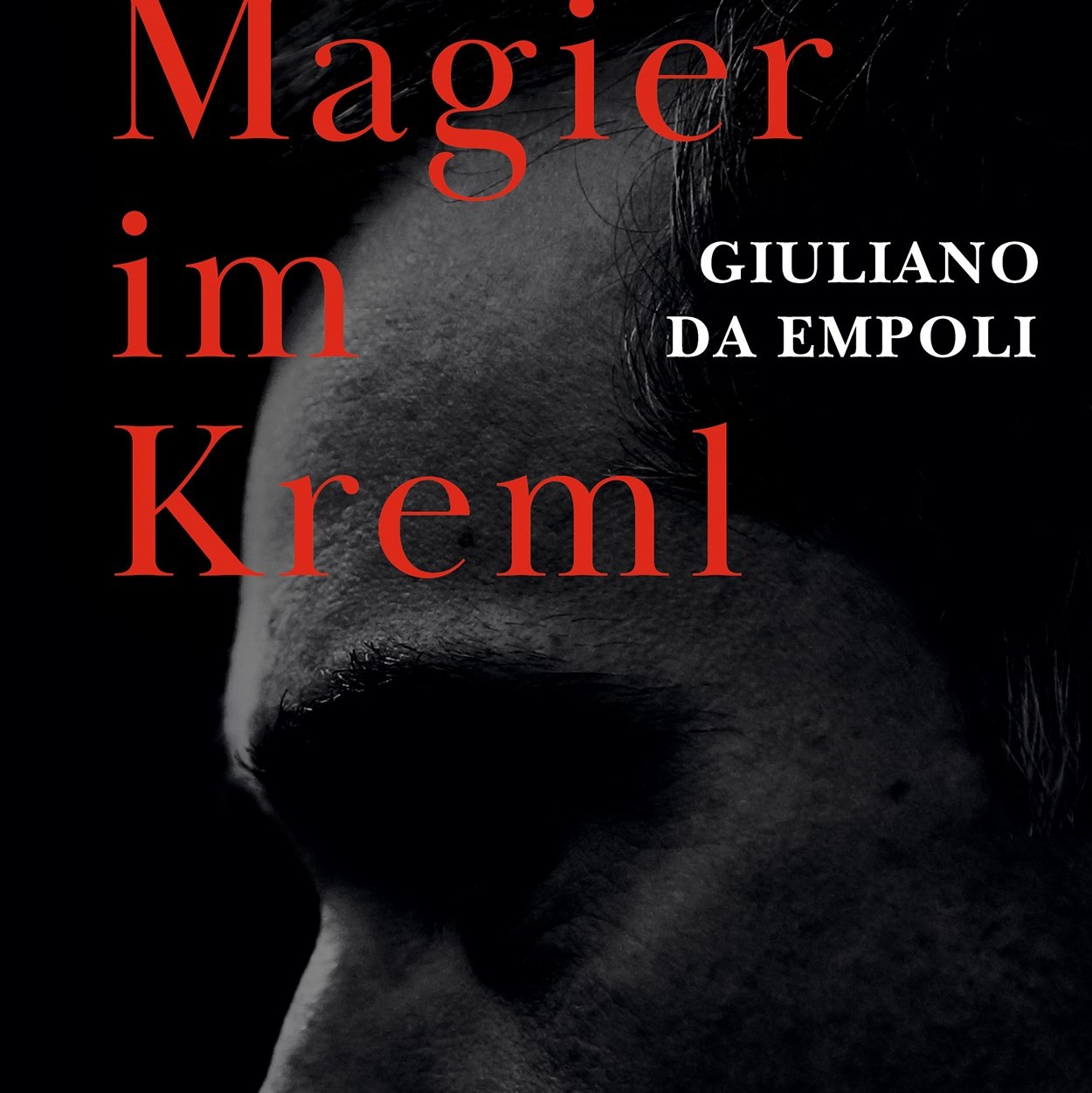
Der Erzähler beruft sich auf den Schriftsteller Jewgeni Iwanowitsch Samjatin. Jener habe in einer literarischen Auseinandersetzung mit der jungen Sowjetunion weit über seine Gegenwart hinausgegriffen und genau die Zukunft beschrieben, die sich im Roman-Jetzt entfaltet. Mit Samjatins erfüllten Prophezeiungen verbindet sich die mysteriöse Existenz eines grandiosen Einflüsterers, der lange an den Ohren eines Zaren unserer Zeit kaute und sich nun als „Handlanger (der Macht) im Ruhestand“ betrachtet.
mehr
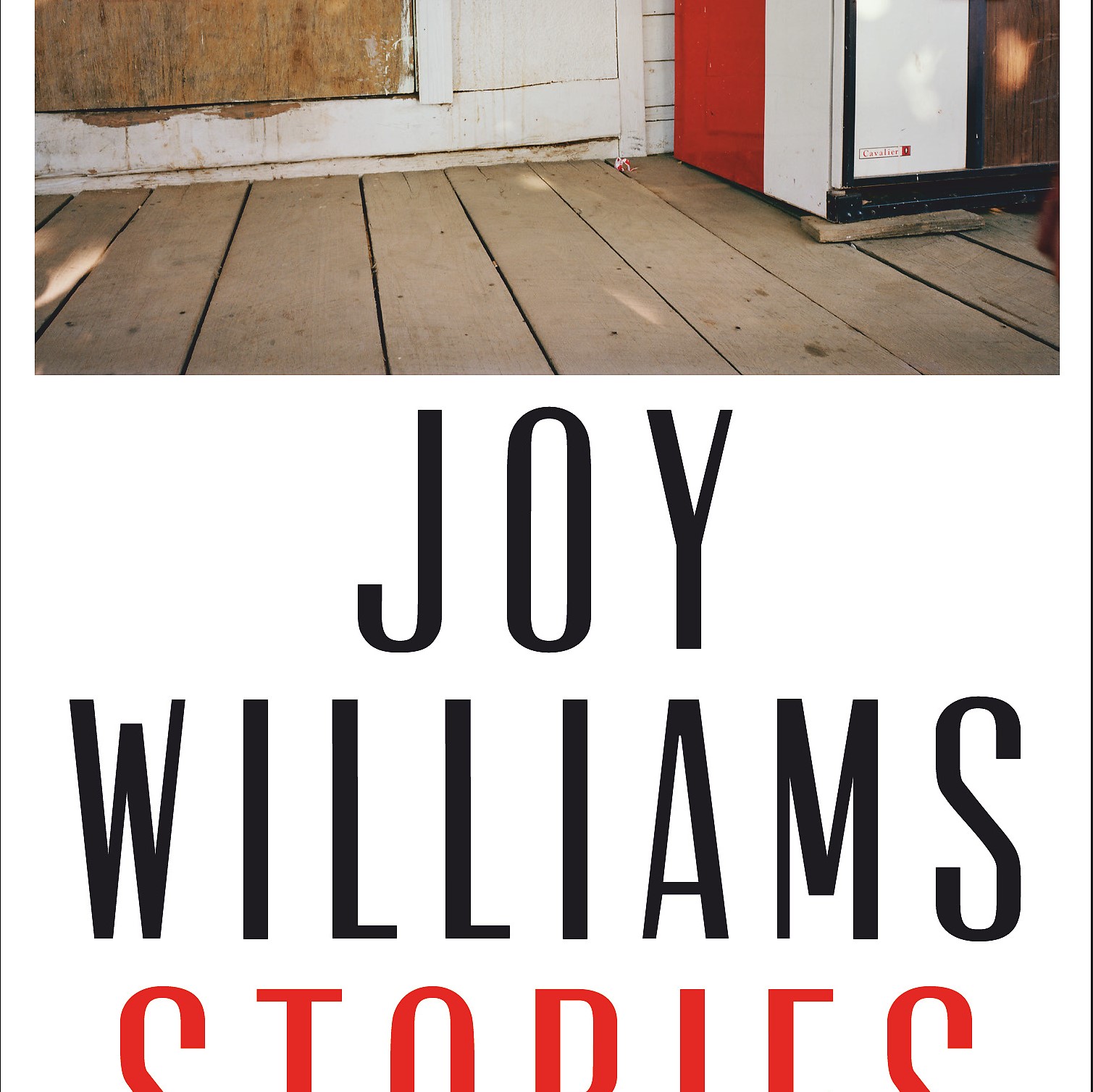
Gravitationslose Biografien in namenlosen Landschaften - Leere Räume mit surrealen Säumen - Das assoziiere ich mit Joy Williams‘ amerikanischen Szenen. Die Autorin kombiniert topografische Präzision mit vager Geografie. Eine Siedlung im waldreichen Nirgendwo dient sieben Müttern berühmter Mörder:innen als Refugium. Eine stirbt an Krebs, dann waren es nur noch sechs. Sie erschaudern künstlich, während sie sich erzählen, dass Gegenstände aus dem vormaligen Besitz ihrer Kinder auf Ebay als Devotionalien gehandelt werden. In einem David-Hockney-A-Bigger-Splash-Arrangement leuchten Grapefruits „anmutig zwischen … von Spinnmilben- und Blattlausbefall gekräuselt(en Blättern)“.
mehr

Das Geschrei von Brunst und Frustration auf dem Trottoir. Ein Destillat der Einfachheit steigt auf. „Gedichte sind Gegenstände, die alles aufnehmen können“, sagt Meckel in Schneiders Küche. Inge und Klaus Schneider, hauptamtliche Staatssicherheit, getarnt als Gelehrte und Freunde der lyrischen Intelligenz. Wohnhaft hoch über der Dimitroff.
mehr
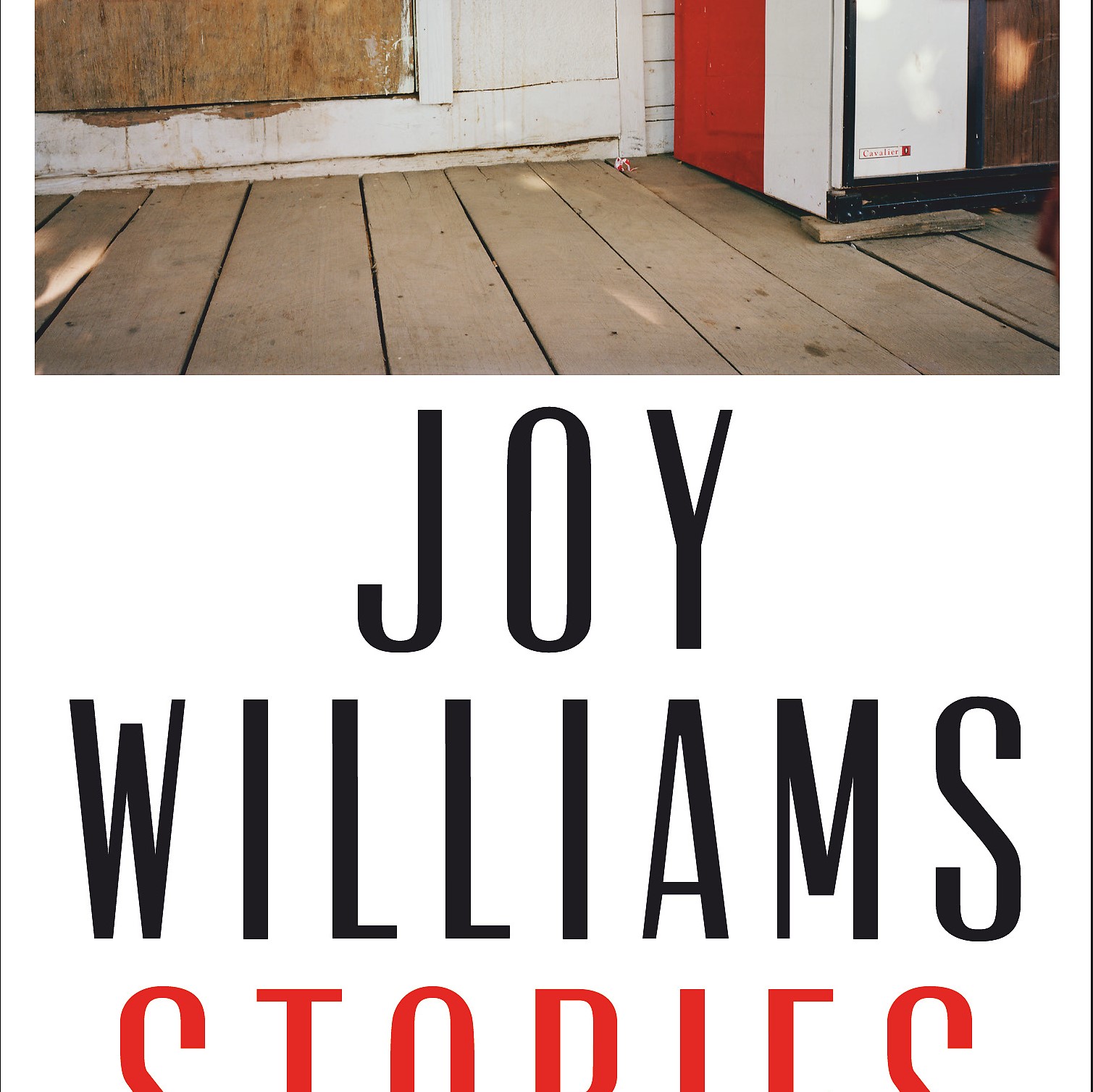
Die Autorin schildert Verhältnisse von grotesker Dürftigkeit und notdürftiger Normalität. In der ersten Geschichte holt ein Prediger kurz vor Weihnachten seine Frau (zum Sterben in vertrauter Umgebung) aus dem Krankenhaus. Am Ende seiner Lebenslaufbahn erwartet das Paar nur noch die Tochter der einzigen Tochter. Die Mutter des sechs Monate alten Kindes folgte einem Befehl der Sterne nach Mexiko. Das Baby tröstet die Alten mit seiner schieren Existenz.
mehr
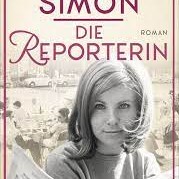
Die Autorin trifft jeden Nostalgienagel auf den Kopf. Die Zeitmarken sind exakt gesetzt. Mit Liebe zum bayrischen Detail beschwört Teresa Simon Stimmungen der jungen Bundesrepublik zwischen Adenauer-Restauration und gesellschaftlichem Aufbruch.
mehr

Jörg träumt von der Bekanntschaft mit einem gutaussehenden Mann, der gern geschlachtet, portioniert und gegessen werden möchte.
mehr

Die interessanten Antworten kriegte ich von Leuten, die bleiben wollten. Sie hielten Verzerrungen des Systems für Schmerzfolgen eines immer noch nicht abgeschlossenen Geburtsvorgangs. Die sozialistische Republik kam langsam zur Welt, sie gebar und erbrach sich in Jahrzehnten aus den Fehlern von Jahrtausenden. Das Bild einer Zangengeburt drängte sich auf, Willi Sitte hätte das Bild malen können.
mehr

„Das Material bestimmt die Gestalt. Blech und Draht haben die höchsten Freiheitsgrade.“ Eberhard Fiebig
mehr

Adorno bringt ein amerikanisches Sprichwort an, um Brechts erzieherische Effizienz im Kampf gegen Hitler zu bestimmen: preaching to the saved. Das Zweckmäßigkeitsgehabe gehört zum Ornament des Lehrstücks. Brecht bleibt in der Form stecken, sagt Adorno. Im Lehrstückcharakter steckt ein Instrument der Abwehr institutioneller Kritik. Brecht weiß, dass er nicht mit Hitler abrechnen muss. Er tarnt sich und verschleiert, dass „ihm das Theater wichtiger als jede Veränderung der Welt ist“.
mehr

Die gehobene Familiengeselligkeit eines deutschen Ablegers der englisch-schottischen Winchester-Dynastie entgleist fahrplanmäßig bei Curryhuhn-Indisch und stürzt zum Nachtisch in einen unvorhergesehenen Abgrund.
mehr
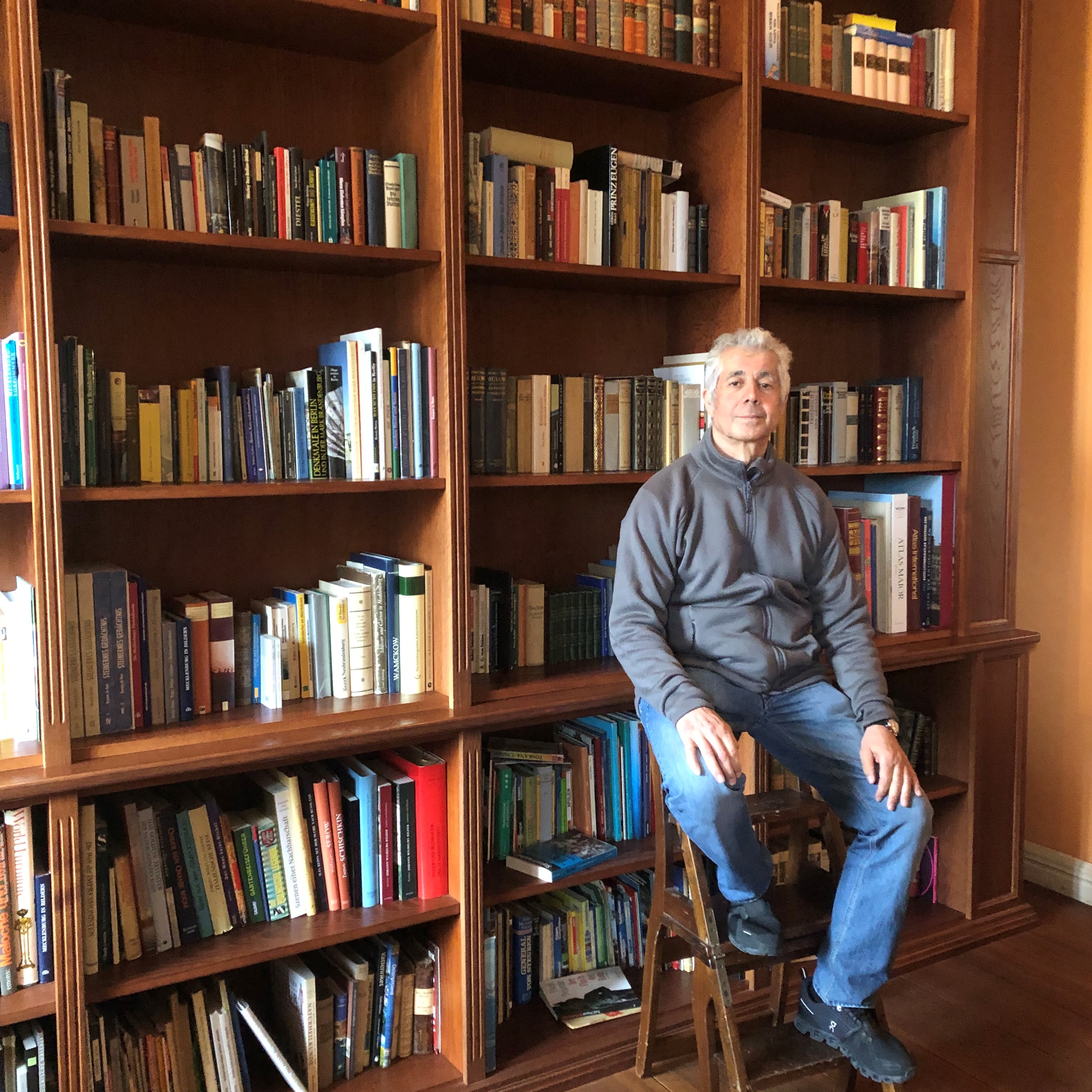
In jedem Ensemble gibt es einen Iraner, der deutsche Tugenden rühmt, und einen Sven auf der Flucht vor seinen Gläubigerinnen. Den Boris im Alimente-Rückstand, ungefragt Besserung gelobend. Es gibt falsche Fröhlichkeit und echten Neid. Soziale Wucherungen, die Bildung von Randgewächsen und ein vehementes Aufkommen von Verfallserscheinungen auf nächtlichen Wochenmärkten. Kegel von Flakscheinwerfern unterhalten sich über den Leuten. Die Zeit hat einen Sprung in der Schüssel, Genossinnen nehmen die Hitze zum Vorwand, um das Bekleidungsminimum zu unterschreiten.
mehr

„Fritz Lang, das ist deutsche Psychologie auf amerikanischem Boden.“
mehr

Alwin handelt mit der Rationalität des Paranoikers. Wo keine Angst ist, gibt es keinen Verlass. Alwin nennt sich Christ, doch heißt seine Religion Angst. Sie zu verbreiten, hält Alwin für seine Pflicht. Deshalb schwang er den triefenden Kopf am Schopf vor Rosamund zu ihrem Entsetzen. Alwin wollte ihren Willen lähmen, sie sollte sich ihm niemals widersetzen. Er hätte Rosamund sonst töten und auf ihren Stammbaum verzichten müssen.
mehr

„Im Sommer 1921 bin ich einmal, in Kampen, unbemerkt einen langen Spaziergang hinter Ihnen hergegangen und habe mir ausgedacht, wie es wäre, wenn Sie mit mir sprächen.“ Adorno in einem Brief an Thomas Mann
mehr
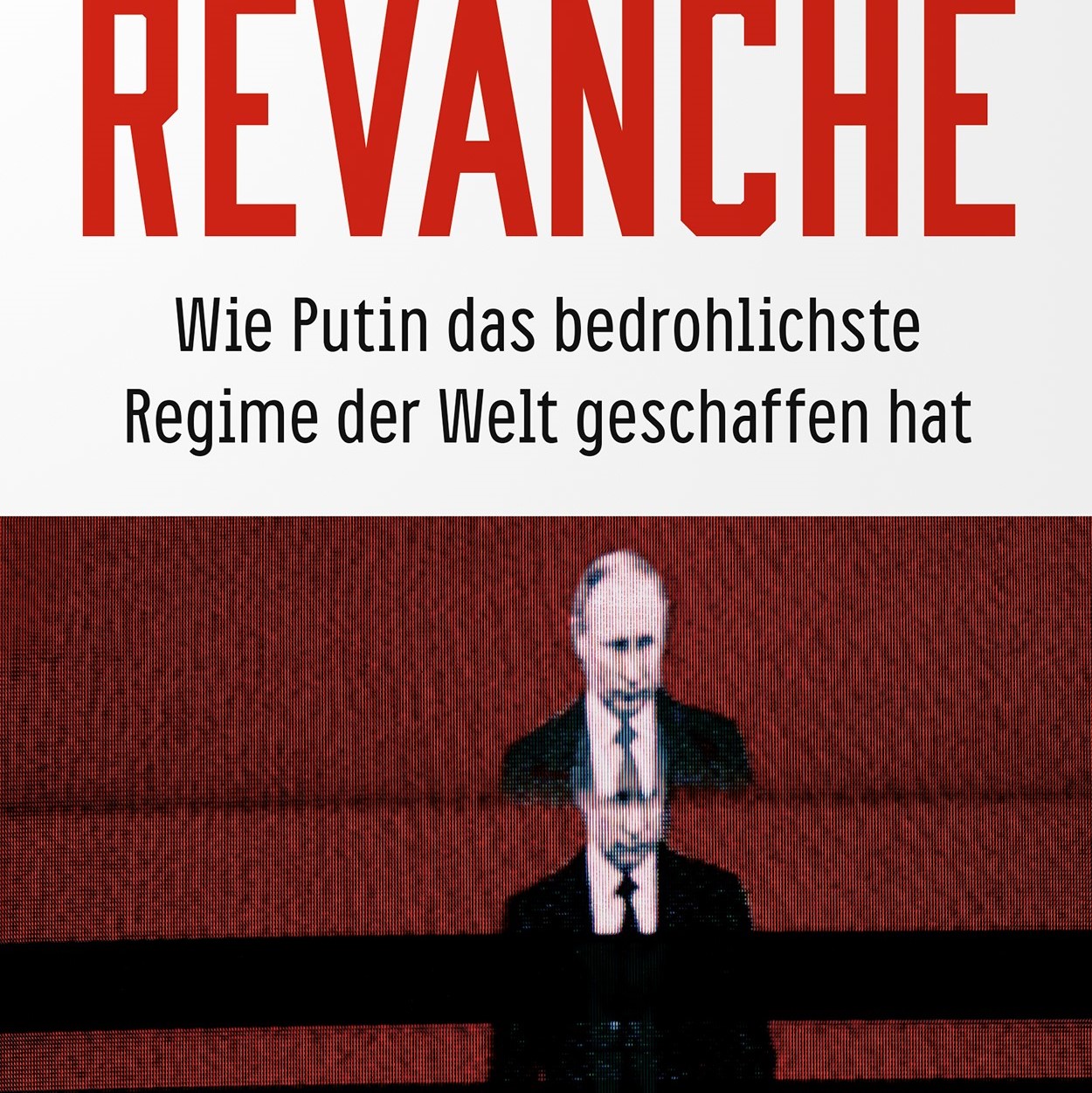
Das Zukunftsdesign der EU sowie der NATO gestalten Gesellschaften, die nach dem Ende des Warschauer Pakts - in einer „Parade der Souveränitätserklärungen“ (Michael Thumann) - ihre Unabhängigkeit erlangten. Sie verstehen nicht, weshalb der alte Westen auf den Ohren sitzt. Im Mai 2022 fand die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Irina Wereschtschuk deutliche Worte: „Warum wurde Nord Stream 2 gebaut, warum (hat Deutschland) … nicht auf Polen, die Ukraine, Litauen, Estland gehört, die Länder, die Sie gewarnt haben, dass es bei Gas und Öl für Putin um Politik geht, nicht um Wirtschaft?“ Die ukrainische Regierung habe immer davor gewarnt, dass Putin Deutschland „manipulieren“ würde. Aus der WELT vom 04.05. 2022
mehr

Aniela bricht ihren Schwur am Saum der ursprünglichen Uferlinie, wo vor dreitausend Jahren (bis zu einem Strömungsumschwung) Ostseewellen aufliefen. Sie betrügt ihren Mann mit seinem besten Freund in einer Galerie vom Wind gedrückter Kiefern auf dem Kliff. Sie sieht malerisch gewachsene Buchen, Fichten, Eiben, Lärchen, Douglasien und Erlenbrüche. Das Wasser steht im Unterholz wie in den Everglades.
mehr

„In einer Zeit, in der die Größe des Individuums selbst fraglich geworden war, konnten Postamente nichts helfen.“ Herbert Ihering über Klassikeraufführungen, die mit „pathetischen Darstellungen (deren Bedeutung) unterminiert(en), weil sie den menschlichen Inhalt durch eine kolossalische Form diskreditierten. Aus diesem Zweispalt führte weder ein nuancierender Realismus, der alles detaillierte, noch ein ekstatischer Hymnenstil heraus, der alles aufsteifte“.
mehr

So hoch im Kurs zu stehen, sorgt bei Einar für eine ratlose Erektion. Britta fühlt sich angenehm berührt. Gemeinsam kehren sie dahin zurück, wo sie nie zuvor waren. Sie lieben Marginalien der Handfestigkeit sowie unauffällige Verschiebungen der Valeurs; das Kleingedruckte eminenter Vorgänge. „Habt ihr kein Zuhause?“ fragt eine. „Seid ihr ein illegales Paar?“ Britta und Einar erkennen sofort den spielmateriellen Wert der Fragen. Die Erweiterung heben sie sich für später auf.
mehr
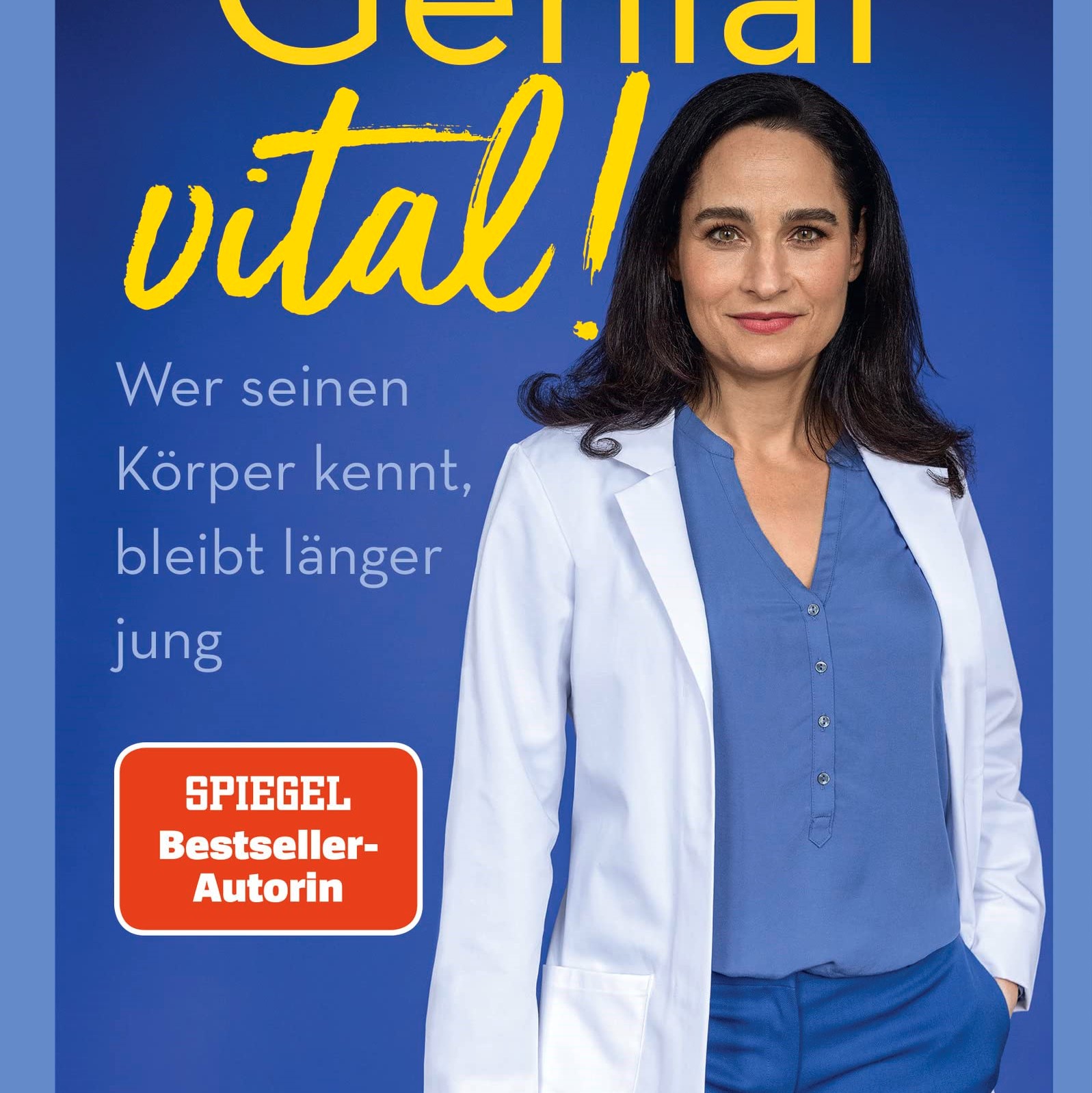
„Im wahren Zellenleben kann die Codeabfolge der DNA schon mal … gestört werden. Dann nämlich, wenn Umweltfaktoren … ihre Wirkung entfalten … Zu Störungen kommt es manchmal auch spontan … weil freie Radikale (überaktive aggressive Sauerstoffmoleküle) ihr Unwesen treiben.“
mehr
Am 11. März 2023 kommt der neue, zweiteilige Abend von Sasha Waltz & Guests mit dem Titel »Beethoven 7« zur Uraufführung im Radialsystem, Berlin: eine Choreographie von Sasha Waltz zu dem Auftragswerk »Freiheit/Extasis« des zeitgenössischen Komponisten Diego Noguera sowie zur Musik von Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie. Die Vorstellungen im März 2023 sind bereits ausverkauft. Der Vorverkauf für die Vorstellungen am 31. August sowie am 1. bis 3. September 2023 startet voraussichtlich im Juni.
mehr

1958 begegnet Ingeborg Bachmann dem Kollegen Max Frisch, den sie zunächst nur bewundert, der dann aber Paul Celan in der Rolle des Geliebten folgt. 1963 endet das Verhältnis. Die Trennung legalisiert eine frische Verbindung des Schriftstellers. Frisch beteiligt Bachmann am neuen Glück. Er verlangt geradezu ihr Einverständnis. Seine Beschreibungen der Verlassenen ... erleidet Bachmann als Entblößung
mehr

Charlotte und Einar, noch weiß es keiner. Schon morgen werden es alle wissen. Alles Heimliche wird breitgetreten und klein geklopft und in den Kies geharkt. Auf den Nebenwegen, den Spielplätzen und Höhleneintrittsstellen, zwischen geparkten Autos, in den Gärten, auf den Friedhöfen, vor mythischen Wasserhäuschen so wie im Wasserwerk, hört man überall das Gras husten.
mehr

Wir schreiben das Jahr 1996. Die Prunktexte der Messebeilagen gelten einem „Großautor der Moderne“ (Gustav Seibt). Es geht um die Etablierung eines weiteren Genies auf dem deutschen Buchmarkt, man hat sich auf Gaddis geeinigt, so wie zuvor auf Gabriele Goettle. Gaddis erscheint in Frankfurt am Main, seine Familie ist seit den Tagen von Peter Stuyvesant in New York tonangebend. Er repräsentiert seine Klasse bis zu den Ziselierungen. Er triumphiert als Klischee eines White Anglo-Saxon Protestant mit Hosenträgern. Er sieht aus wie eine Erfindung von Tom Wolfe.
mehr

„Wenn man keine Bezeichnung für Kitsch und Krampf mehr wusste, sagte man das ist erhaben. Jeder Scharlatan und jeder Reaktionär lehnte die Ummontierung der Klassiker mit dem Wort ab, dass die Größe der Charaktere vermindert, die Größe der Form zerstört würde. In Wirklichkeit wurde in allen konservativen Aufführungen, in allen pathetischen Darstellungen diese Größe unterminiert, weil sie den menschlichen Inhalt durch eine kolossalische Form diskreditierten.“ Herbert Ihering
mehr

„Der Nutzen der Klassiker … ist zu gering. Sie zeigen nicht die Welt, sondern sich selber. Persönlichkeiten für den Schaukasten. Worte in der Art von Schmuckgegenständen. Kleiner Horizont, bürgerlich. Alles mit Maß und nach Maß.“
mehr
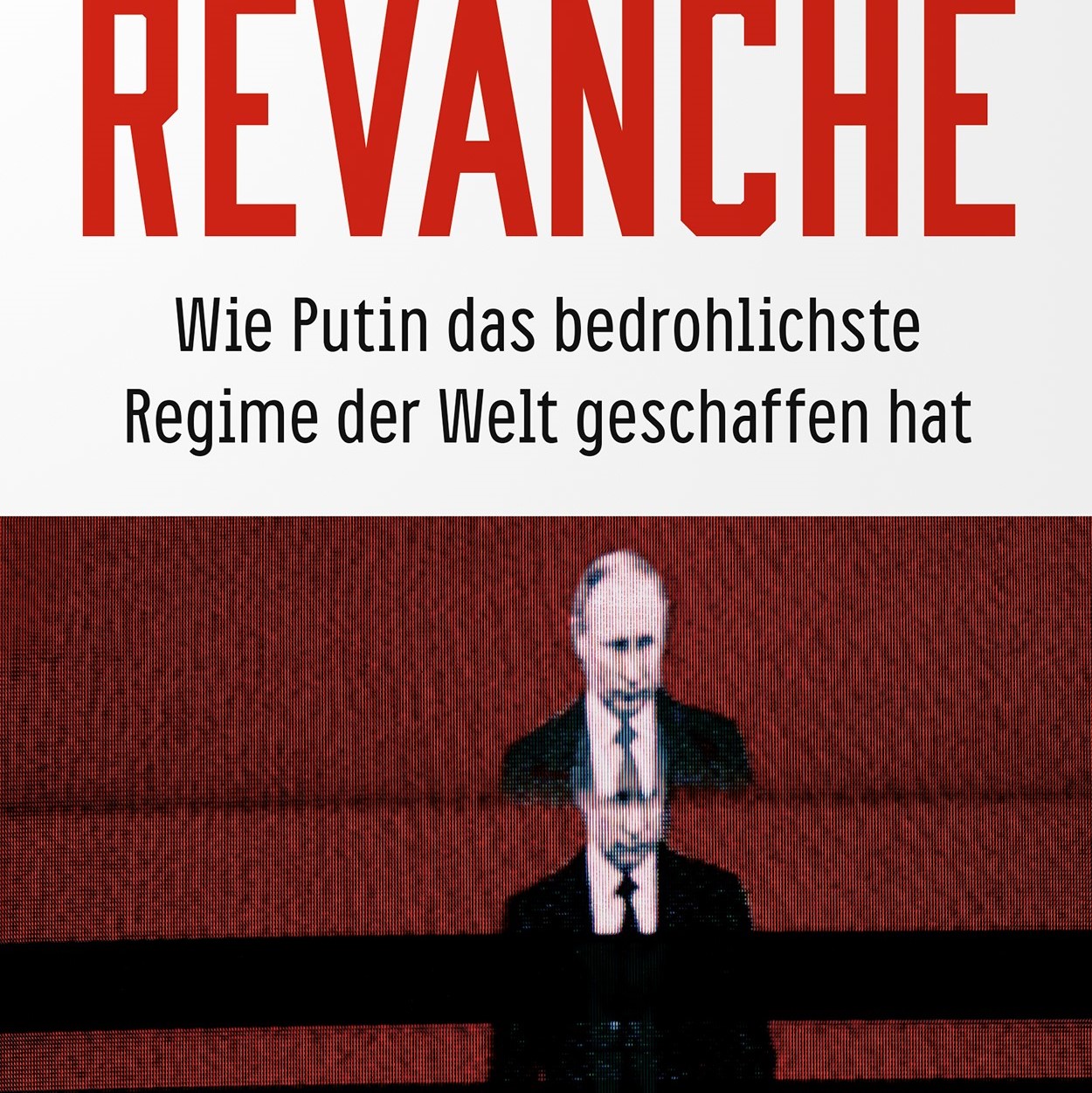
Putin repräsentiert einen neuen epochemachenden „radikalen Nationalismus“. Thumann widerspricht jenen, die behaupten, Russlands Regression entspränge Reaktionen auf westliche Interventionen im Zuge der NATO-Osterweiterung. Gewiss geht so ein Generalirrtum der westlichen „Kreml-Exegese“ (Claus Leggewie). Thumann erkennt in Putins Position „die Fortsetzung einer kolonialen, imperialen und sowjetischen Tradition, einer prekären geschichtlichen Ungestalt, die von innen kommt“.
mehr

In den 1970er Jahren bestimmte zwar eine sozialdemokratische Agenda den gesellschaftlichen Diskurs, Stichwort „Mehr Demokratie wagen“, die Revanchist:innen waren aber in der Überzahl und nannten die Befürworter:innen der Ostverträge ‚Vaterlandsverräter‘. Mein Vater war nicht nur Vaterlandsverräter, sondern auch Nestbeschmutzer, weil er die deutsche Schuld anerkannte. Dass etwas vollkommen Offensichtliches, sich in der Schläfrigkeit des Alltags mit somnambulen Bewegungen unter dem Debattendeckel halten ließ, frappierte mich.
mehr

Er war ein Flügelmann Gottes, Herzog der Normandie, Konstabler von Frankreich, Richard Löwenherzens Fechttrainer, James Bond in seiner ursprünglichsten Gestalt, Admiral der ersten nautischen US-Expedition und Förster in der Wetterau. Er beteiligte sich an der Erfindung Amerikas, gründete Texas, die Texas Rangers und die Kasseler Gesamthochschule. Er berief sich zum ersten Lehrstuhlinhaber für den Wilden Westen und gewann sieben olympische Goldmedaillen. Vier Mal wurde er zum Sexiest Man Alive gewählt. 1965 veröffentlichte er unter dem Pseudonym Truman „Texas” Capote das von Spezialist:innen als Autobiografie gehandelte Meisterwerk „Kaltblütig”. Viele kannten ihn als Stevie Ray Vaughan.
mehr

„Das Theater muss wieder erreichen, dass sich jeder Zuschauer so gut unterhält, wie er es in einem mittleren amerikanischen Film tut.“
mehr

Mülltonnengestank zieht in den zweiten Stock. Goya steht im Bad am Fenster. Parterre ist der Kinderladen, in dem er war. Reste ausgewogener Ernährung gären in den Tonnen mit den chemischen Reaktionen von Convenience Food um die Wette. Auf dem Hof rauchen Erzieherinnen. Goya bleibt unbemerkt auf seinem Logenplatz, manchmal feiert die Hausgemeinschaft im Hof.
mehr

„Das klassische Drama diente zur Bestätigung einer Welt, gegen die es entstanden war. Mit klassischen Versen verlobte man sich, erzog man seine Kinder, kannegiesserte und kegelte man. ‚Das ist das Los des Schönen auf der Erde‘, rief Vollbart und zwickte die Kellnerin.“ Herbert Ihering
mehr
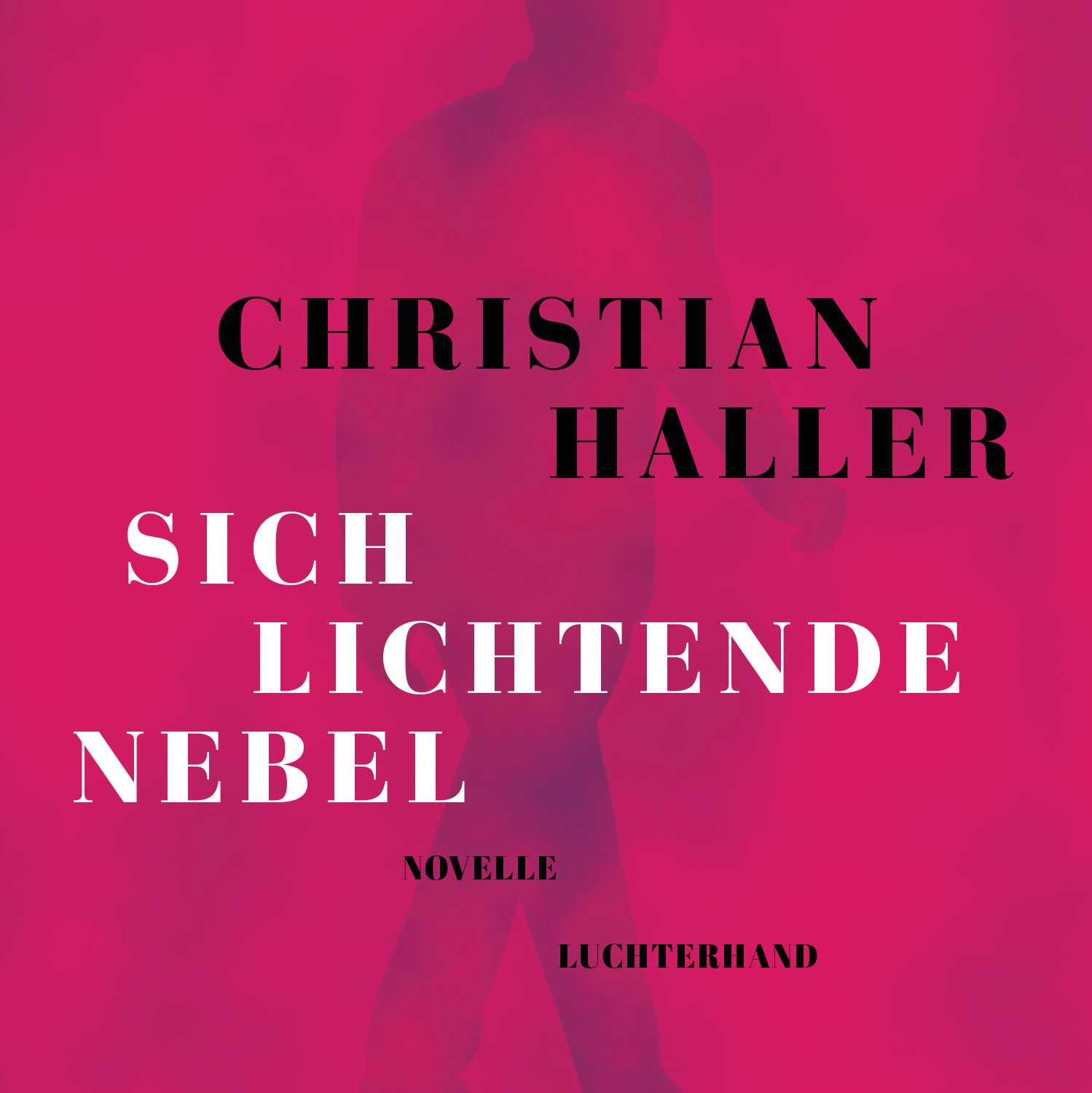
„Die Quantentheorie ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass man einen Sachverhalt in völliger Klarheit verstanden haben kann und gleichzeitig doch weiß, dass man nur in Bildern und Gleichnissen von ihm reden kann.“ Werner Heisenberg
mehr
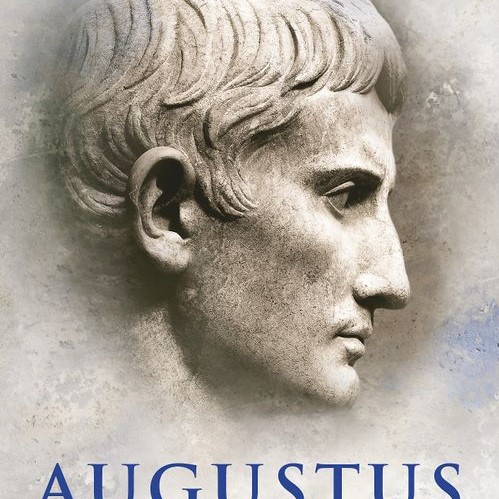
In Briefen, Tagebucheintragungen und Aufzeichnungsfragmenten tragen Zeug:innen der Augustinischen Ära zu einem Darstellungskolossal bei. Nach Caesars Ermordung im Jahr 44 vor unserer Zeitrechnung wähnt sich der animalisch instinktsichere Feldherr Marcus Antonius im Besitz sämtlicher Nachfolger-Vorrechte. Er arrangiert sich mit den Mördern seines Mentors, um sie gleichzeitig zu befehden. Furchtlos tanzt er auf sämtlichen Hochzeiten. Gefährliche Gegner:innen glaubt er unter Caesarianer:innen nicht zu haben. Caesars Adoptivsohn und Großneffe Octavian traut Antonius nichts Staatsmännisches zu.
mehr

„Diese Zeit ist voller Dramen. Alle Widersprüche kommen zugespitzt zum Vorschein. Wenn das hier (der Zweite Weltkrieg) vorbei ist, werden wir mehr Material haben als Shakespeare.“ BB
mehr

„Die Freiheit kann reden, denn ihr ist das Wort zugleich Waffe und Beute; die Macht aber ist verloren, sobald sie anfängt, sich zu rechtfertigen.“ Ludwig Börne
mehr
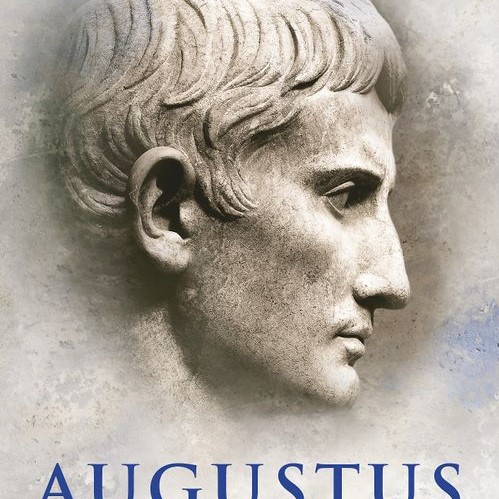
„Es gibt ein Heer kaum bemerkbarer Stöße, Zuckungen und Stillstände, welche der Blick des Beobachters aufgreifen, aber kein Symbol bezeichnen kann“, bemerkt Konrad Engelbert Oelsner in einem Brief vom 20. April 1792 zur Lage im revolutionären Paris. In seinen „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ (1915 - 1917) spricht Sigmund Freud von „Erscheinungen, die Fehlleistungen sehr nahestehen“. Er nennt sie Zufalls- und Symptomhandlungen. Sie sind ephemer. Ihre Signatur ist das Fadenscheinige, Beiläufige, vermeintlich Unerhebliche.
mehr

Susi und Stefan durchlaufen gemeinsam und unfreiwillig präpubertäre Stadien in einer Stadtrandgegend zwischen Dorf und Neubausiedlung. Man fährt nicht in die Stadt. Der Kindergarten, die Schule, der Verein, der Blockföten- und der Konfirmationsunterricht sowie alles andere vom Bäcker bis zur politischen Jugendgruppe befinden sich an Ort und Stelle. Nominell ist man Städter:in, de facto Landei. In der Enge erscheint jede lokale Eigenart universell. Man spricht Dialekt und glaubt, die Leute, die anders sprechen, sprechen falsch.
mehr
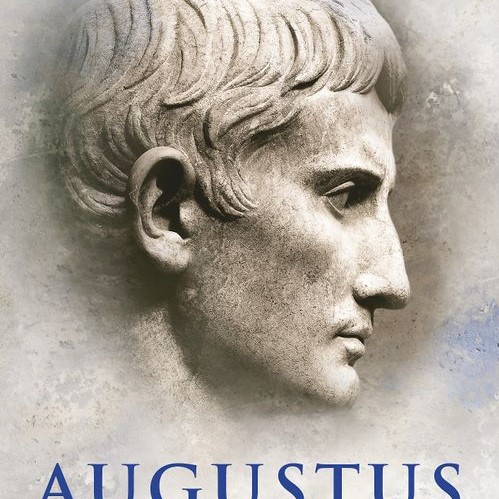
In einer Vorbemerkung reklamiert der Autor für sein Werk die literarische Wahrheit in Abgrenzung zur historischen Wahrheit. John Williams (1922 -1994) besteht darauf, der Wirkung nicht alles geopfert zu haben. Als abschreckendes Gegenbeispiel weist er einen Chronisten aus, der in einer Selbstanzeige dem Effekt zuliebe sogar „Pompeius die Schlacht von Pharsalos“ gewinnen lassen würde. Das Beispiel verdient deshalb Beachtung, weil die Auseinandersetzung Epoche machte.
mehr
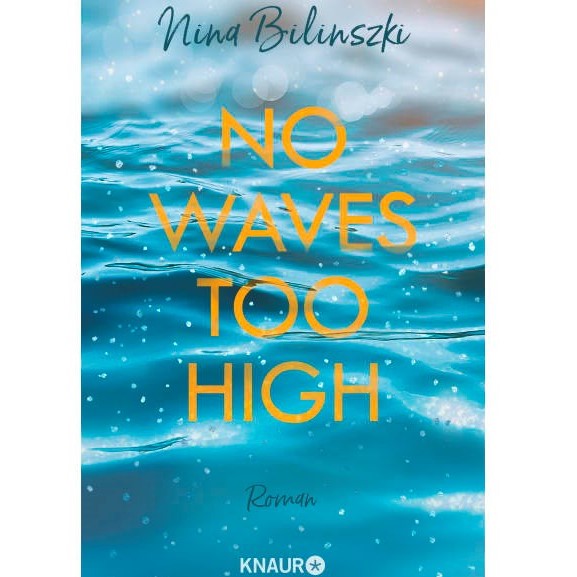
Eine Haiattacke setzt Alicia Taylor vorübergehend körperlich und länger noch mental außer Gefecht. Das begreift die Supersurferin erst, als sie die physischen Folgen des Angriffs stationär halbwegs verdaut hat. Beim ersten Post-Reha-Kontakt mit dem Meer wird die Traumatisierte von einer Panikwelle erfasst. Sie kann nicht ins Wasser. Alicia scheut vor ihrem ehemaligen Lieblingselement zurück. Sie kollabiert beinah.
mehr
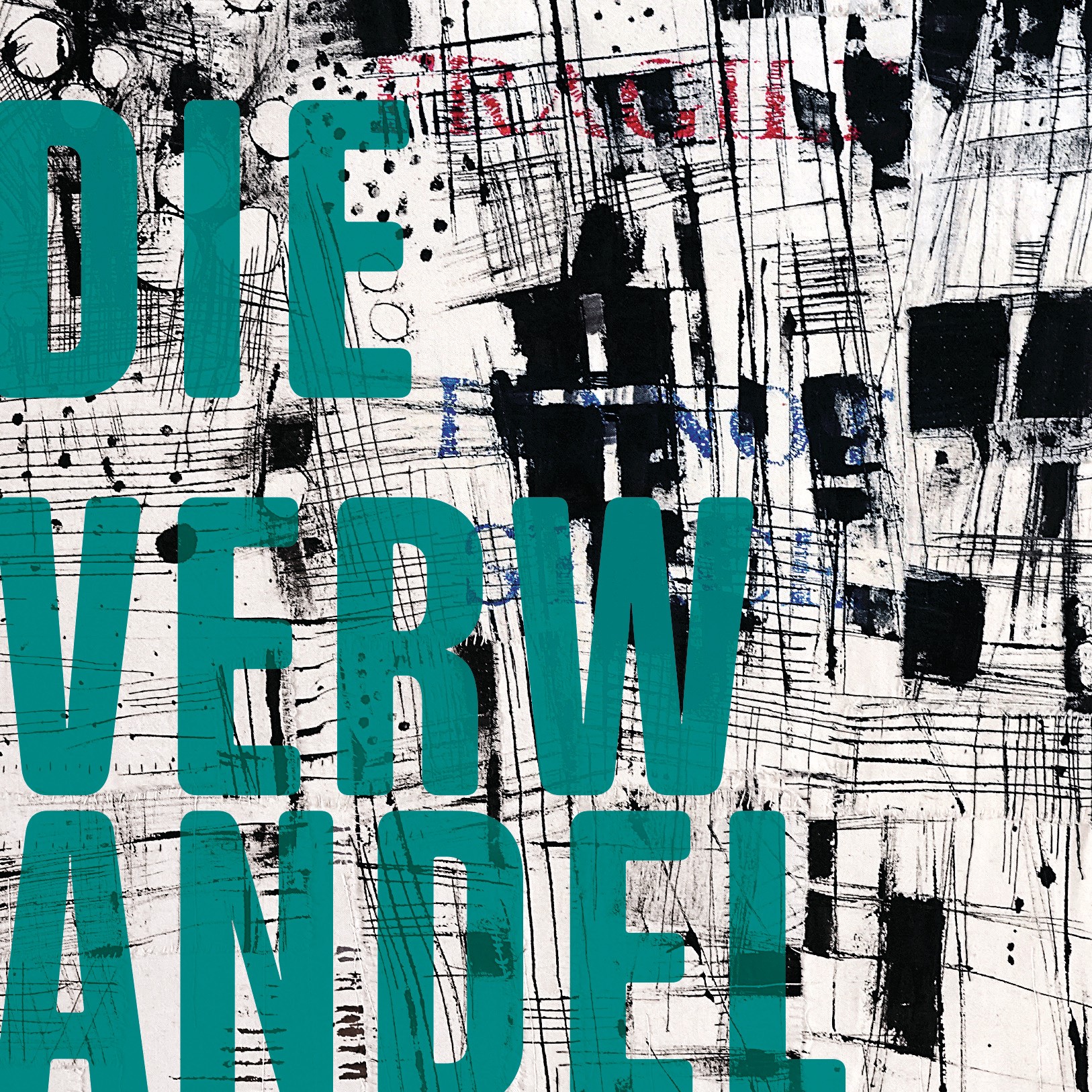
Als Gerhild Schücking wächst sie in München-Solln auf. Erst als Erwachsene erfährt sie ihren wahren Geburtsnamen - Alessa (Alessja) N.N. - und dass sie 1937 im Haus „Hochland“, einem 1936 gegründeten „Lebensborn“-Heim in Steinhöring bei Ebersberg zur Welt gekommen ist. Offenbar war Alissa nach der Entbindung gemeinsam mit der polnischen Leibmutter entlassen worden, vier oder fünf Jahre später jedoch von einer „Sendbotin“ aus Wrocław/Breslau ins Heim zurückgebracht worden.
mehr

Valerie bringt in einem Satz drei ungewöhnliche Wörter unter: Perpendikel, Parapluie und Schawellche. Unbedingt muss man die Frankfurter Aussprache in Anschlag bringen und jedes Wort auf der ersten Silbe betonen, will man es richtig machen. Valerie kann sogar mit Sauhund-Igor. Sie greift ihm leicht unter die versifften Arme, hilft dem Benehmen auf. Päppelt es.
mehr
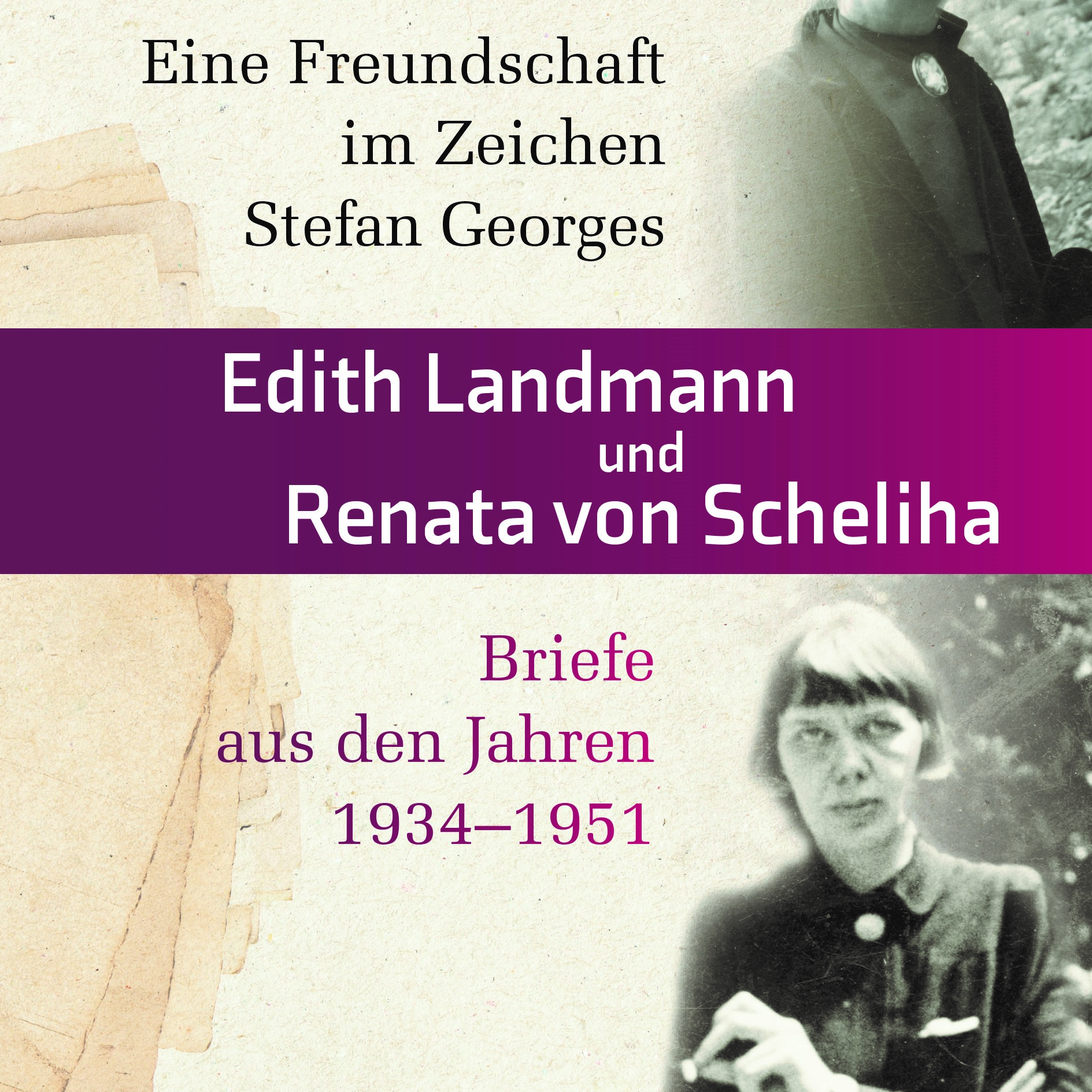
Ab 1934 zelebriert RvS ihr akademisches Dasein an einer Peripherie. Studien betreibt sie in einer „schalldichten Zelle“. Ihre Korrespondenz belegt ein „überspannende(s) Verlangen nach … Tempelkunst“ (so äußerte sich Thomas Mann zu Stefan George). Willkommener Besuch macht sich mit dem Glykoneus bemerkbar. „Das fürs Klopfen an der Wohnungstür verabredete griechische Versmaß … klopfte man im daktylischen Rhythmus bei (RvS) an, so öffnete sie, auch wenn man nicht angesagt war.“
mehr

Montagnachmittag kommen die Patienten zu Grete, Fünfzigjährige, die Wasser trinken. Hinter ihnen liegen Ehen und Krankheiten, an denen man sterben kann, und das Gefühl der Unverwüstbarkeit. Die Männer waren früher gut beieinander, man ahnt es noch. Sie bekleideten Posten. Sie sind nun ausgesteuert. Das sagen sie so. Sie arbeiten nicht mehr, abgesehen von Ronny. Er fährt Taxi, weil er das braucht. Ronny erfüllt besondere Aufgaben in der Gemeinschaft. Er vermittelt zwischen den Patienten und den Gesunden, die man sich sonst verächtlich vom Hals hält. Die Patienten separieren sich an der Nebelbank ...
mehr
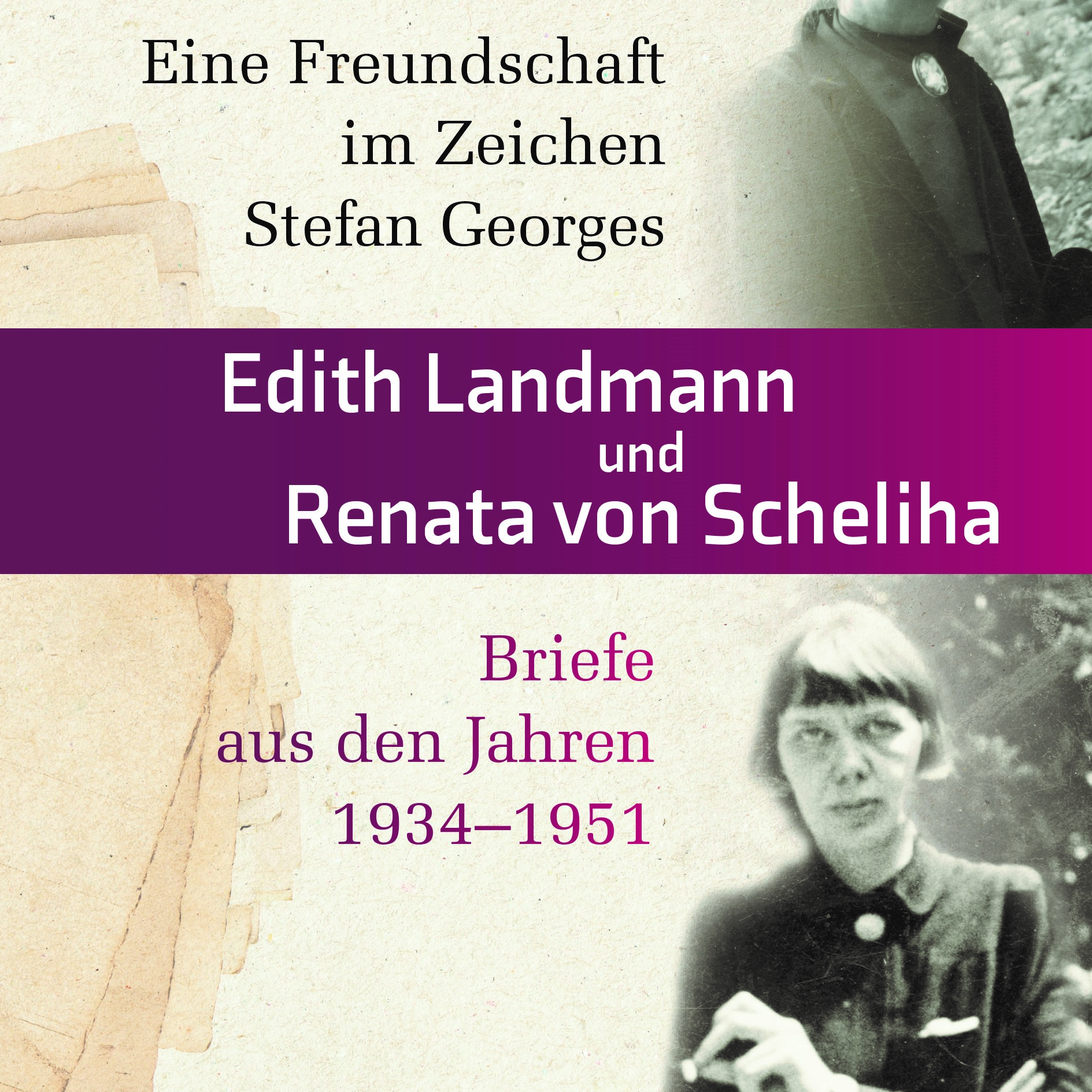
Adorno bemerkte bei Stefan George (1868 -1933) einen mit Evidenz harmonierenden, fatalen Stilwillen. Für Edith Landmann, auch Edith Landmann-Kalischer (1877 - 1951) war der vertraute Umgang mit George ein Lebenselixier. Die mit dem (bis zu seinem Selbstmord 1931 in Kiel lehrenden) Nationalökonomen Julius Landmann verheiratete, im Exil als Lehrerin an der Baseler Volkshochschule wirkende Philosophin erachtete den Dichter als „Meister“. So lautete die schriftliche Anrede des gebürtigen Bingener „O Meister“.
mehr
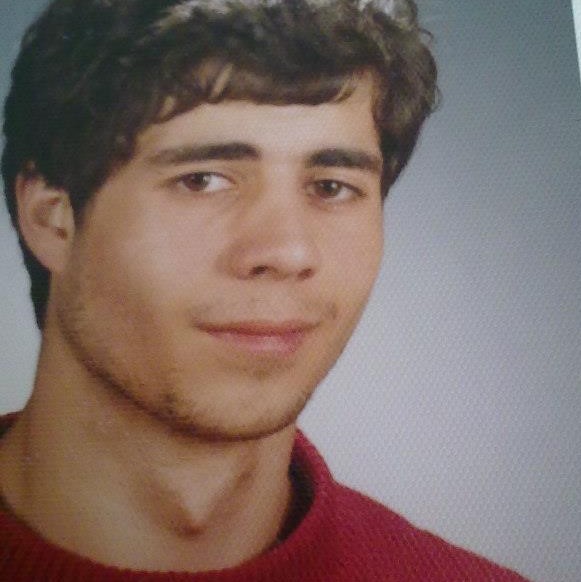
In seiner 1904 erstmals publizierten „Psychopathologie des Alltagslebens“ überliefert Sigmund Freud ein Beispiel für „die zielbewusste Ausbeutung eines Affekts, um eine an sich uninteressante Muskelarbeit mit Lustgefühlen zu laden“. Freud schlägt um die kleine Geschichte einen großen Bogen. Zuerst erklärt er, dass er die Mitteilungen eines ...
mehr
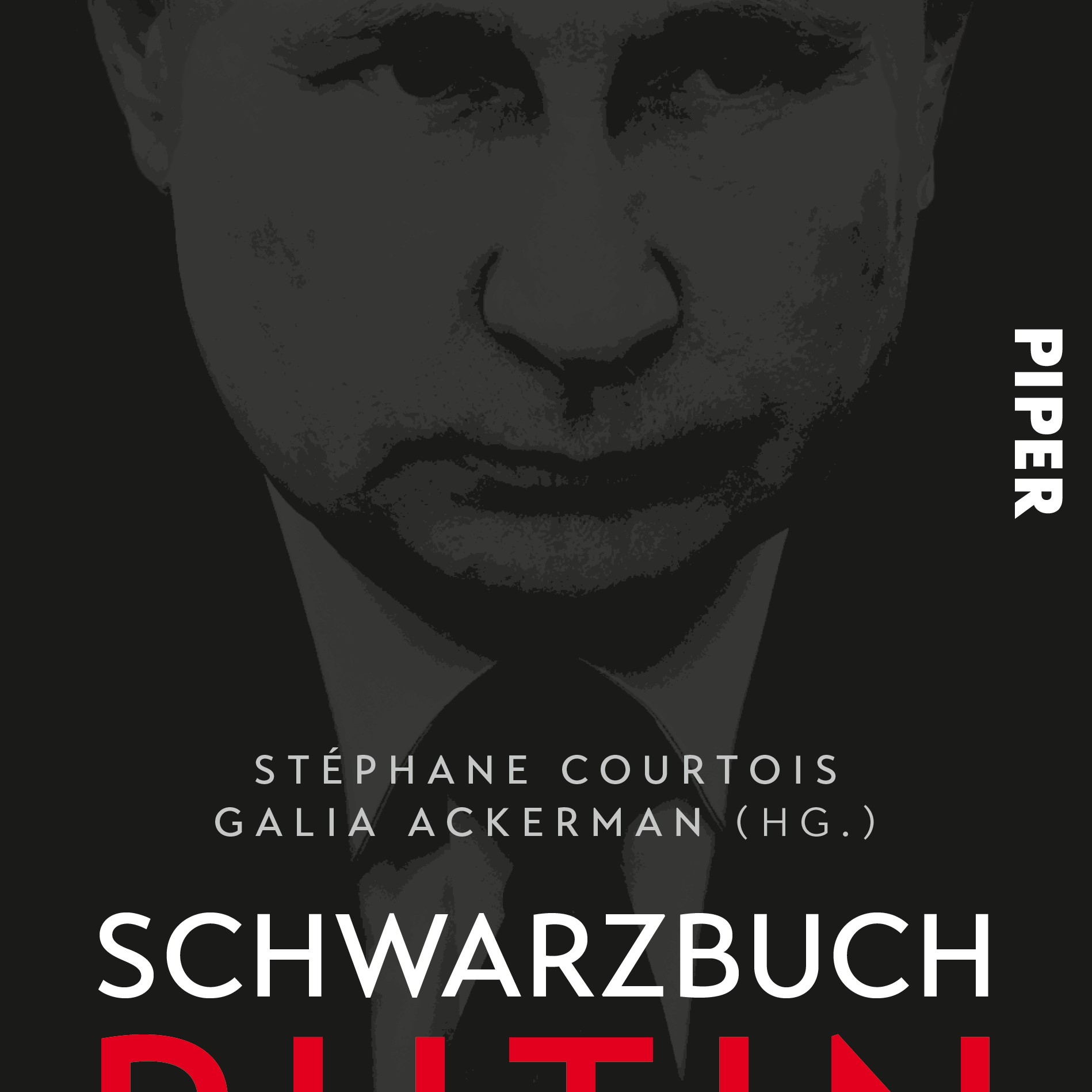
„Das Staunen darüber, dass die Dinge, die wir erleben, im zwanzigsten Jahrhundert noch möglich sind, ist kein philosophisches. Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis, es sei denn der, dass die Vorstellung von Geschichte, aus der es stammt, nicht zu halten ist.“ Walter Benjamin
mehr

Ein zahmer Igel macht seine Honneurs am Strand. Vielleicht hält er sich für eine Taube. Er kennt jeden Hund auf dem Platz. Kein Hund kümmert sich kritisch um den Igel, als wären alle in einem Himmel der Eintracht. Nomaden ruhen in der Sonderstimmung aus. Goya beobachtet den Ingenieur, der den Sommer im Park verbringt. Sein verbrannter Rumpf erinnert an ein vertrocknetes Blatt. Das Hemd trägt er auf dem Kopf, ohne der Abweichung eine besondere Bedeutung zu geben. Der Ingenieur war im Bergbau als fundierte Person. Ein falscher Pegel der Normalität nordet ihn ein.
mehr

Nirgendwo hielt sich die Leibeigenschaft länger als in Russland. Der Historiker Tim Blanning deutet sie als „Reaktion auf elementare Lebensbedingungen“. Er bezieht sich auf Jerome Blum, der vierundvierzig Varianten von Frondiensten - Barschtschina unterscheidet. Die Frondienste konkurrierten mit Geld- und Naturalsteuern (Obrok). In den ukrainischen „Schwarzerde-Regionen“ ergab sich ein Verhältnis von „ungefähr drei zu eins zugunsten des Arbeitsdienstes, während in Zentralrussland die Abgabenpflicht dominierte.
mehr
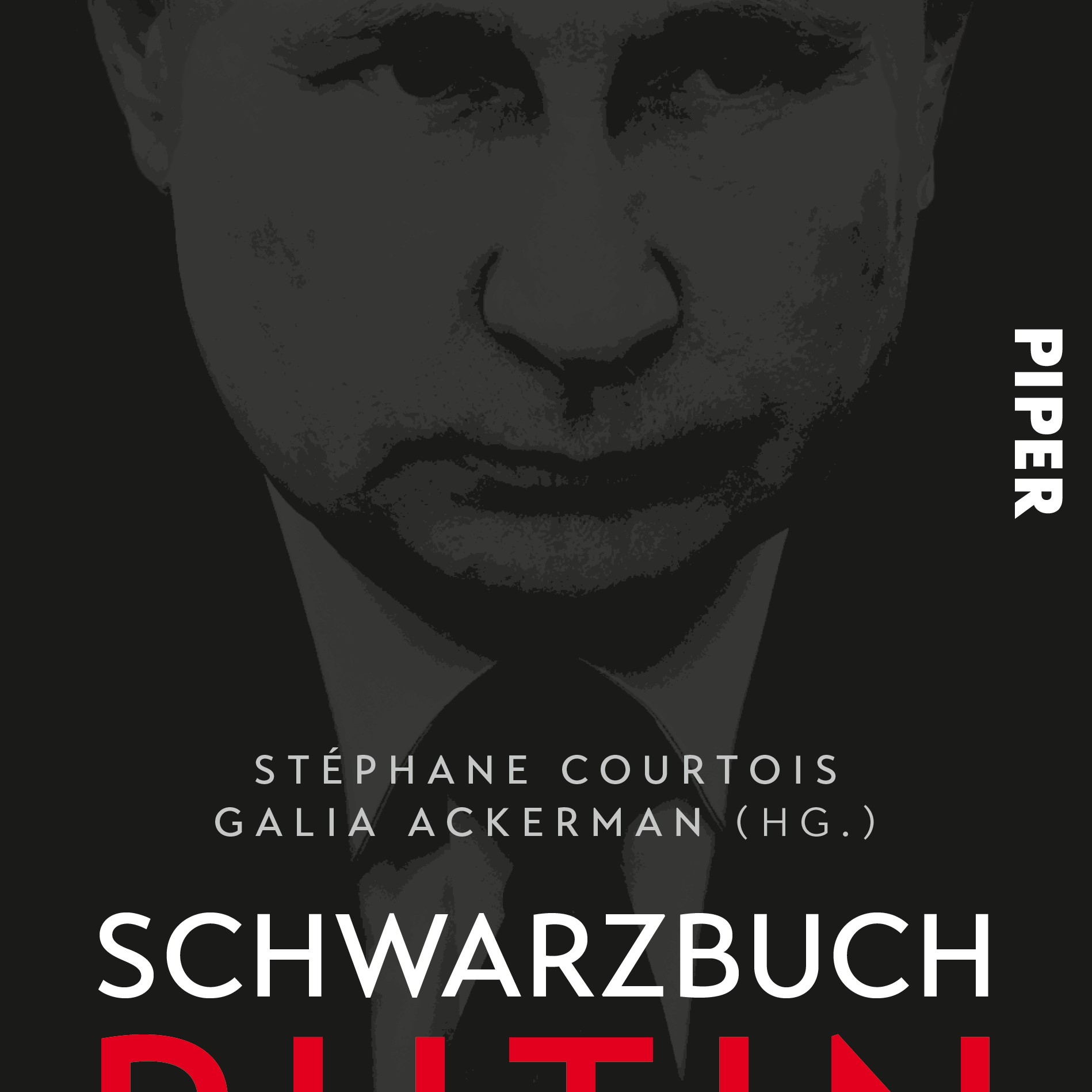
Putin erlebte den Untergang der Sowjetunion als nationales Desaster. Der Aufbruch von Neunundachtzig war für den gelernten KGB-Agenten eine Niederlage im Kalten Krieg. Die Konditionen der postkommunistischen Frühphase beschreibt Putin mit Schlüsselbegriffen aus dem revanchistischen Diktatfrieden-Vokabular militanter Kritiker:innen des Vertrags von Versailles.
mehr

Stammgäste schwören auf Grete und haben sie zur Umsatzkönigin gemacht. Nehmen wir Winnie. Es ist immer gut für zehn dunkle Weizen. Jeden Abend hat Winnie seine dreiunddreißig DM Minimum auf dem Deckel, und wenn Grete Zeit hat und gut aufgelegt ist, lässt sie ihn noch einmal für wenigstens die Hälfte seiner üblichen Zeche komische Sachen sagen. Dabei steigert er sich.
mehr
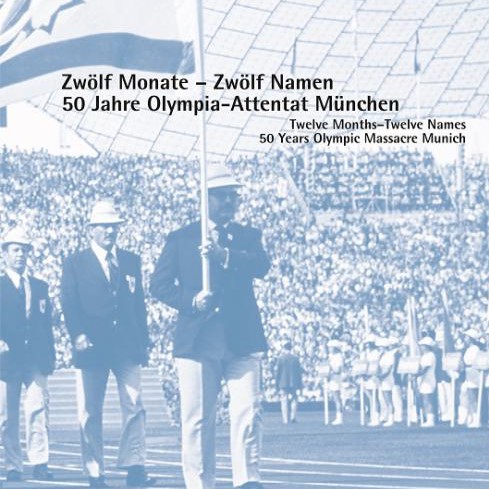
Gab es einen Deal mit den Mördern? In Deutschland fürchtete man sich vor weiteren Terrorangriffen. Die Sicherheitsorgane erkannten darin ein Risiko, dass drei Olympia-Attentäter in einem Münchner Gefängnis einsaßen. Die Terroristen kamen dann merkwürdig reibungslos frei - im Zuge der Flugzeugentführung vom 29. Oktober 1972. Deutsche Behörden schienen vorbereitet. Eilfertig agierten sie im Sinne der Kidnapper.
mehr
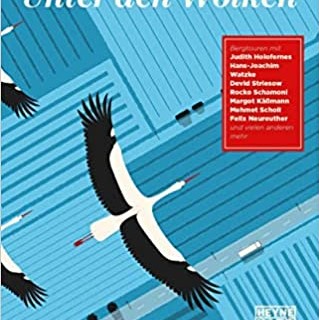
Jahrzehnte war der mit Abhörtechnik gespickte Brocken militärisches Sperrgebiet. Die Anlagen dienten dem Warschauer Pakt als Ohr zum Westen. Die Brockenkuppe säumte eine Mauer. Benno Schmidt handelte sich Rügen und Verweise ein, weil er in der bewaldeten Sonderzone wanderte. Seine Leidenschaft machte ihn zu einem Ziel der Stasi. Am 3. Dezember 1989 wurde der Brocken wieder zivil. Von da an war Benno Schmidt nicht mehr zu halten. Notfalls marschierte er nachts zum Gipfel. Ihn stoppte auch kein Orkan.
mehr
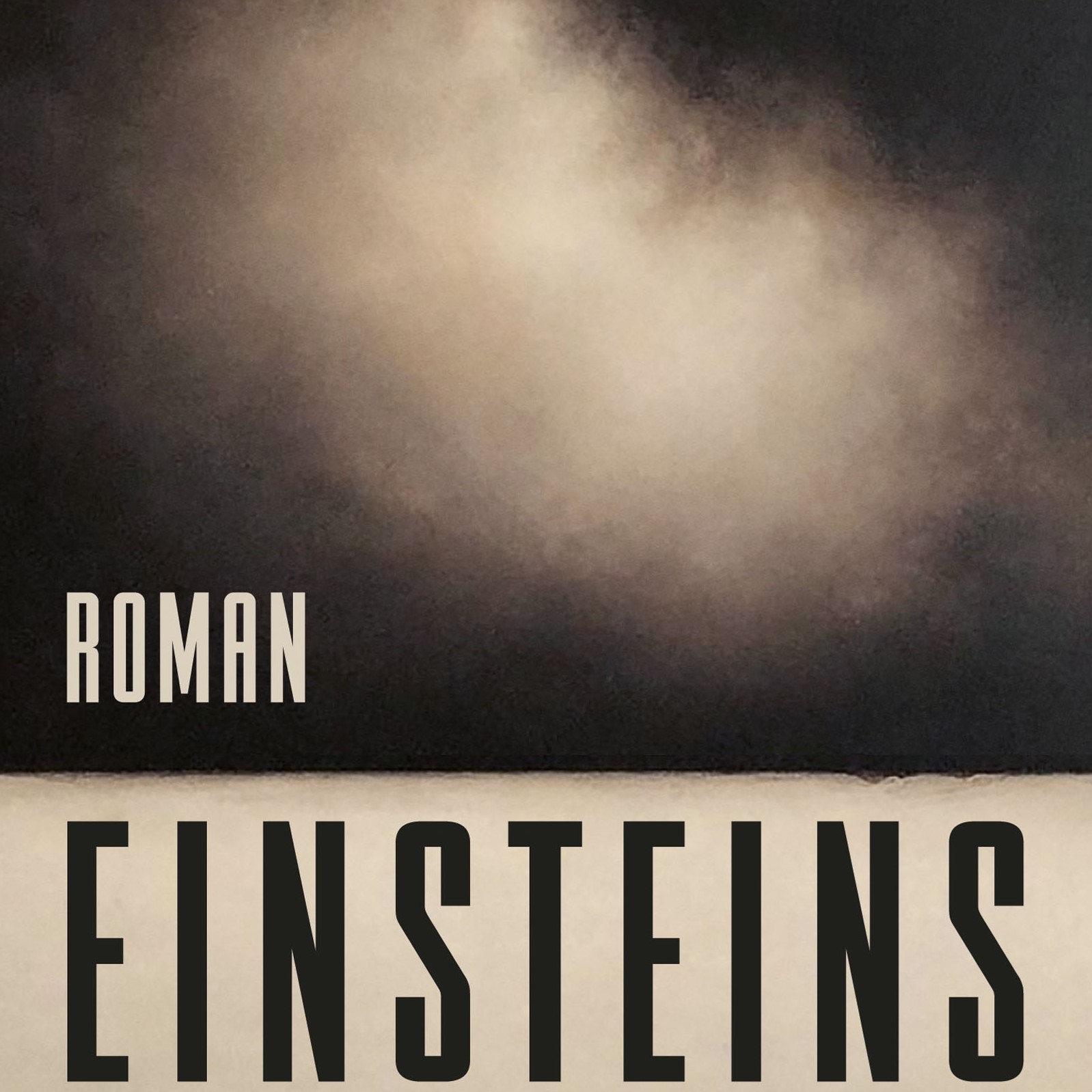
Franzobel umkreist die Folgen eines Zufalls. Zufällig gerät ein durchschnittlicher Zeitgenosse an eine Genie-Trophäe. Harveys Eigenmächtigkeit beschränkt sich nicht allein auf die Leichenöffnung. Die Hirnentnahme erfüllt einen eigenen Tatbestand. Harvey deponiert den in Formaldehyd badenden „Eiweißklumpen“ in seinem Keller. Einsteins Gehirn präsentiert er Leuten, die am kleinen Einmaleins scheitern.
mehr

Im Juni erreicht die Stadt ihre „maximale Vegetationsdichte“. Sam Raymond liebt die letzten Wochen vor der vollen Entfaltung. Während sie joggt, rezensiert sie die Sensationen der Blüte. Sie registriert sämtliche Valeurs der Farbexplosionen. Gleichzeitig reagiert Sam auf eine historische Spur, die sich durch Syracuse zieht. Die 1839 gegründete Stadt im Bundesstaat New York wuchs über eine französische Missionsstation ...
mehr

Ging der Gatte auf Reisen, legte Elisabeth von Thüringen Trauerkleider an. Der Alpenüberquerer Ludwig starb früh in einem maritimen Feldlager der Kreuzfahrer. Die Witwe zog von der Wartburg nach Marburg, während ihre Geschwister, die sie kaum kannte, Gipfelpositionen des europäischen Hochadels einnahmen. Ihr Bruder Béla wurde ungarischer König, ihre Schwester Maria Zarin von Bulgarien. Ihre Halbschwester Yolanda zeugte mit Jakob von Aragon eine charismatische, durch die Jahrhunderte populär gebliebene portugiesische Königin (Rainha Santa Isabel). Elisabeths Tochter - Sophie von Brabant - avancierte an der Lahn zur Stammmutter des Hauses Hessen.
mehr

In den Flammen der Verzweiflung - Im Zuge der Reformation löste Landgraf Philipp der Großmütige das Zisterzienserkloster Haina auf und stellte die Anlage 1533 in den Dienst der Ärmsten und Irrsten unter uns Hess:innen. Philipp stiftete das „Hohe Hospital“ Haina und das Landeshospital Merxhausen (leider noch nach einem heteronormativ-binären Geschlechterverständnis).
mehr
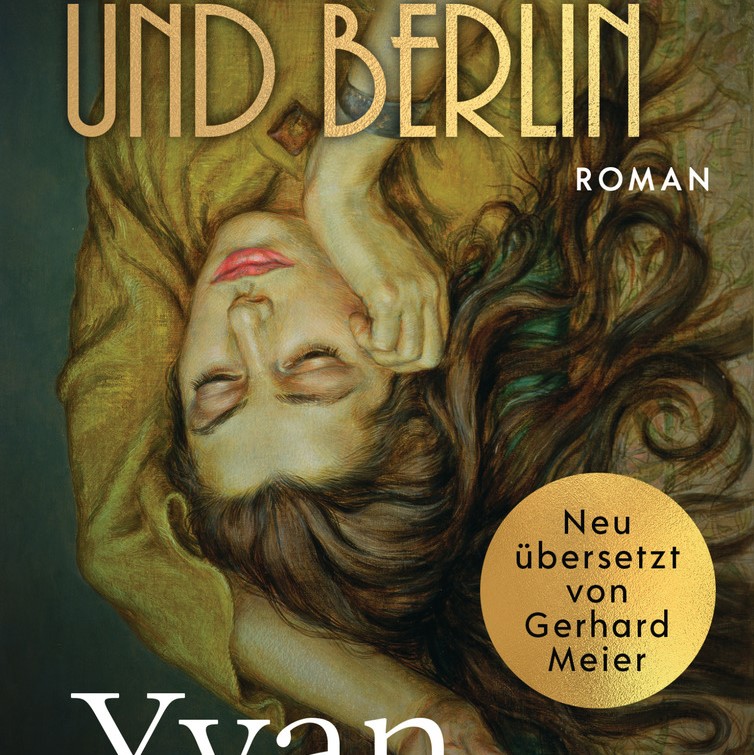
Als Stadt „des Todes“ erscheint ihm Berlin. „Vereist wie die Augen Sterbender“ sind die Fenster, „der Boden (klafft) wie der Schoss einer Gebärenden“. Mit herabsetzenden Absichten vergleicht der Erzähler den überbordenden Brandenburger Mark-Flecken mit der „kochenden Verrücktheit“ Siziliens.
mehr

Die Lage der Residenz- und Hauptstadt des Kurfürstentums Hessen finde ich so vortrefflich wie meine Schwäger. Ein ferner Verwandter überliefert: „Die Schönheit ihrer neueren Theile, die Seltenheiten, die sie enthalten und ihre reizenden Umgebungen (machen sie) zu einem Gegenstande der Aufmerksamkeit aller Reisenden.“
mehr

Goethe strotzt im Fett seiner Patriziergewissheiten. Er „erneuert die deutsche Einbildungskraft“ (Adam Zagajewski). Rilke erfindet sich einen Stammbaum und erdichtet sich seine Bedeutung. Zagajewski wähnt Rilke auf einer „unbändigen Jagd nach Erfüllung“. Frankfurt und Weimar sind epochale Hotspots. Noch in den Topografien spiegelt sich Goethes titanische Geltung.
mehr
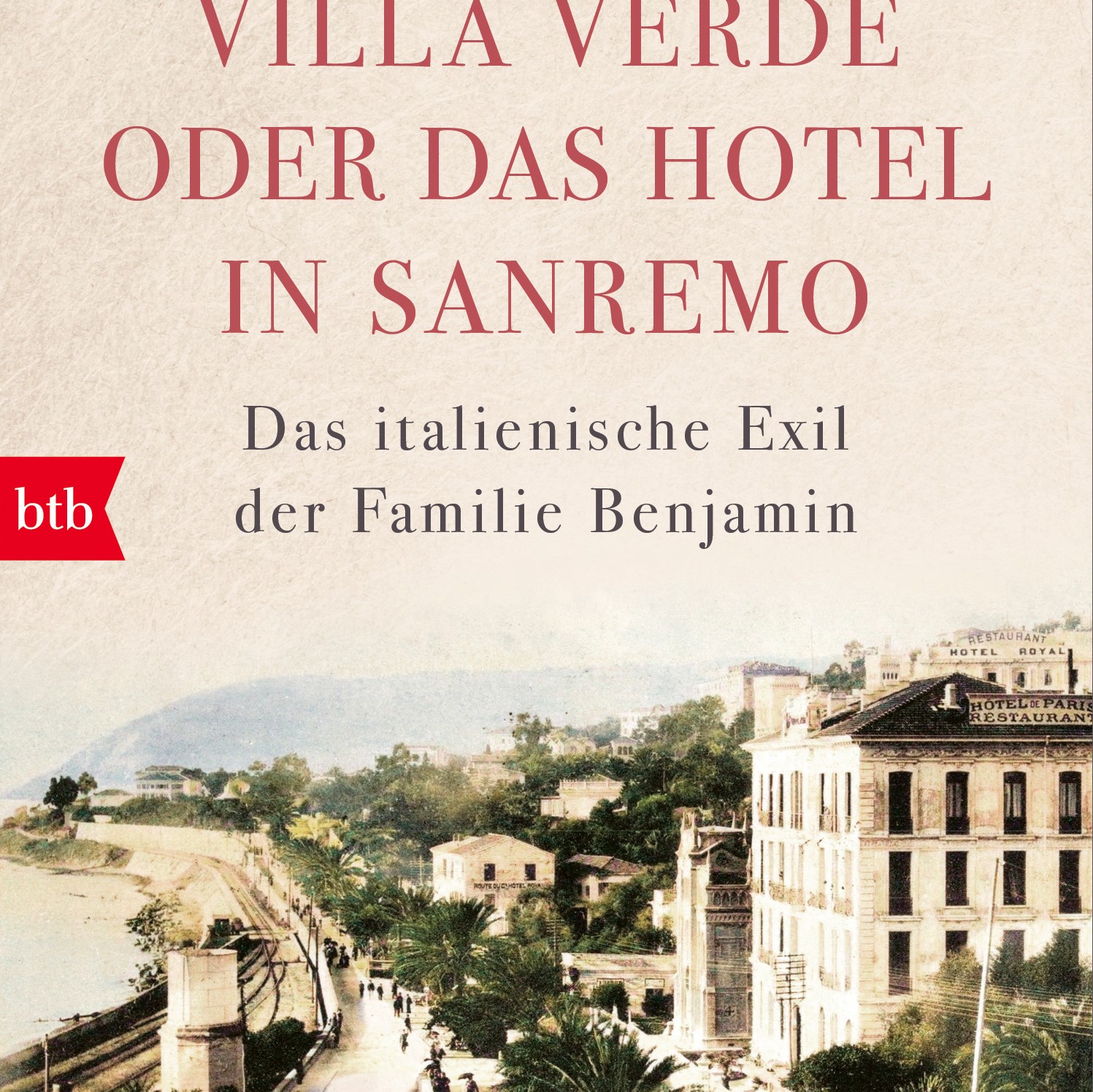
Die Kulturwissenschaftlerin Liliana Ruth Feierstein greift das Wort vom „Portativen Vaterland“ auf. Sie ergänzt es mit der Unterzeile „Das Buch als Territorium“ und versieht den Zusatz mit einem Hinweis auf Walter Benjamin, der sich, nach einer jüdischen Gedächtnistradition, mit der Absicht trug, lauter Zitate zu einem Buch zusammenzutragen. Dazu Bernd Witte: „Jüdische Tradition und literarische Moderne. Heine, Buber, Kafka, Benjamin“.
mehr
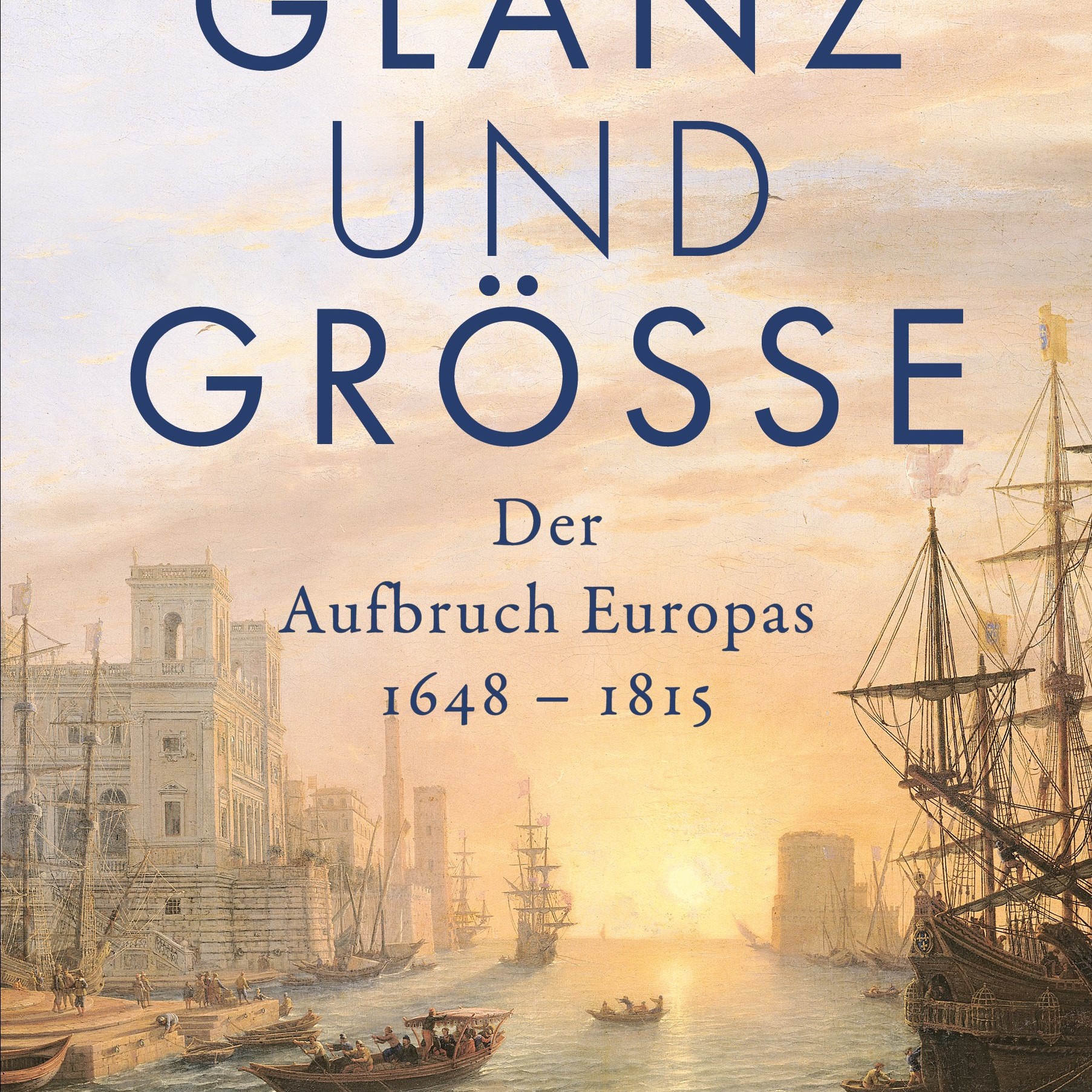
1685 machte Ludwig XIV. Schluss mit dem Protestantismus in Frankreich. Er schuf die reformierte Kirche ab und kurbelte so die Wirtschaft in den Nachbarländern an. Landgraf Carl von Hessen-Kassel (1654 - 1730) rieb sich die Hände, er gewährte Hugenotten Siedlungsfreiheit. Geflüchtete bauten die Kasseler Oberneustadt. Sie revanchierten sich, indem sie in der Residenzstadt den Merkantilismus modellhaft auf die Spitze trieben.
mehr
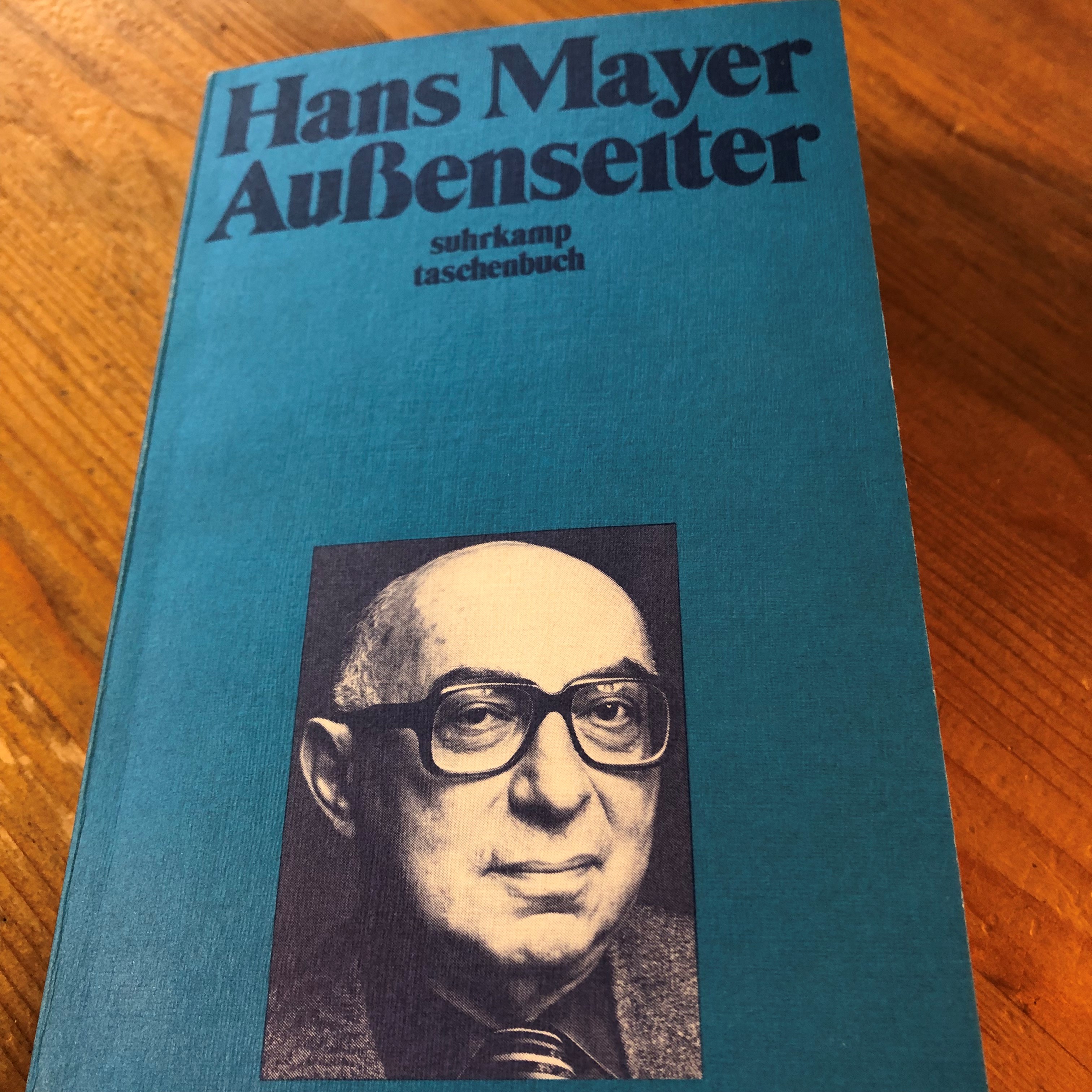
In einem Brief an den aus Kattowitz gebürtigen Juristen und Kritiker Franz Goldstein (1898 - 1982) unterscheidet Klaus Mann hierarchisch lyrische von gedanklicher Schönheit zum Nachteil der glücklichen Fügung und des gelungenen Wortes.
mehr

Michel Foucault beschreibt die Ehe nach Augustinus als paradoxes Projekt. Sie bildet einen frühmittelalterlichen Rahmen für „die Askese der Keuschheit und die Moral“. Sie geht von „freundschaftlichen Beziehungen (aus, die den ehelichen) Frieden gewährleisten“.
mehr
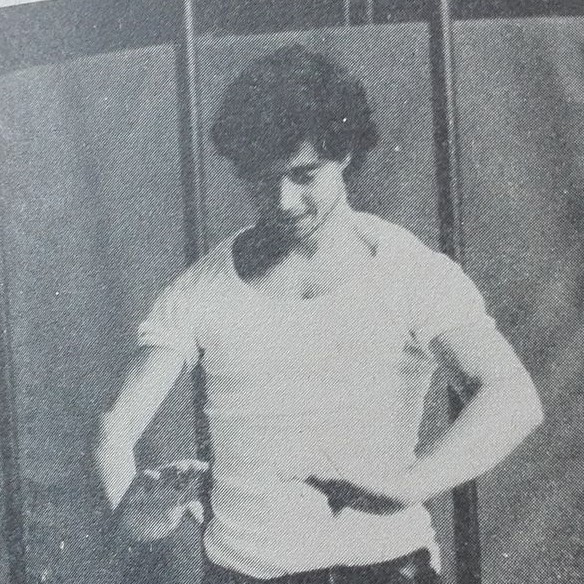
Überall haften Pinnwände, vollgekleistert mit Binsen von Jane Fonda, Mihály Csíkszentmihályi und dem Dalai Lama. Begriffe, deren Bedeutungen in unzulänglichen Übersetzungen untergegangen sind, kursieren im blinden Gebrauch. Wer weiß, was Kanyu bedeutet? Ständig erklärt Meinhof, dies und das sei Kanyu. Keine Jüngerin wagt es, den Meister um eine Erläuterung zu bitten, weil jede glaubt, sie habe die Explikation verpennt.
mehr
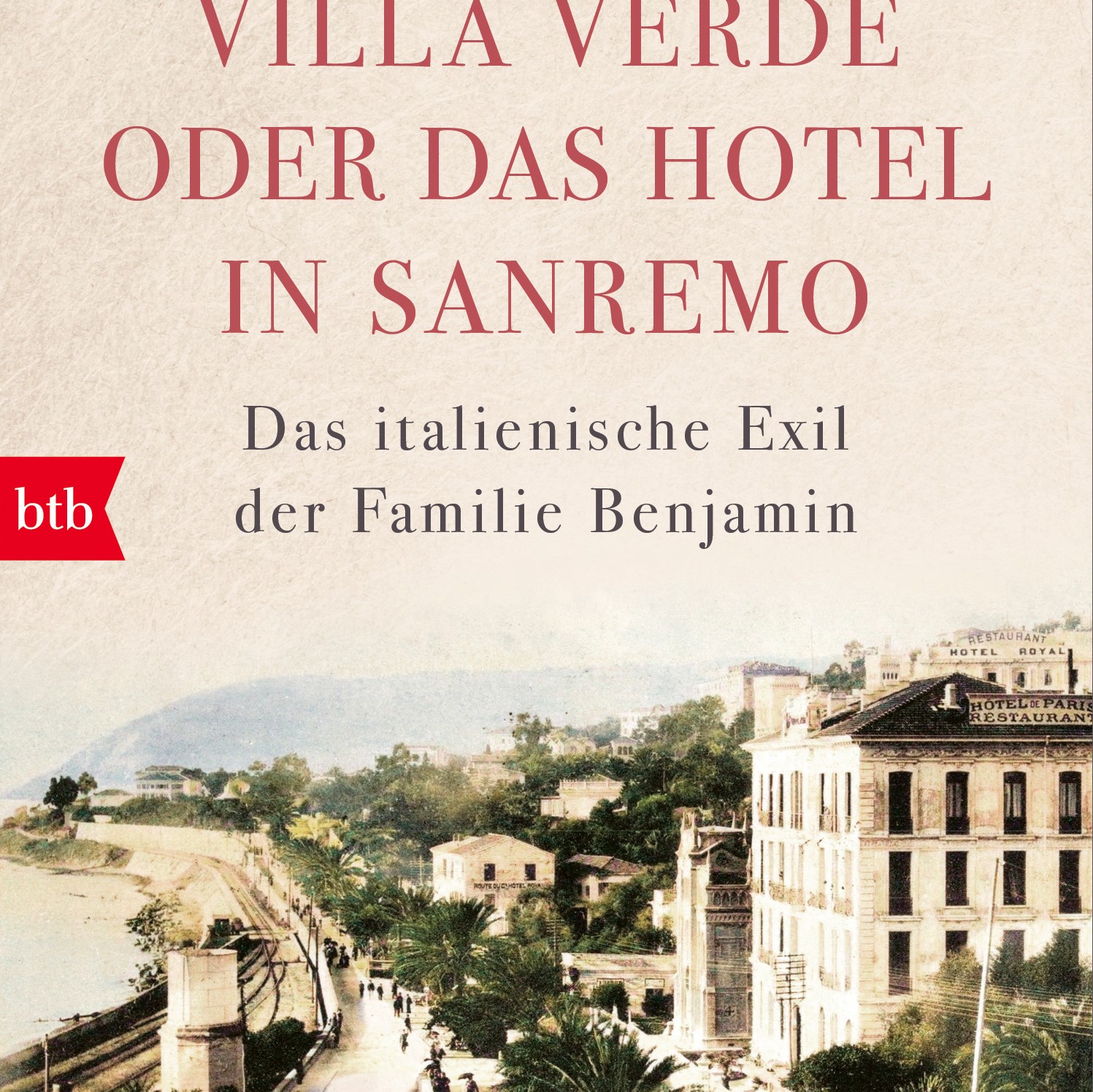
Obwohl sie in einem musischen Milieu sozialisiert wurde, studierte Dora Chemie. 1912 heiratete sie Max Pollak. Die gesellschaftlich avancierte Verbindung konnte auch mit dem „Misstrauen (gegenüber) der romantischen Liebe“ nicht abbruchsicher gemacht werden. Die Ehe wurde einvernehmlich nicht vollzogen. Das distanzierte Paar veränderte sich nach Berlin und quartierte sich in einer japanischen Pension in der Schöneberger Motzstraße ein. Die Autorin schildert einen superdiversen Kiez, in dem allenfalls der Prinz von Theben aka Else Lasker-Schüler auffiel.
mehr

Sie nannten ihn den Irren von Triangel* - Bernward Vesper bemühte sich um die Veröffentlichung der Schriften seines nationalsozialistischen Vaters, während er zugleich „Schriftsteller gegen den Atomtod“ mobilisierte. Gudrun Ensslin gab es damals auch noch als Braut in Weiß. *Triangel gehört zu Sassenburg im Kreis Gifhorn
mehr
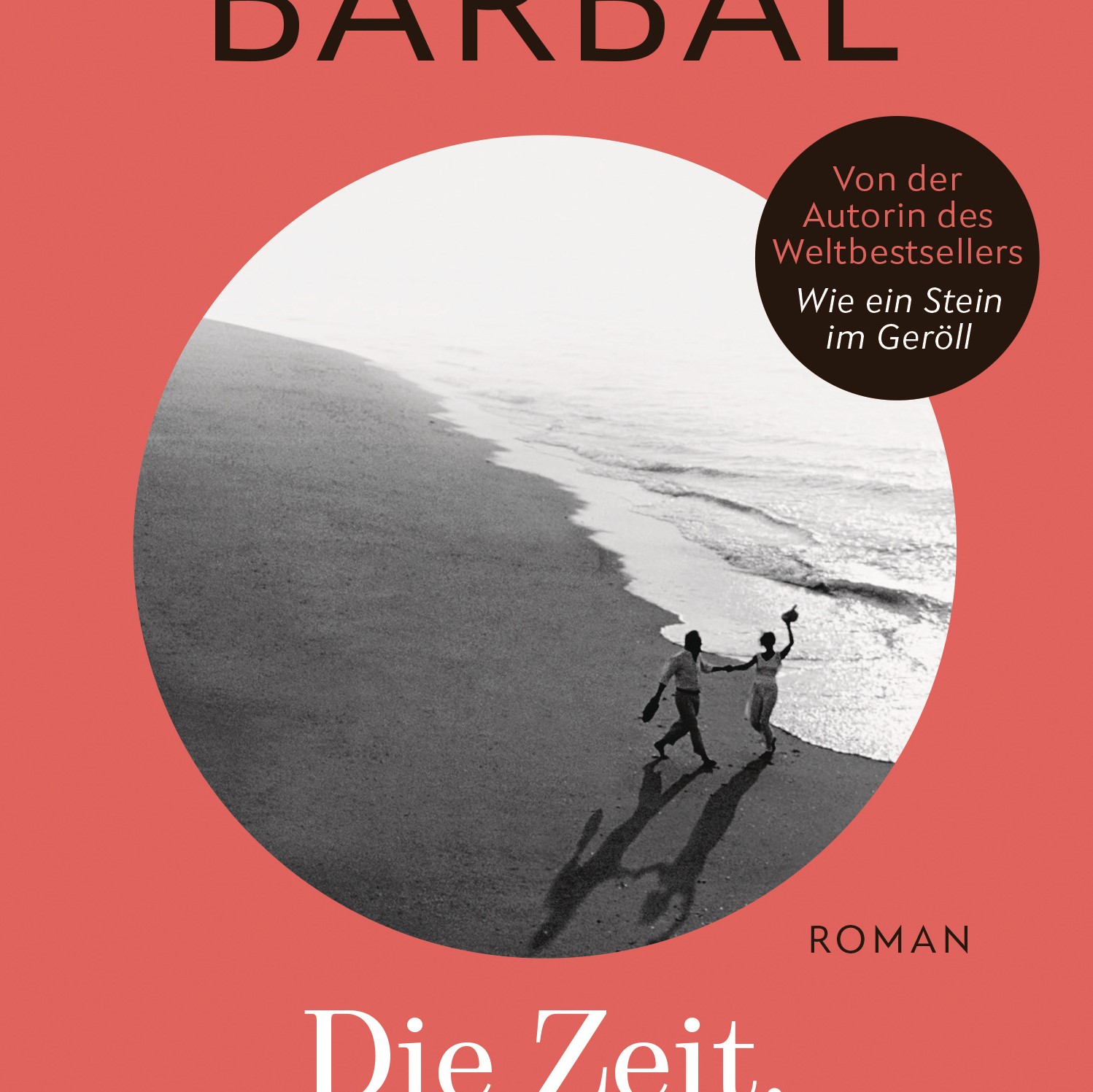
Elena genießt Armands pflichtbewusstes Begehren. Der verwitwete Rentner gibt seiner Leidenschaft einen soliden Anstrich. Obwohl er von Elena hingerissen ist, beschwert er das Verhältnis nicht mit Forderungen. Er erfüllt ihre Erwartungen auch als aufmerksamer Zuhörer. Sie spricht gern über ihre Zeit als Lehrerin von Vorschulkindern. Ihm käme es nicht in den Sinn, ihr mit handwerklichen Binsen zu kommen.
mehr
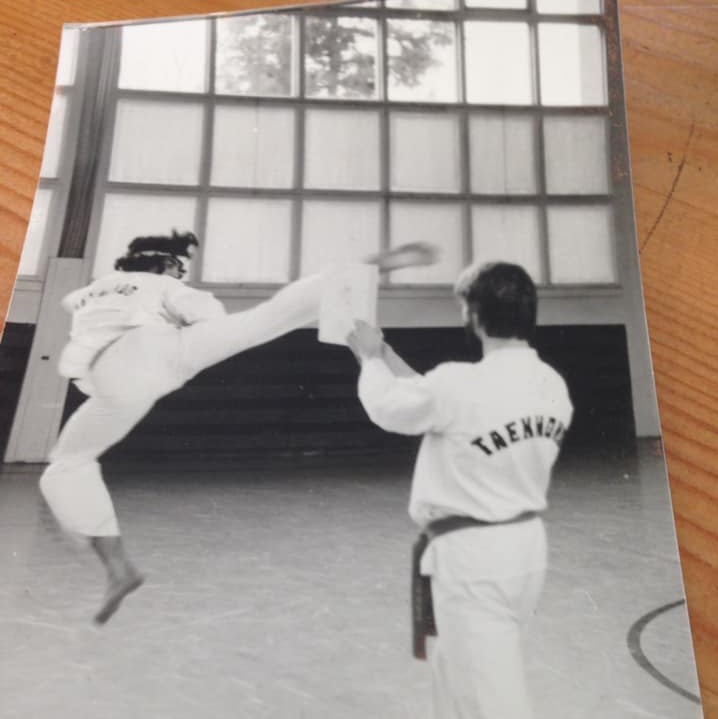
Emotionale Ladungen gibt Heiner Müller oft als Zitate aus. Brecht, Shakespeare, aber auch Wagner: „Die Revolution interessiert mich erst wieder, wenn Paris in Flammen steht.“ So überliefert sich die Reaktion auf einen Theaterfehlschlag im egomanischen Gruß- sprich Großwort. Es gibt Absetzbewegungen: „Im keltischen Nebel“ findet Müller nichts brauchbar, „erst die Renaissance hat die Kulturräume getrennt.“ Womit wir wieder bei der Pest sind - als einer Ouvertüre der globalen Veranstaltung Moderne. Das bricht sich dann an Müllers Vorliebe für das Deutsche. Ihn interessiert „der gotische Brecht“.
mehr
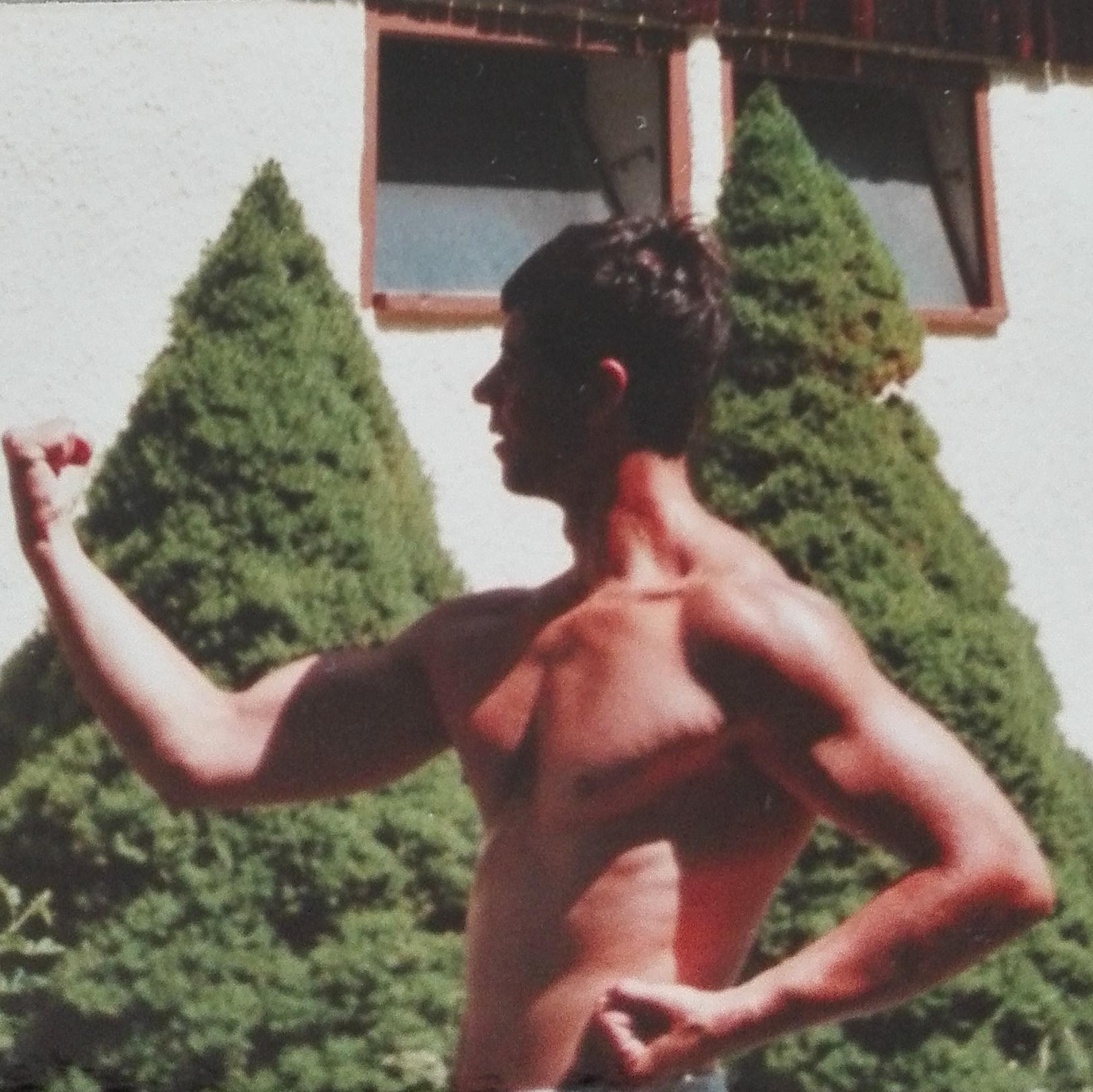
Herta Grabowski hatte ihre Briefe an Willi Umbach kurz vor dessen Tod eingesackt und mit seinen Liebesbriefen an sie in einem Bündel vor der nordhessischen SPD-Legende versteckt, mit der sie verheiratet war. Nach Hertas Tod stieg ein Rollkommando der Verwandtschaft durch das Gebirge der Hinterlassenschaft. Hertas Großneffe Nils fand die Briefe. Sie stempelten Herta zur Ehebrecherin und erklärten die notorische Verstimmung ihres, vor Herta verstorbenen Mannes.
mehr
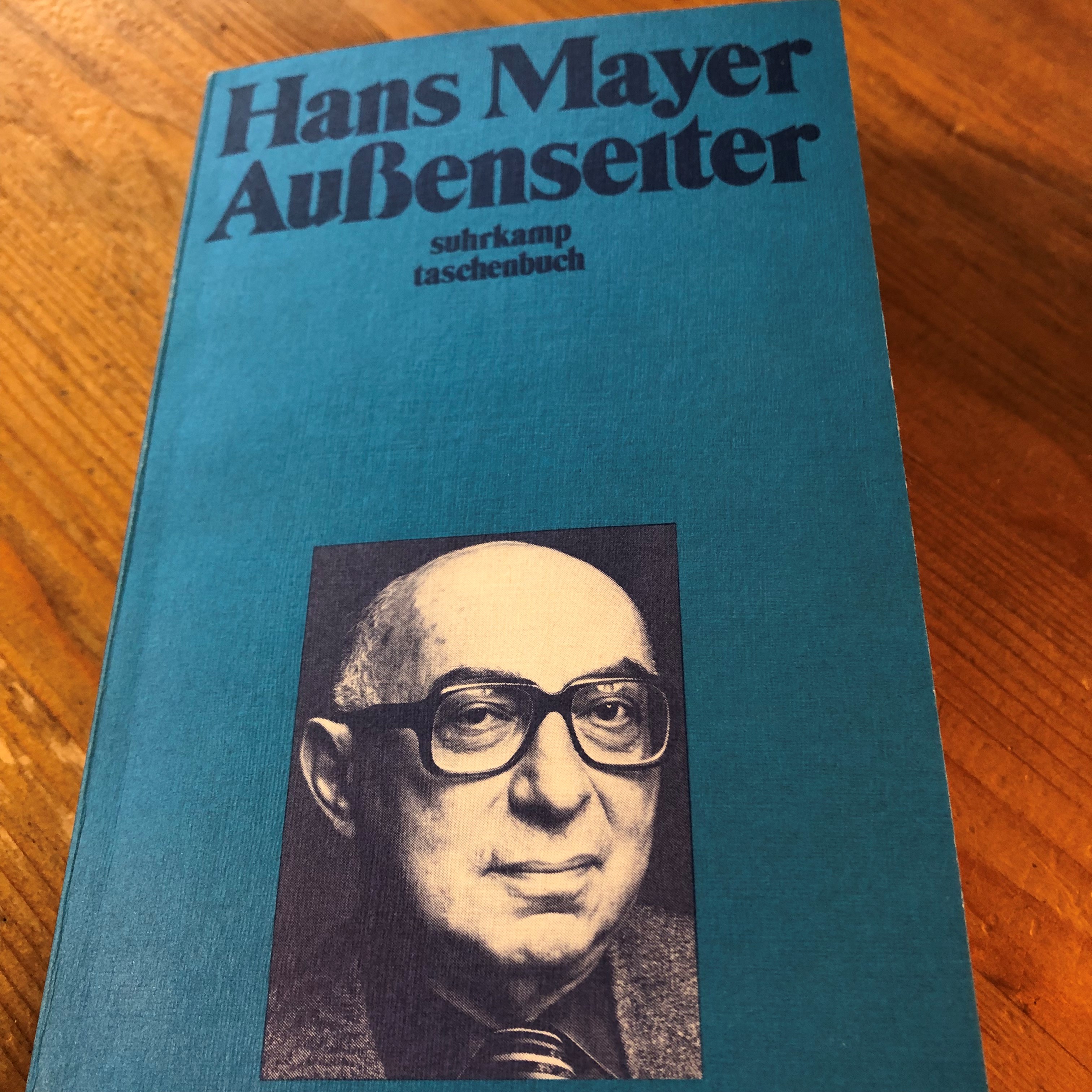
„Gespräche am Stammtisch“ - Unter dieser Überschrift berichtet der SPIEGEL 1954 im Konfrontationsjargon des Kalten Krieges von einer kulturellen Ostwest-Begegnung im historischen Dunstkreis der anstehenden westdeutschen Wiederbewaffnung und Eingliederung in die NATO.
mehr
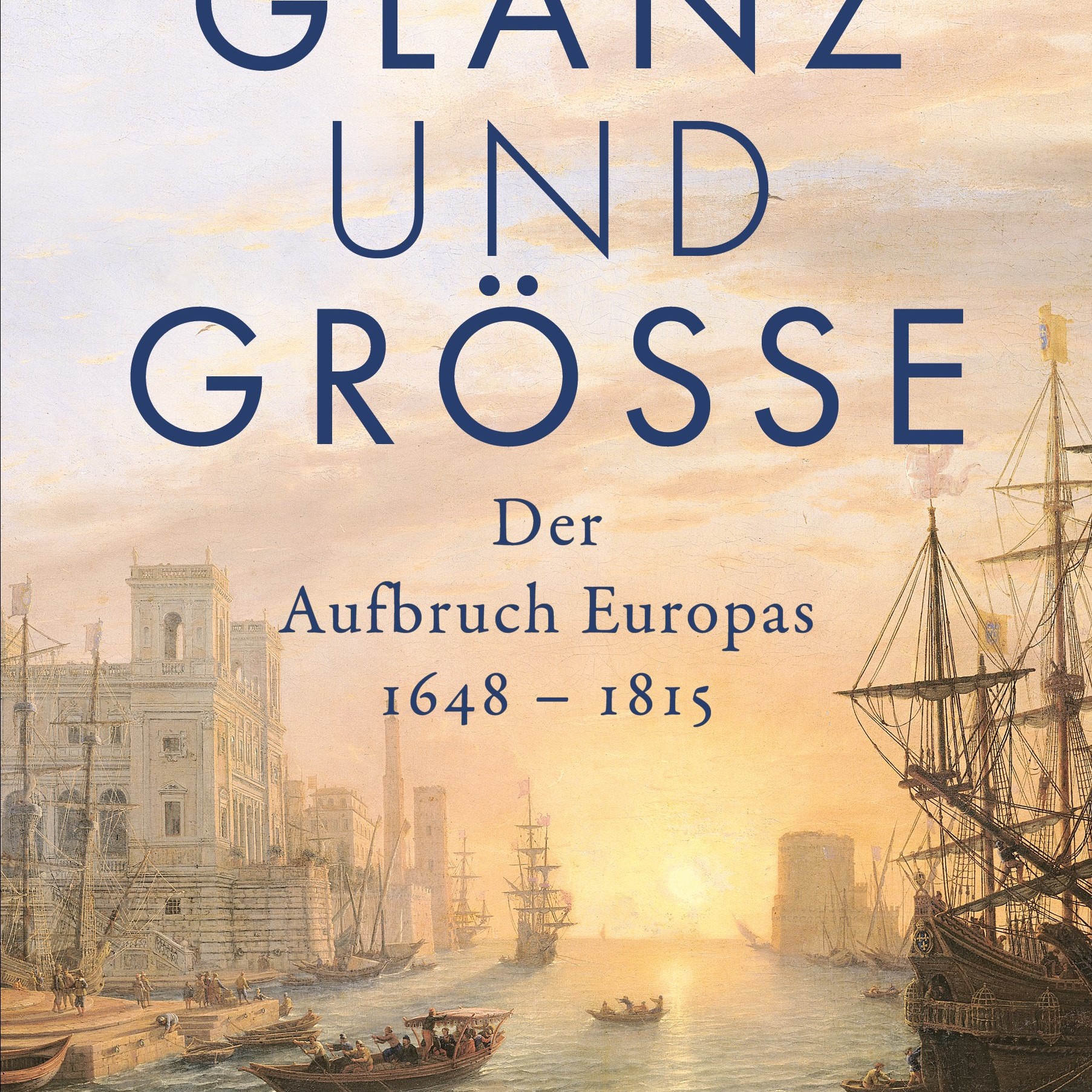
Bis ins ausgehende 18. Jahrhundert besorgten berittene Dienstboten die Post. Erst 1784 etablierte der Theaterimpresario John Palmer eine reguläre Postkutschenverbindung von Bristol nach London. Die englische Reisedurchschnittsgeschwindigkeit war doppelt so hoch wie die niederländische. Englische Reisende beklagten den Kontinentaltrott von drei km/h. Die Niederländer:innen nutzten vor allem Wasserwege. Im Rahmen des ersten planmäßigen Personen- und Güterverkehrs wurden Kähne von Pferden gezogen. Daraus ergab sich ein konkurrenzlos günstiger Linienbetrieb. Besonders bemerkenswert fand man Bordrestaurants.
mehr

„Das ist die Flucht ins Reservat“, kontere ich. Isolation ist Rückzug. Ist Selbst-Marginalisierung. Die Desintegration in den Milieus der Einwanderinnen hängt zusammen mit dem Umbau der SPD und der Gewerkschaften. Im Zuge eines globalen Industriestrukturwandels verlieren diese Motoren ihre Kraft als Integrationsmaschinen. In die preisgegebenen Räume stoßen Systeme der Selbstorganisation wie Milli Görüs. Islamische Gemeinden setzen der Straße etwas entgegen, sie schaffen Anreizstrukturen.
mehr
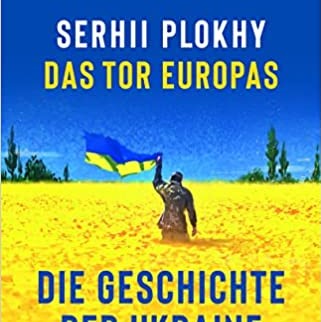
„Jedes Mal wenn die Kosaken hier am Schwarzen Meer auftauchen, erbeuten sie trotz ihrer schwachen Kräfte unglaubliche Reichtümer und verbreiten so viel Angst und Schrecken, dass man die türkischen Soldaten nur mit Knüppelschlägen dazu bringt, gegen sie mit den Galeeren auszurücken, die … der Sultan mit großer Mühe dorthin schickt.“ Graf Philippe de Harlay von Césy 1620 an König Ludwig XIII
mehr
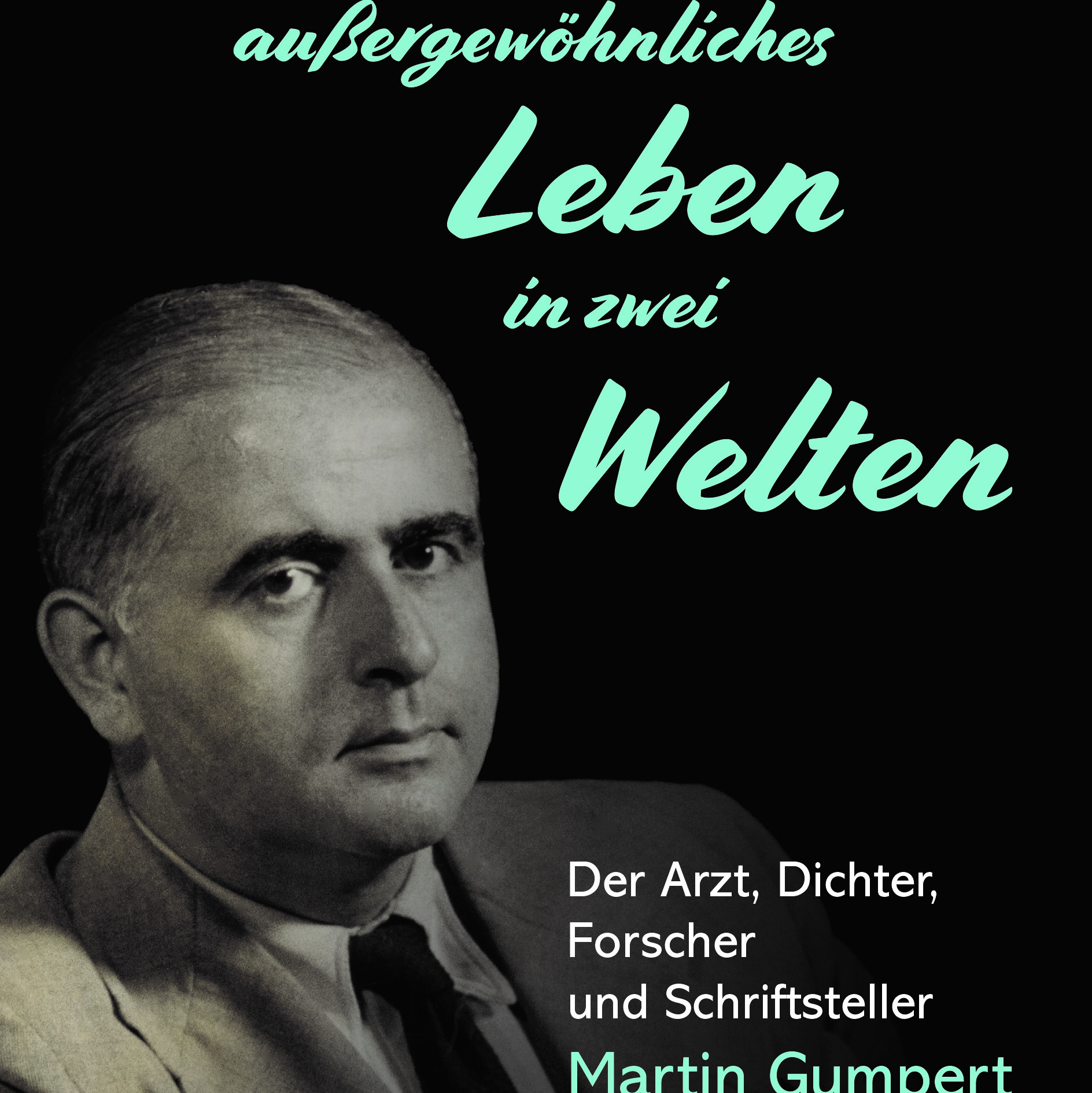
Ulrike Keim erzählt Martin Gumperts Lebensgeschichte in ebenso anschaulicher wie unterhaltsamer Weise. Die Autorin beginnt mit dem Schlusspunkt, den ihr Held gezwungenermaßen in Deutschland setzte. Im Frühjahr 1936 überquerte Gumpert die belgische Grenze bei Aachen.
mehr

Wolf hatte die Nacht mit Courtney verbracht. Marianne fand, dass Wolf zu schnell zur neuen Tagesordnung überging. Politisch war er genauso unreif und vernagelt wie Courtney. Jedenfalls war Marianne nicht bereit, Brötchen zu holen, obwohl der Gang zur Bäckerin nicht allein ornithologische Gewinne versprach. Marianne gefielen Spielarten „der gefiederten Stadtbewohnerinnen“. Dies als Beispiel für Mariannes blumigen ...
mehr

Eine gemütliche Runde am Saum der Autobahn. Ein Ensemble aus Bürzeln und unbewusster Eleganz. Ein halbes Dutzend Rehe äst verträumt auf einem dezemberkahlen Feld nahe einem - im Unterholz verpackten - zur Abflussrinne degradierten Bachlauf. Jenseits der Wasserlinie stehen Pappeln Spalier. Die Szene nehme ich in aller Fahrerflüchtigkeit wahr. Im nächsten Augenblick taucht wie (in einer Albtraumsequenz) ein Rudel auf. Es hetzt über die Flur den Ahnungslosen entgegen. Noch haben die Rehe kein Repertoire für den alten, lange abwesenden Feind. Noch haben die Brandenburger Wölfe ihre neuen Reviere nicht in Angstlandschaften für Rehe verwandelt.
mehr
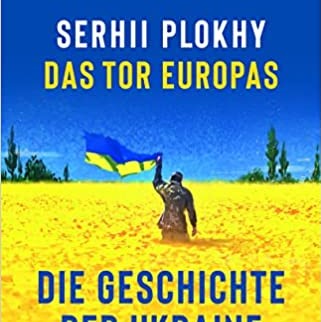
Das Zukunftsdesign der EU sowie der NATO gestalten Gesellschaften, die nach dem Ende des Warschauer Pakts ihre Unabhängigkeit erlangten. Sie verstehen nicht, weshalb der alte Westen auf den Ohren sitzt. Im Mai 2022 fand die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Irina Wereschtschuk deutliche Worte: „Warum wurde Nord Stream 2 gebaut, warum haben sie nicht auf Polen, die Ukraine, Litauen, Estland gehört, die Länder, die Sie gewarnt haben, dass es bei Gas und Öl für Putin um Politik geht, nicht um Wirtschaft?“
mehr
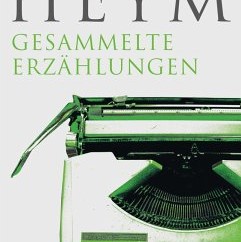
Mit Horst Brasch, der nach England exiliert war, teilte er das Schicksal der „falschen Emigration“. Stefan Heym kam aus dem großen Amerika in die kleine DDR. Da belebte er den sozialistischen Realismus mit Hollywood-Stilmitteln. Er spielte in der Brecht-Liga, geschützt von einem Idealismus, der ihm ständig Gründe gab, auf seiner unergründlichen Linie zu bleiben. Heym war weder Dissident noch SED-Sprachrohr. Was ihm die realsozialistische Ernüchterung nahm, holte er sich aus der Bibel zurück.
mehr
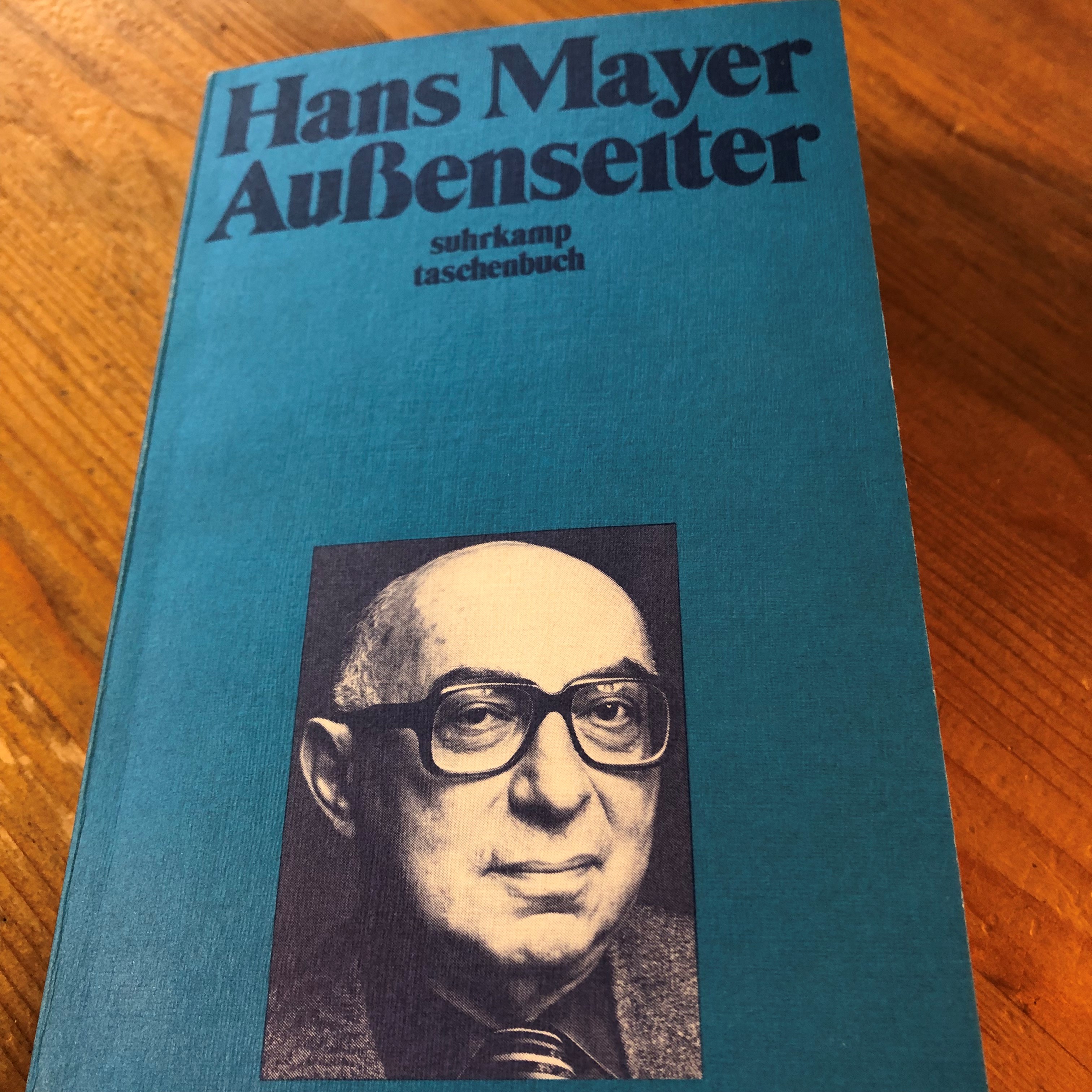
Befreundet und liiert war sie mit Alfred de Musset, Frédéric Chopin, Prosper Mérimée, Franz Liszt, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Gustave Flaubert und einem Dumas. Hans Mayer vergleicht George Sand mit Rahel Varnhagen, die in ihrem Berliner Salon „den doppelten Skandal der jüdischen Herkunft und weiblichen Emanzipation überspielen (musste)“. Ihr Urgroßvater zählte zur Riege der unehelichen Söhne von August dem Starken, dem Kurfürsten von Sachsen und König von Polen.
mehr

Ein Abend in der Berliner Philharmonie. Santtu-Matias Rouvali dirigiert die 5. Sinfonie von Sergei Prokofjew. Nach dem ersten Satz wird geklatscht. Ohne Blickkontakt zum Publikum unterbindet der Dirigent den unerwünschten Zwischenapplaus mit einer kleinen Bewegung der linken Hand. Mit einer einzigen Geste bringt er den Saal zum Schweigen.
mehr
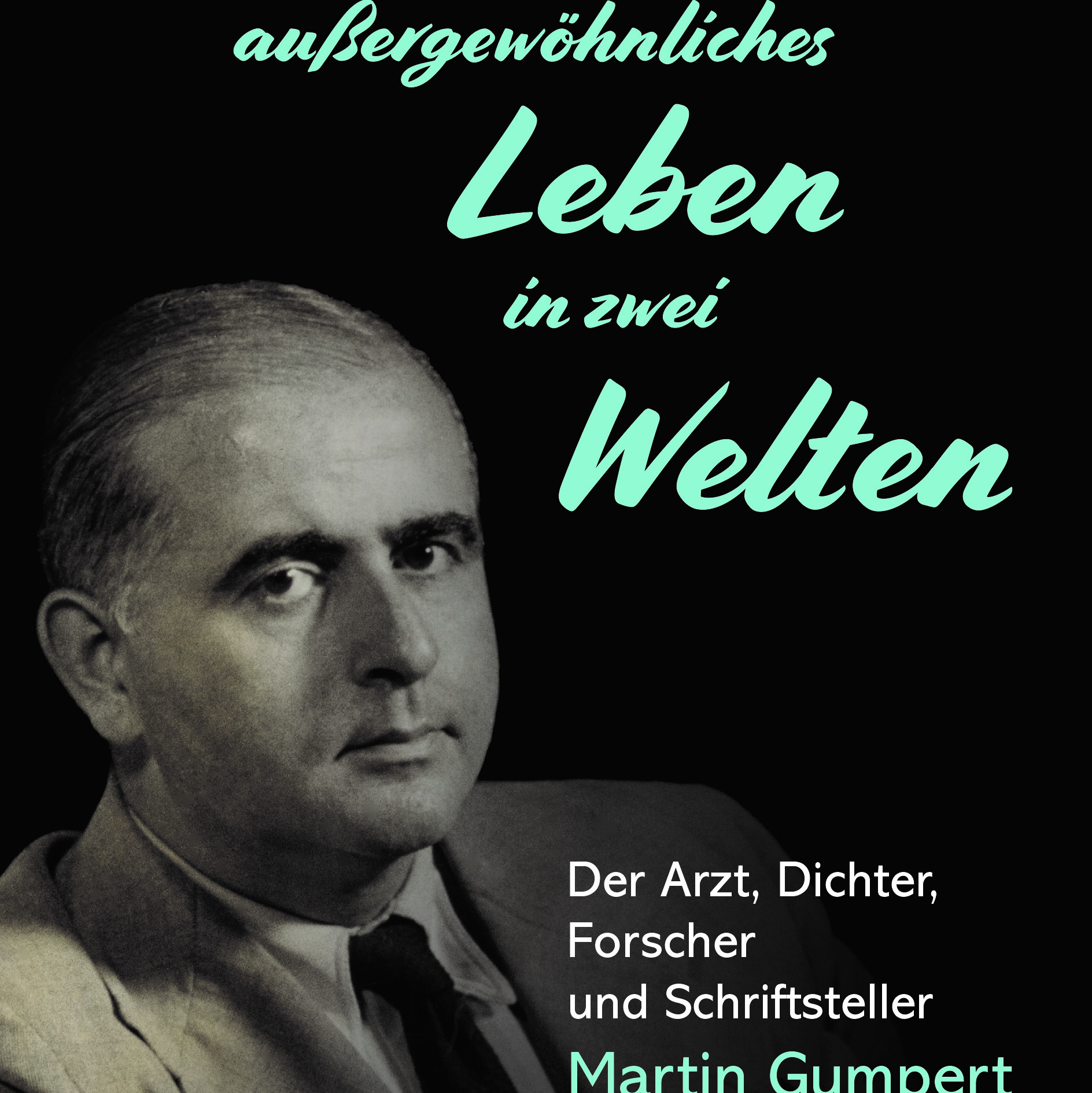
Geboren wird er im selben Jahr und in derselben Stadt wie Gershom Scholem. Der Arztsohn Martin Gumpert (1897 - 1955) zählt zu jener Abteilung des gehobenen Berliner Mittelstandesnachwuchses, die ihre kulturelle Prägung im Stimmungsspektrum zwischen Gründerzeit, Fin de siècle, Belle Époque, Art Déco und Expressionismus erhält. In der väterlichen Praxis geben sich eine kaiserliche Hofdame und Rosa Luxemburg die Klinke in die Hand. Auch Frank Wedekind konsultiert Dr. Ely Gumpert.
mehr
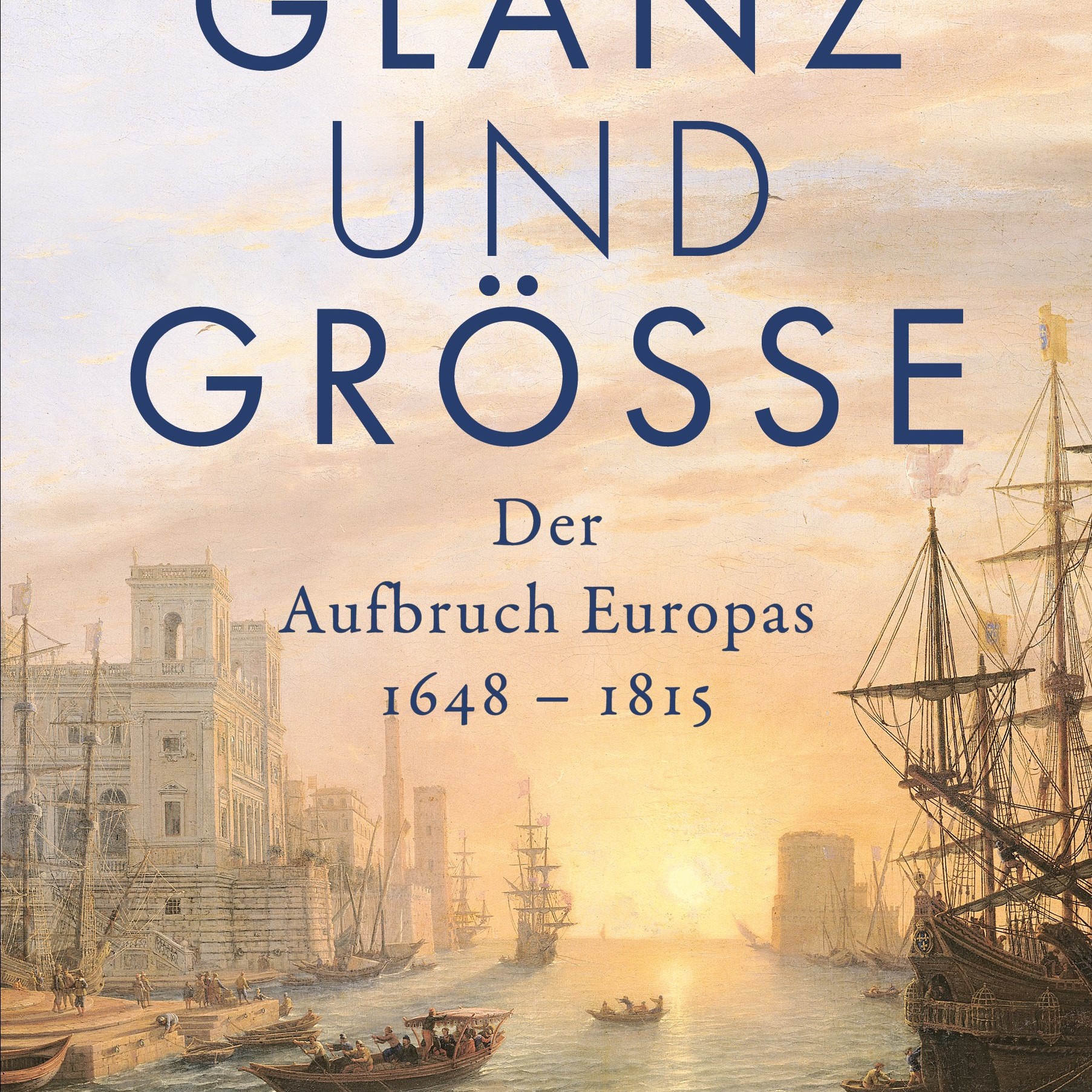
„Selbst die Hauptstraßen jener Tage würden heute als Waldwege gelten.“ Tim Blanning über viele Verkehrswege auch noch im 18. Jahrhundert
mehr
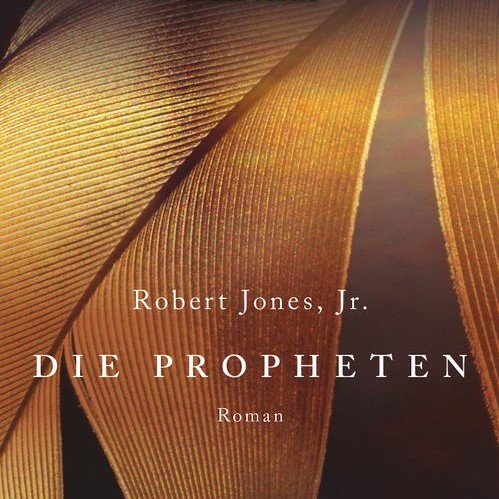
„Empty“ heißt Maggies Ort der Verdamnis irgendwo in Mississippi. Maggies Stellung im Plantagengefüge fehlt die Eindeutigkeit. Kaum eine Schwarze kommt ihren Eigentümern ständig so nah wie Maggie. Die aus Georgia gebürtige Haussklavin steht mit den intimen Gewohnheiten der Familie Halifax auf vertrautestem Fuß. Man erleichtert sich vor ihr wie vor einem Pferd im Stall. Da gibt es keine Schamgrenze. Deshalb weiß Maggie, dass die Herausgeputzten für Reinlichkeit wenig übrighaben. Als könnte sie nichts beflecken.
mehr
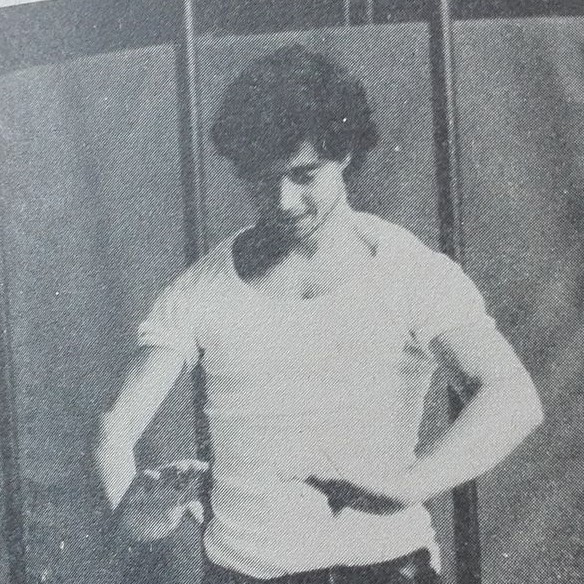
Höhere türkische Töchter am Nebentisch. Wahrscheinlich verbringen sie gestohlene Zeit. Ihre Mappen passen Ton in Ton zu Lederjacken, die Stühle vor einer Besetzung sorgfältig bewahren. Die Mädchen würden eher sterben, als sich die Blöße einer unschönen Haltung zu geben. Ihre Disziplin ist kaum zu glauben. Wie vor einer Kamera
mehr
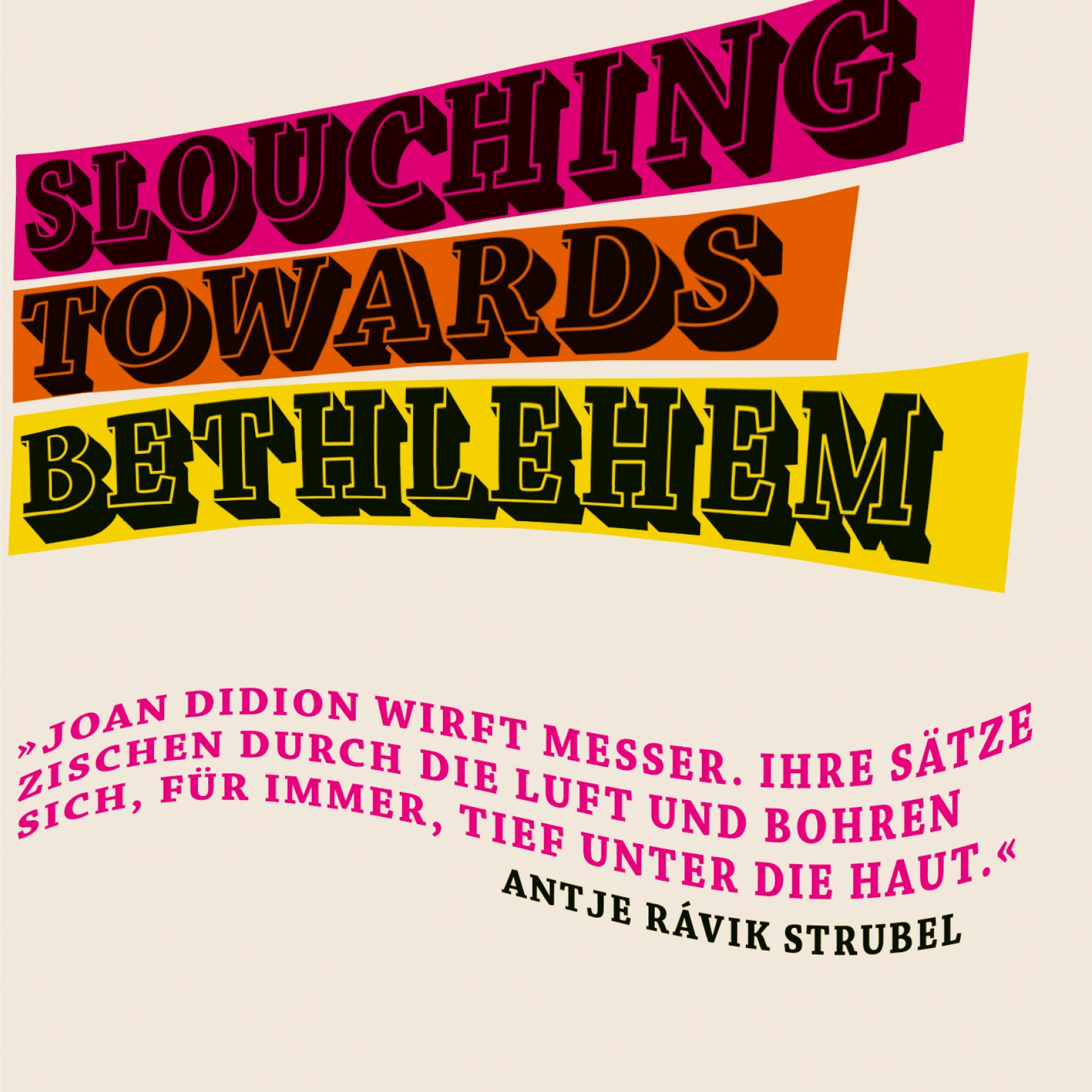
„Ich (war) aus dem Westen gekommen und in einer Fata Morgana gelandet … Ich … spürte den weichen Wind an meinen Beinen, der aus dem U-Bahn-Gitter kam.“ Joan Didion über ihren New Yorker Anfang
mehr

Die Stiftung ZURÜCKGEBEN. Stiftung zur Förderung Jüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft gibt ihre Stipendiatinnen für das Jahr 2023 aus den Bereichen Literatur, Film, Theater, Illustration und Kultur bekannt. Projektförderungen in der Gesamthöhe von 30.000 Euro erhalten: Lena Gorelik (München), Liora Hilb (Frankfurt a. M.), Alisa Khaet (Halle), Darja Lewin (Berlin), Yael Peri (Berlin), Sharon Ryba-Kahn (Berlin) und Katharina Hadassah Wendl (Berlin).
mehr
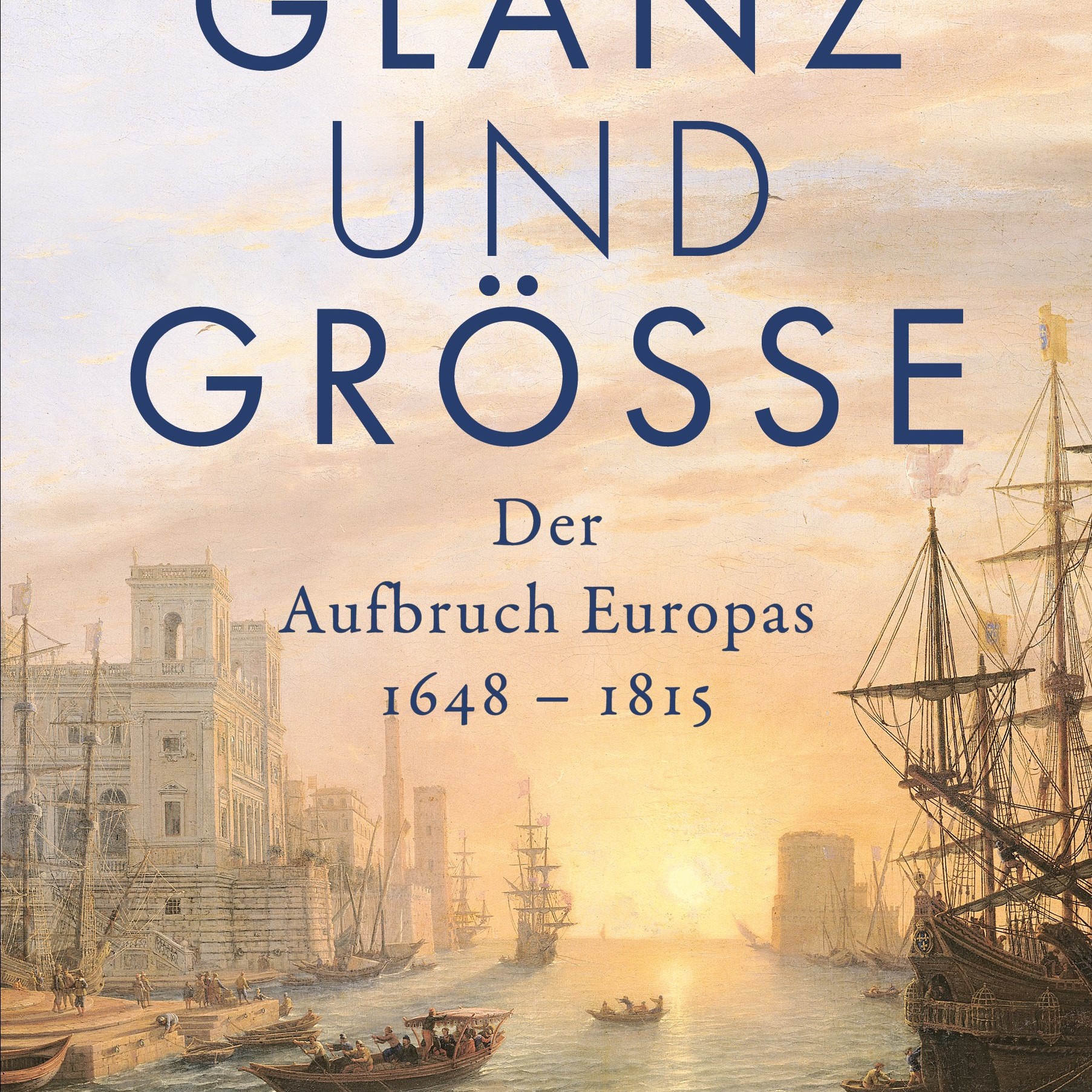
„Wenn einen das Schicksal der Ukraine kalt lässt, dann stimmt etwas nicht mit einem.“ Niall Ferguson „über die Lust am Untergang, das Versagen des Westens in der Ukraine-Politik und die Gefahr eines Atomkriegs“ in einem Interview am 15. Dezember in der Süddeutschen Zeitung
mehr

Ich war schon nicht mehr jung genug, um ganz und gar nicht zu verstehen, was Brigitte meinte. Sie war mein Leitstern. Sie wusste, dass ich ständig an sie dachte. Dafür hatte sie gesorgt, mit lauter kleinen Manövern, die vermutlich auch meinem Vater nicht entgangen waren. Bis heute verstehe ich seine Zurückhaltung nicht. Unser Verhältnis war nie so, dass wir die Frage klären konnten.
mehr
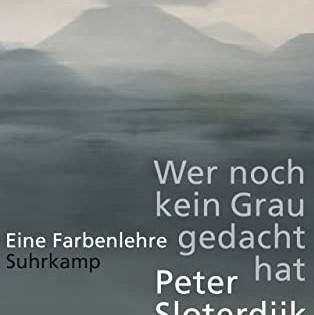
Peter Sloterdijk variiert ein Wort von Paul Cézanne: „Solange man nicht ein Grau gemalt hat, ist man kein Maler - Solange man das Grau nicht gedacht hat, ist man kein Philosoph.“ Sloterdijk addiert „verhangene Novembertage, Elefantenhäute, Mäusefelle, steife Packpapiere, fahle Cashmere-Eleganz“, melierte Public Convenience Floors und Goethes aschfahle Miene kurz vor seinem Tod.
mehr

Beamtinnen richten ihre Schienbeinschützer mit der Konzentration von Spielerinnen, die sich auf ein Match vorbereiten. Ihre Gegenspielerinnen erscheinen nicht weniger uniformiert auf der Bornemann Avenue (vormals Glauburg Straße). Gunda trägt ihren Tiroler Strohhut durch den schwarzen Block, Sorglosigkeit vortäuschend. Die Politpunks sind ihr nicht geheuer. Wo ist jetzt noch mal die Galerie? Nasenschleim sagte doch, man müsse lediglich … die Galerie ist im richtigen Leben ein Geschäft für gehobene Alltagsgegenstände in einem seit Jahren eingerüsteten Haus. Das Haus wirkt betrübt wie ein Eckensteher. Alle haben es schon einmal erst einmal nicht gefunden.
mehr
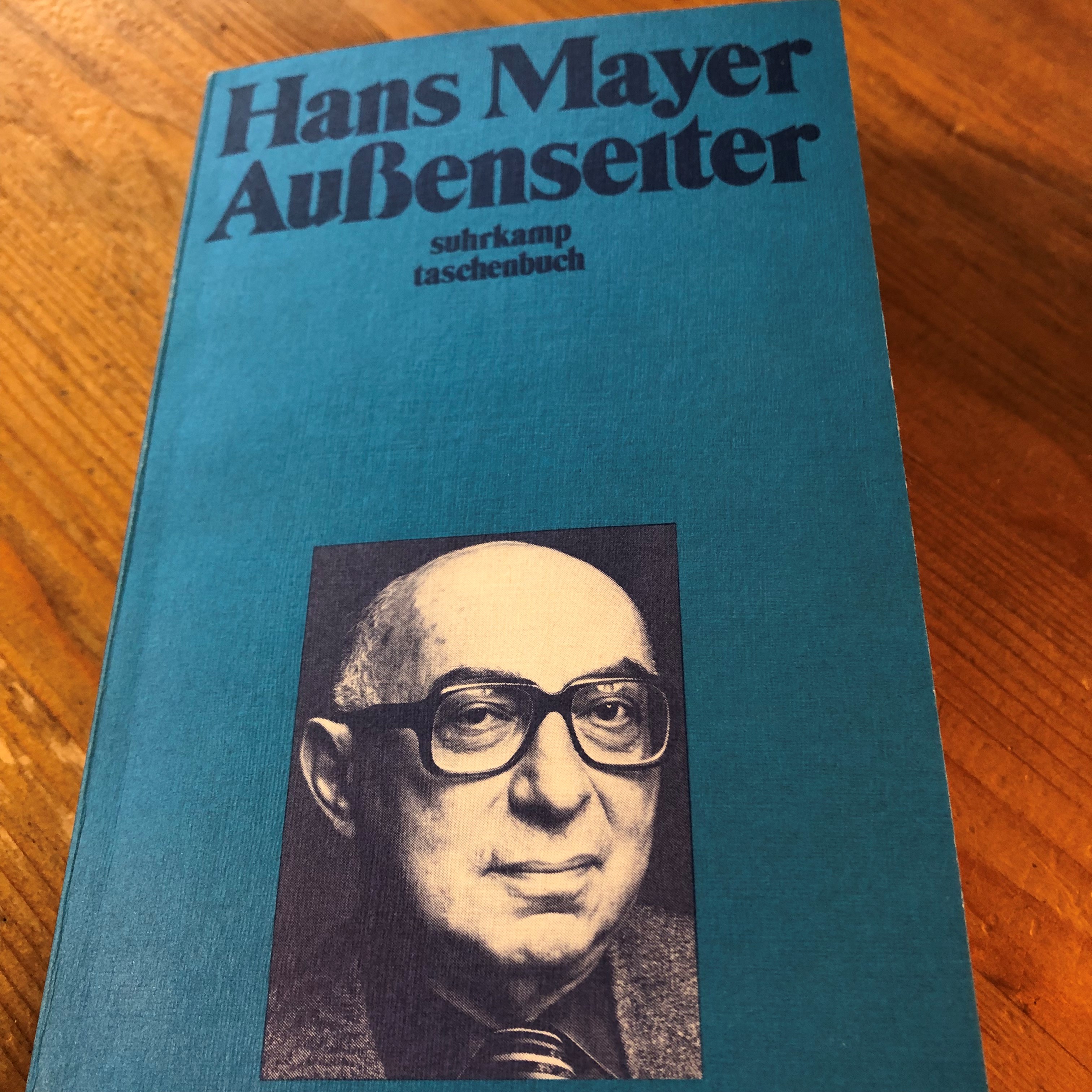
Man ist vorsätzlich antiquiert. Flaubert bezeichnet den Nationaldichter Pierre-Jean de Béranger als „dreckigen Bourgeois“. Diana Céline, eine Urgroßnichte des Ungeheuers, unterstellt Flaubert auch einen Vorsprung in der Kunst des Obszönen, von der „in Zeiten von „Fifty Shades“ und „Feuchtgebiete“ kein Mensch mehr etwas verstünde. Die Literaturwissenschaftlerin entdeckt eine „raffinierte Anzüglichkeit“.
mehr
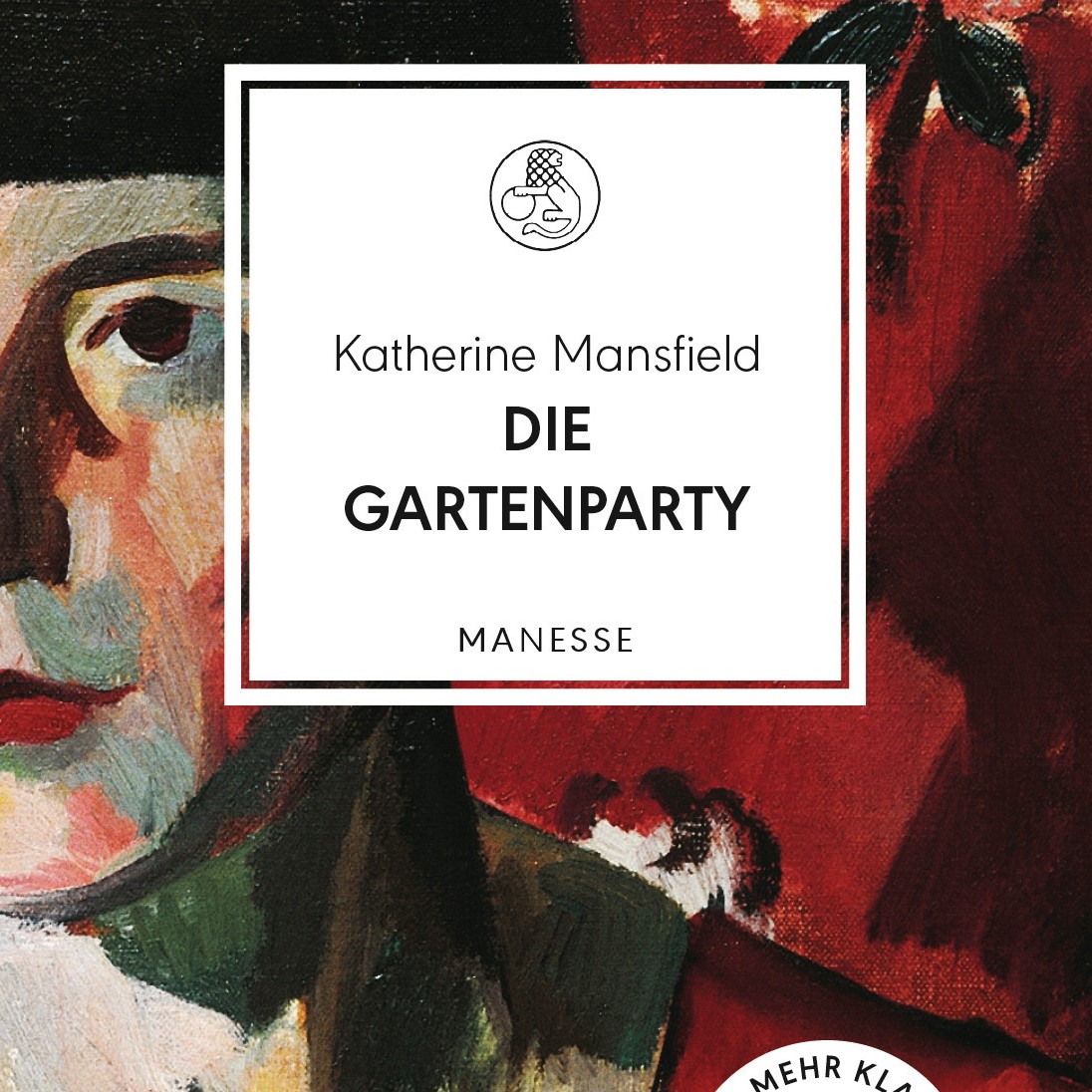
Virginia Woolf bewunderte sie bis zur Eifersucht. D. H. Lawrence gefiel der freie Lebensstil der ledig schwanger gewordenen, früh vollendeten und früh verstorbenen neuseeländisch-britischen Schriftstellerin Katherine Mansfield (1888 - 1923).
mehr

Von einem Freund war den ganzen Abend nicht die Rede. Margarete schwärmte für frische Petersilie. Der blaue Johnny sah aus Knastaugen herüber. Der Henker im Himmel köpfte Blüten, die in den Staub auf Tischen und Bänken fielen. Khan stellte sich bündig zu Goya und Margarete, um die neue Frau in seinem Territorium kennenzulernen. Margarete unterhielt sich mit Khan über Gerichte, von denen Goya noch nie gehört hatte. Sie kennt sich in Indien aus. Sie strahlte Khan an, anscheinend eingenommen von dessen vulkanischer Erscheinung.
mehr

Am 9. März 2023 bringen Sasha Waltz & Guests unter dem Arbeitstitel »Beethoven 7. Symphonie« einen neuen, zweiteiligen Abend zur Uraufführung im Radialsystem Berlin: eine Choreographie von Sasha Waltz zur Musik von Ludwig van Beethoven sowie eine Neukreation mit elektronischer Musik von Diego Noguera. Der Vorverkauf startet voraussichtlich am 17. Januar 2023 - weitere Informationen folgen.
mehr

Am 5. Oktober 2017 veröffentlichte die New York Times unter dem Titel „Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades“ einen Artikel, in dem der Genannte der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde. Die Rede war von mindestens acht Vergleichen zur Abwehr gerichtlicher Feststellungen von Delinquenz. Die redaktionelle Freigabe des Textes bildet den Schlusspunkt des Films.
mehr

„She Said“ kommt nicht über die Magistralen. Der cineastische Nachgang der ersten großen #Metoo-Erhebung kollidiert nicht mit den Leitplanken des Actionkinos. Reißerische Elemente fehlen. Sogar Weinsteins - von Mike Houston kongenial herausgestellte - Bulligkeit dient lediglich der Virtuosität eines Überspielens. Die Geschichte ging über Weinstein vernichtend hinweg. In der feministischen Triumpherzählung sieht das so aus, als hätte man den abgestürzten Mogul herausgeschnitten und dabei einfach nur zwei, drei Stellen vergessen.
mehr
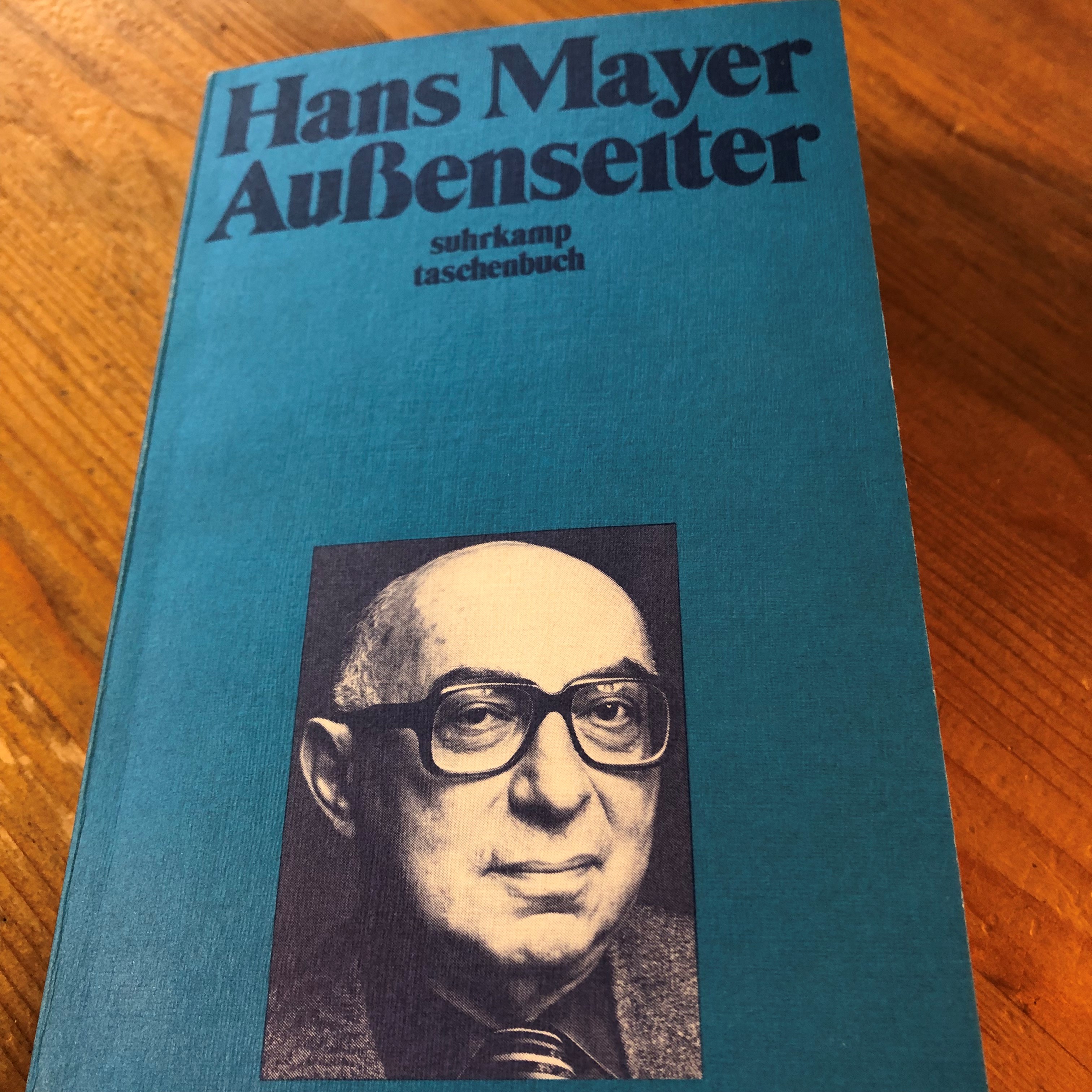
Liberté, egalite, fraternité - Olympe de Gouges erklärte „Die Frau hat das Recht das Schafott zu besteigen, also muss sie auch das Recht haben, die Rednertribüne zu besteigen.“ Man guillotinierte sie am 3. November 1793 mit der Begründung, sie habe vergessen, was sich für ihr Geschlecht ziemt.
mehr
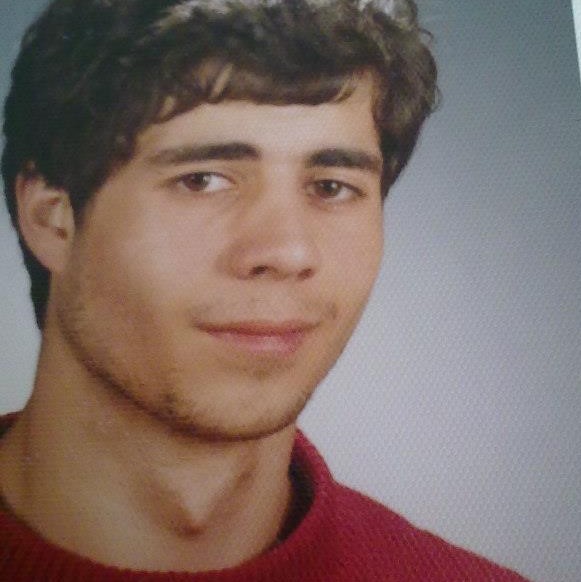
Goya packt Fleischwurst und Sauerkraut auf die in Ascea am Strand gekaufte, floral motivierte Küchentischdecke. Paula begutachtet den Beifang eines prallen Vormittags. Sie trägt einen Ehering, das Gegenstück liegt auf dem Küchentisch. Für den Rest des Tages möchte Paula verheiratet sein.
mehr
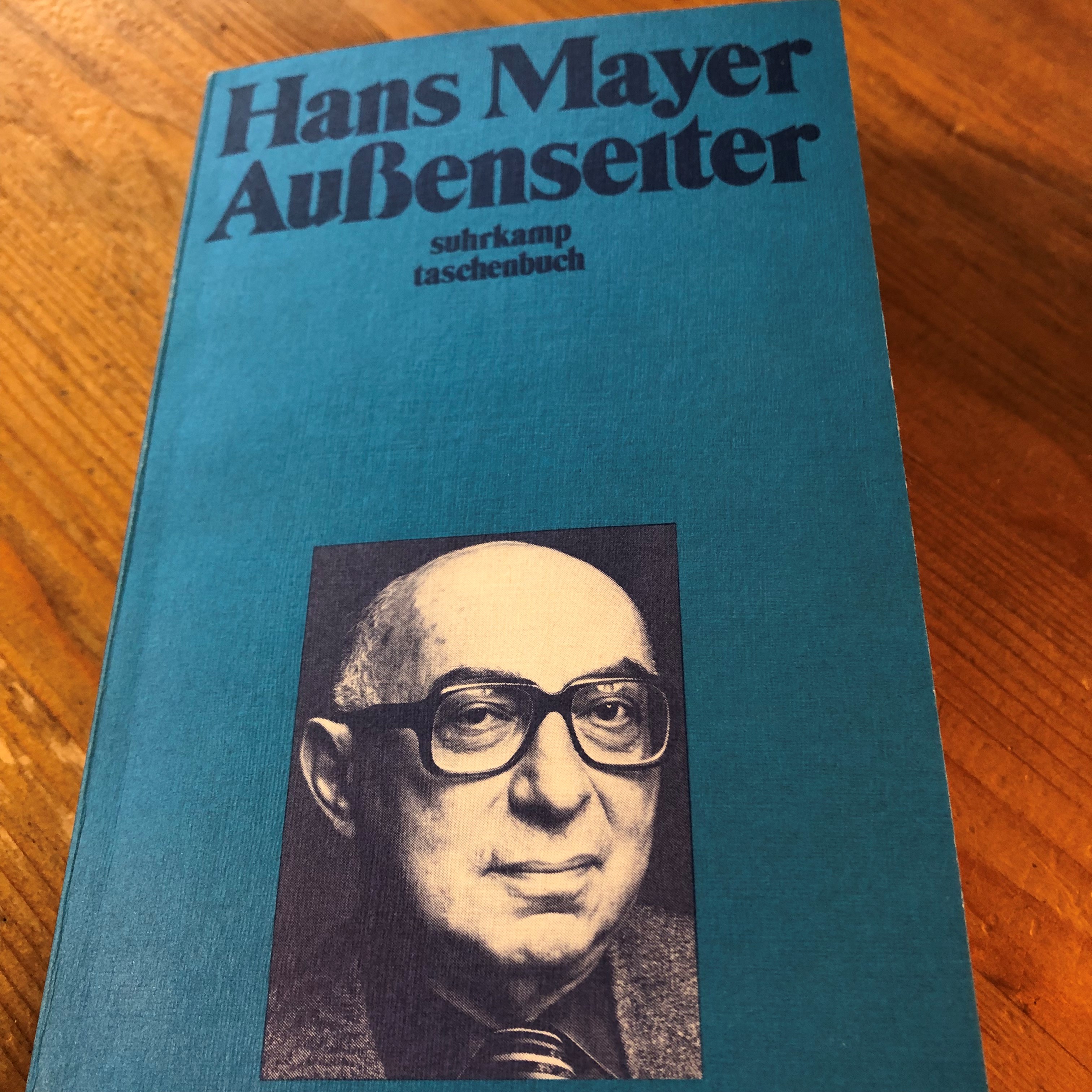
Die bürgerliche Familie konstituierte sich im Herrschaftsgefälle. Im „Lied von der Glocke“ besingt Schiller die „züchtige (nimmer ruhende, für die Wäsche zuständige) Hausfrau“. Greift sie denn zu militärischen Waffen, entsagt sie der Weiblichkeit. Die Schiller’sche Heroine handelt soldatisch um den Preis ihrer Weiblichkeit. Die „unweibliche Frau“ erschien im bürgerlichen Diskurs ...
mehr

Ins Kneipenklo passt eine Kneipe. Eine Beobachtung, die Granit Knežević beinah jeden Tag aufs Neue erstaunt. Wenn Pissrinnen erzählen könnten.
mehr

Die dreitausendjährige Geschichte der Jüdinnen und Juden verankert sich geografisch in Israel über einen Zeitraum von elfhundert Jahren. Das erklärt Michael Wolffsohn in seiner Übersicht „Eine andere Jüdische Weltgeschichte“.
mehr
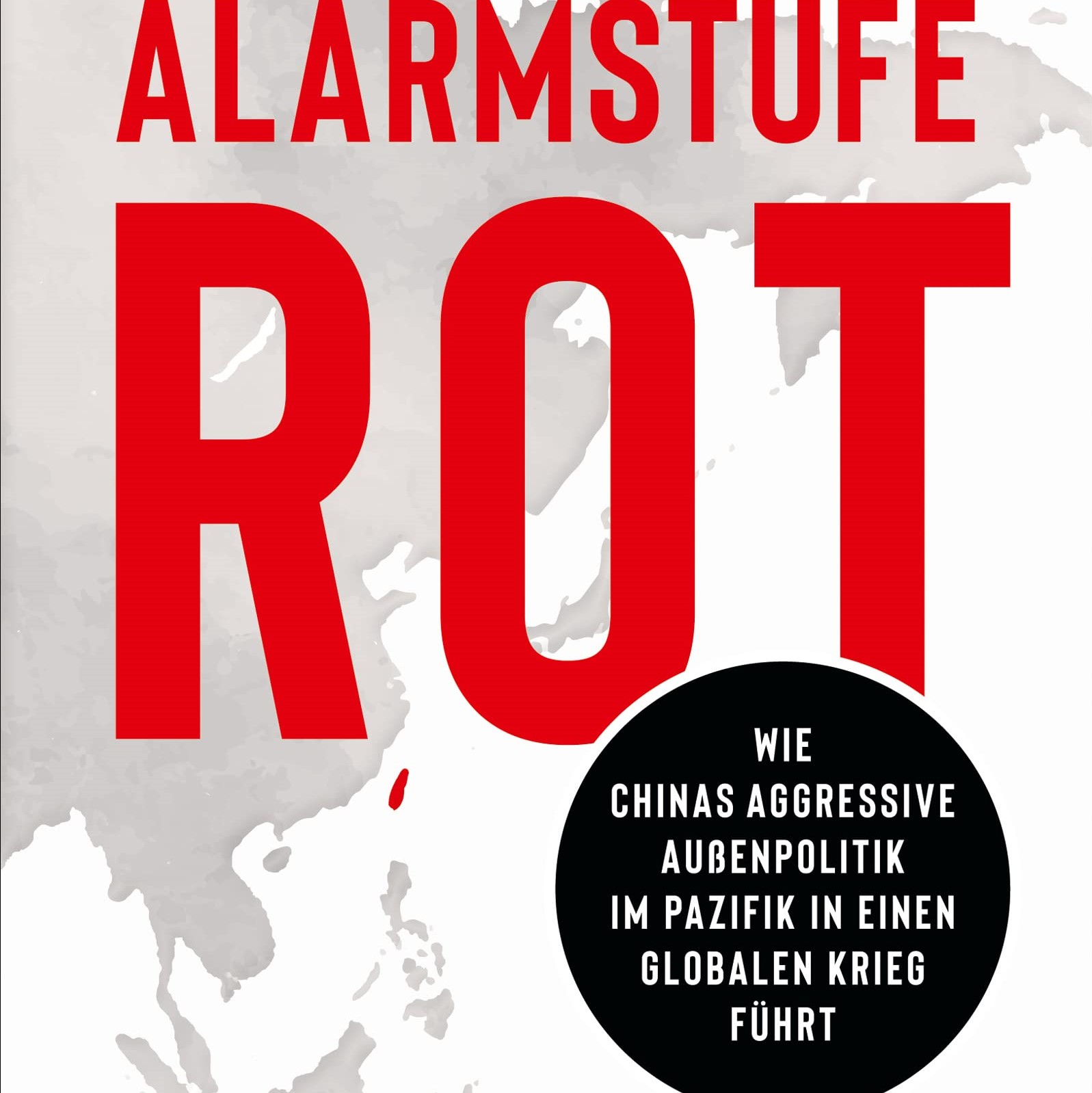
„Konfuzianismus als Stütze von Totalitarismus.“ - So lautet eine Kapitelüberschrift in Alexander Görlachs Alarmanalyse. Der Autor erinnert daran, dass Mao die alten Zöpfe des Konfuzianismus von seinen kulturrevolutionären Quälgeistern abschneiden ließ. Maos mächtigster Nachfolger beruft sich wieder auf die chinesischen Klassiker. Xi Jinping ist die Person gewordene Partei in der zweiten Morgenröte der chinesischen Revolution.
mehr

Jiménez pfeift. Wie ein Mann geht die Gruppe im Günthersburgpark zu Boden. Liegestütze. Klappmesser. Liegestütze. Die Vorsitzende der Nordend-Kanakster-Laufgruppe (es wird noch nicht gegendert, anderenfalls wäre Jiménez die Erste) zählt krumm: „Bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk. Yallah, meine Häschen.“
mehr

Die derzeitigen Proteste und Revolutionsbestrebungen in Iran, angeführt durch eine junge Generation, die für Freiheit und Menschenrechte einsteht, erfordern universelle Aufmerksamkeit. Die Freiheit der iranischen Bevölkerung sollte nicht nur aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Interessen von globaler Bewandtnis sein, sondern vor allem auch aus humanistischer Sicht verfolgt werden ...
mehr
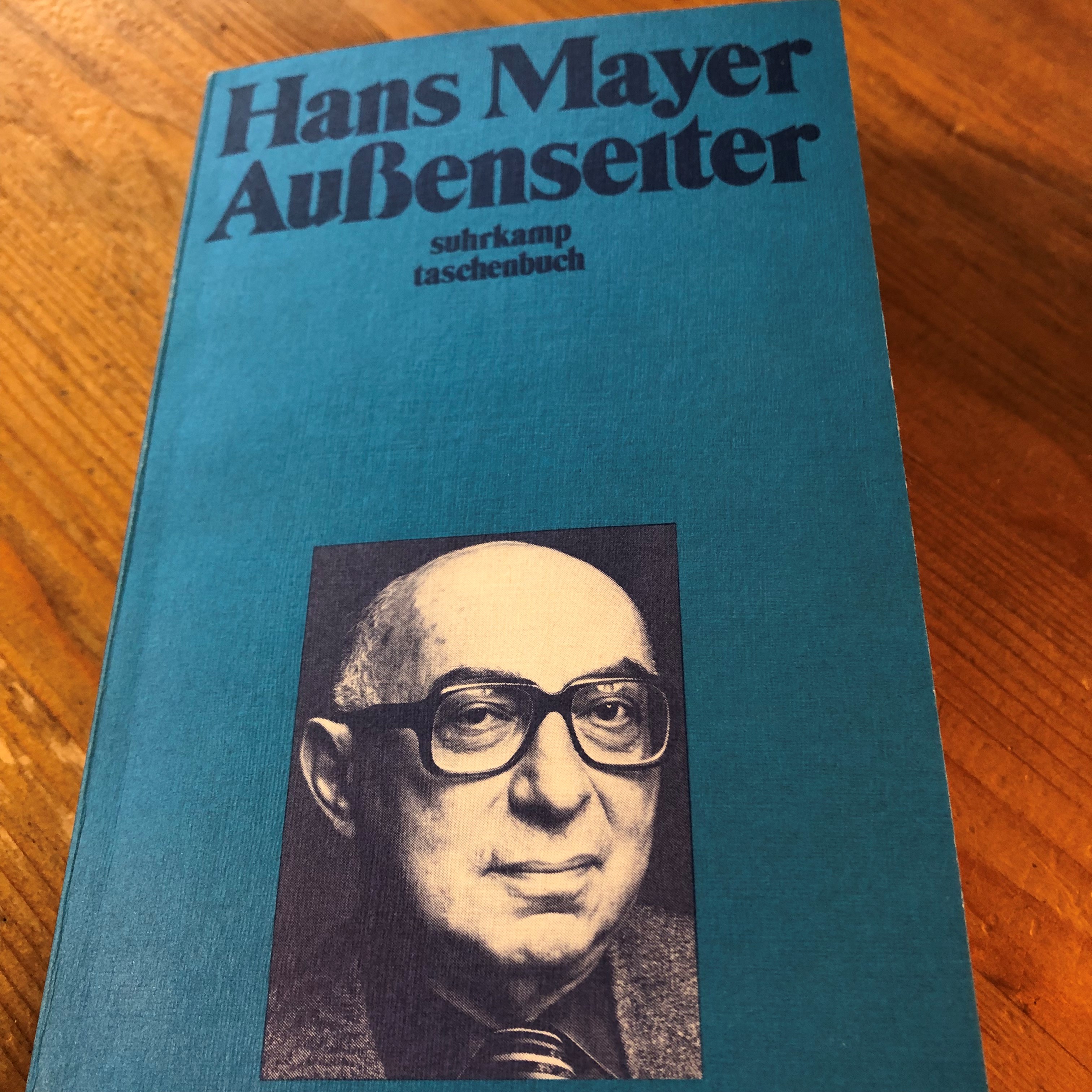
„Mich fasziniert, wie glücklich man an den schlimmsten Orten sein kann und wie unglücklich an den schönsten.“ Norris von Schirach in der Süddeutschen Zeitung
mehr

Eine Lustspielfigur „strebt nach Echtheit und liebt eine Mondäne“. Die Kunstgestalt verachtet ihre Kritiker und beachtet doch jedes kritische Wort. So wird „die Macht des Sozialen“ gerade von ihrer Verächterin anerkannt.
Das destilliert Hans Mayer in seinem „Außenseiter“ aus bürgerlichen Maischen. Rousseau charakterisiert er als „publikumssüchtigen Eremiten“. Mayer erinnert an das kümmerlichste, wohl nie vom Autor zur Veröffentlichung bestimmte Shakespeare-Stück - „Timon von Athen“. Der Titelheld verkörpert einen Misanthropen. Hans Mayer erkennt in der Misanthropie gesteigerte Melancholie und in der Melancholie ein fürstliches Privileg.
mehr
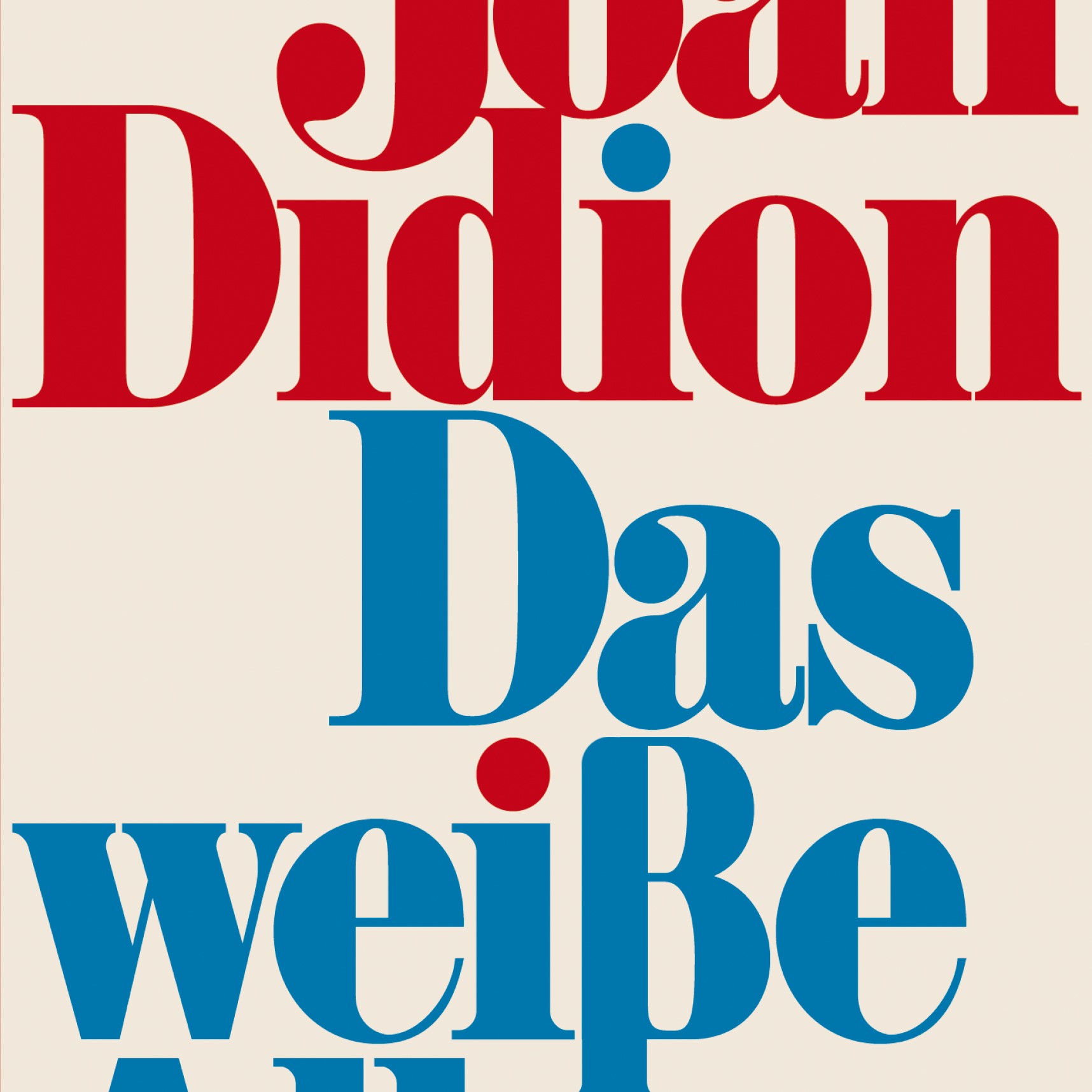
„Unheilvoll“ nennt Joan Didion eine Gegend, in der „die Gepflogenheiten des Mittleren Westens“ bildbestimmend sind. In dieser „Endstation“ gibt es mehr Selbstmorde, Scheidungen und Trailerpark-Existenzen als im kalifornischen Durchschnitt.
mehr

Nach zwei parallel geschalteten Pannen-, Pech- und Pleitenserien finden sich Herta und Alwin in ihren Vierzigern damit ab, dass sie in beschissenen Ehen so wie in ausweglosen Schuldenfallen sterben werden. Ohne den amtlichen Verhältnissen einen vernichtenden Tritt zu verpassen, verbinden sie sich in einer heimlichen Liebschaft. Sie geben sich das Nötigste ohne Verzuckerung. Die Liebe erwischt sie kalt. Mit allem war zu rechnen gewesen, nur damit nicht, dass einem prosaischen Arrangement die großen Gefühle folgen würden.
mehr
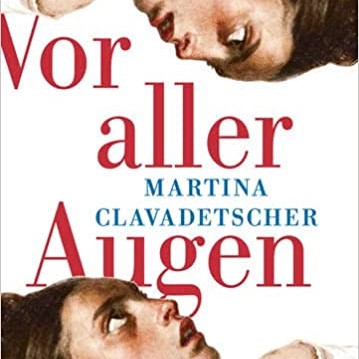
Nun zu „La Fornarina“, einem 1518/19 entstandenen Meisterwerk der Hochrenaissance. „La Fornarin - die kleine Bäckerin“ - der Name der barbusig Dargestellten wurde Jahrhunderte als Marginale gehandelt. Man identifizierte die Porträtierte als Tochter eines Bäckers; geboren um 1490 in Siena. Margherita Luti war die als Hausgenossin akkreditierte Geliebte des schon zu Lebzeiten den Unsterblichen zugeordneten ...
mehr

Die Tangotänzer sind da. Sie treten festlich auf. In der Nacht sehen die Denkmäler im Park wie erstarrte Lebewesen aus. Wir sind alle nur Möglichkeiten füreinander. Überall werden Verabredungen getroffen, als müsste sterben, wer nichts vorhat. Goya bemerkt Paulas Sohn im Flutlicht der Boulespielerinnen. Die Boulespielerinnen sind unnachgiebig in ihren Gewohnheiten. Der kostbarste Augenblick des Abends hebt seine Lider.
mehr
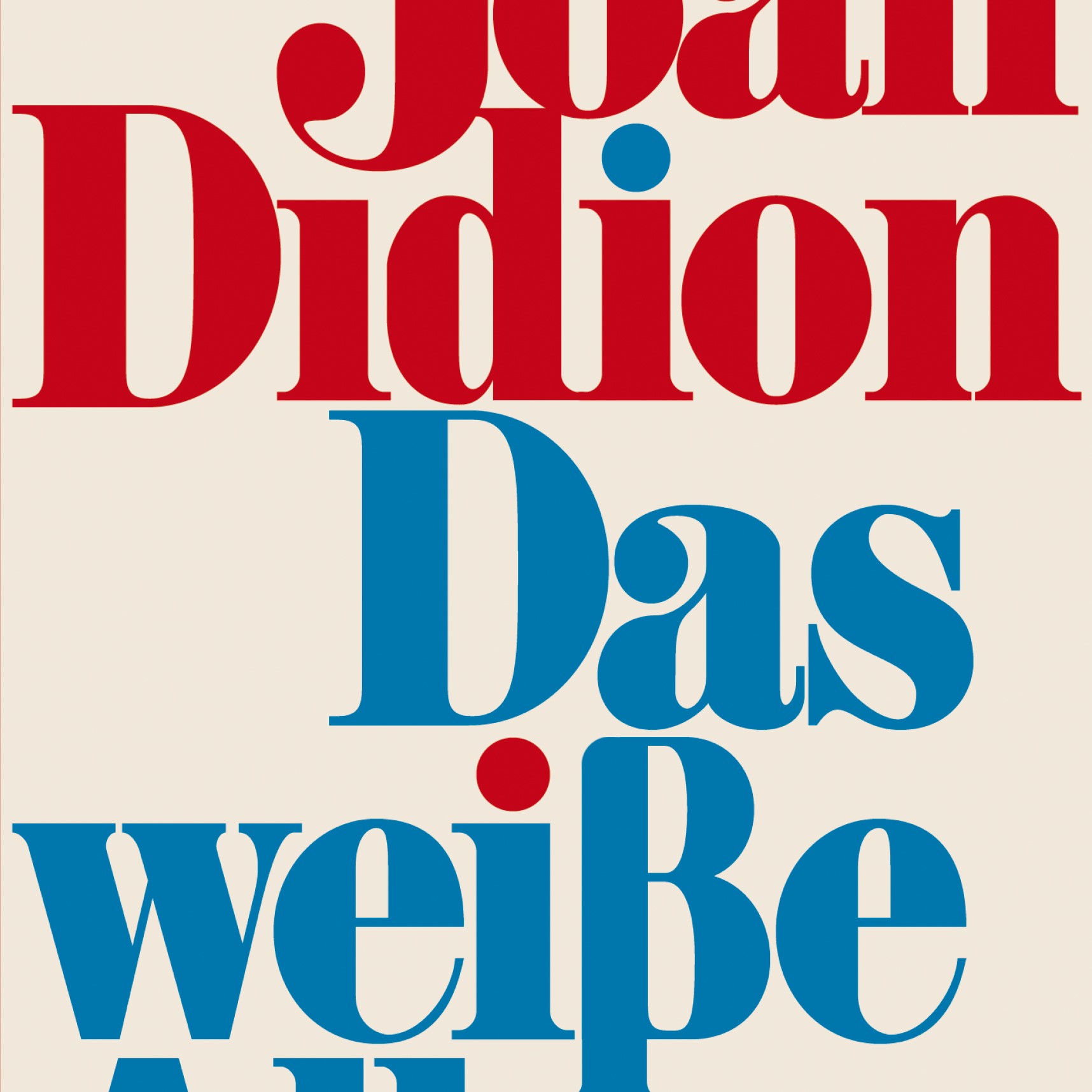
Die strategischen Verknüpfungen von Reichtum, Luxus und maritimer Idylle zeitigten ihre Höhepunkte vor dem Zweiten Weltkrieg. Die ausgeschlossenen Einheimischen wurden abgespeist, während sich die weiße High Society im ‘Royal’ von „der Jagd in Südafrika ausruhte“. Den Honolulu-Hype mit all seinem auf Hawaiianisch getrimmten Nippes lesen wir heute als Cultural Appropriation.
mehr
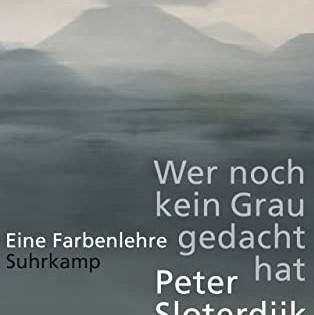
Nach Peter Sloterdijk zog das Grau als politische Farbe mit dem Kapuziner François-Joseph Le Clerc du Tremblay de Maffliers in das europäische Staatsgeschäft ein. Ohne Absicht begründete Père Joseph (1577 - 1638) eine Dynastie der grauen Eminenzen. Er arbeitete dem weit berühmteren Kardinal Richelieu zu. Gleichzeitig war er, in Umkehrung der Hierarchie, Beichtvater seines Vorgesetzten; eines der potentesten Machiavellisten nicht allein seiner Epoche.
mehr

“There are no limits. There are plateaus, but you must not stay there, you must go beyond them. If it kills you, it kills you. A man must constantly exceed his level.” Bruce Lee
mehr

Der niederländische Kapitän Abel Tasman bezeichnete die begehbaren Flächen im Pazifik als vorbewusste Räume der Welt. Er fand schlafende Länder, Stein- und Traumzeitreservate, die der Empfindung Vorschub leisteten: in einer anderen Zeit gelandet zu sein. Er passierte Inselflure und beschrieb sie als poly nēsoi.
mehr
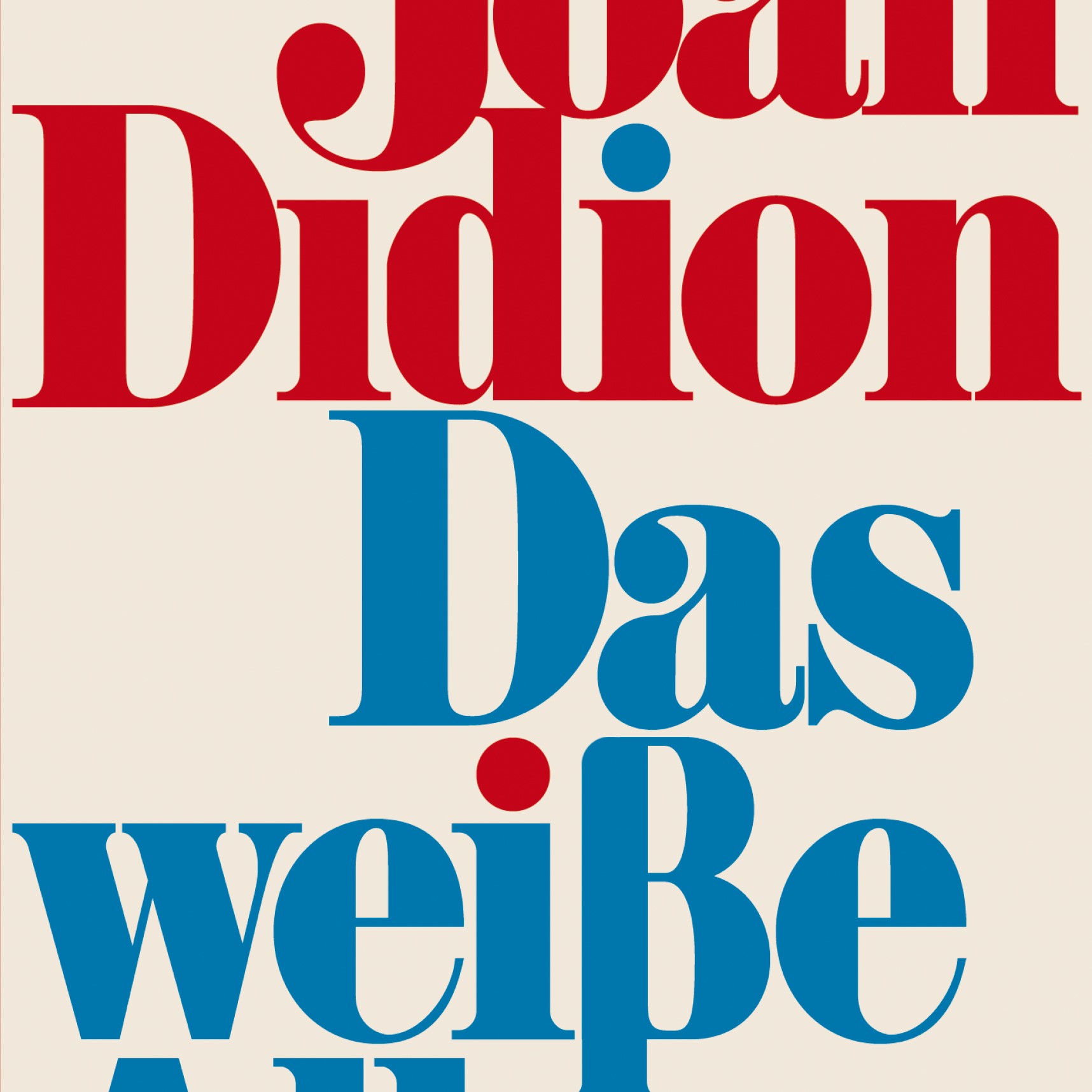
Die Reporterin beschwört den Charme der kalifornischen Bourgeoisie in revolutionären Zeiten. Die High Society von Neunundsechzig kokettiert mit Umsturzphantasien und einem Riot-Phantasma. Sie verkleidet sich als Avantgarde und frönt dem Radical Chic.
mehr
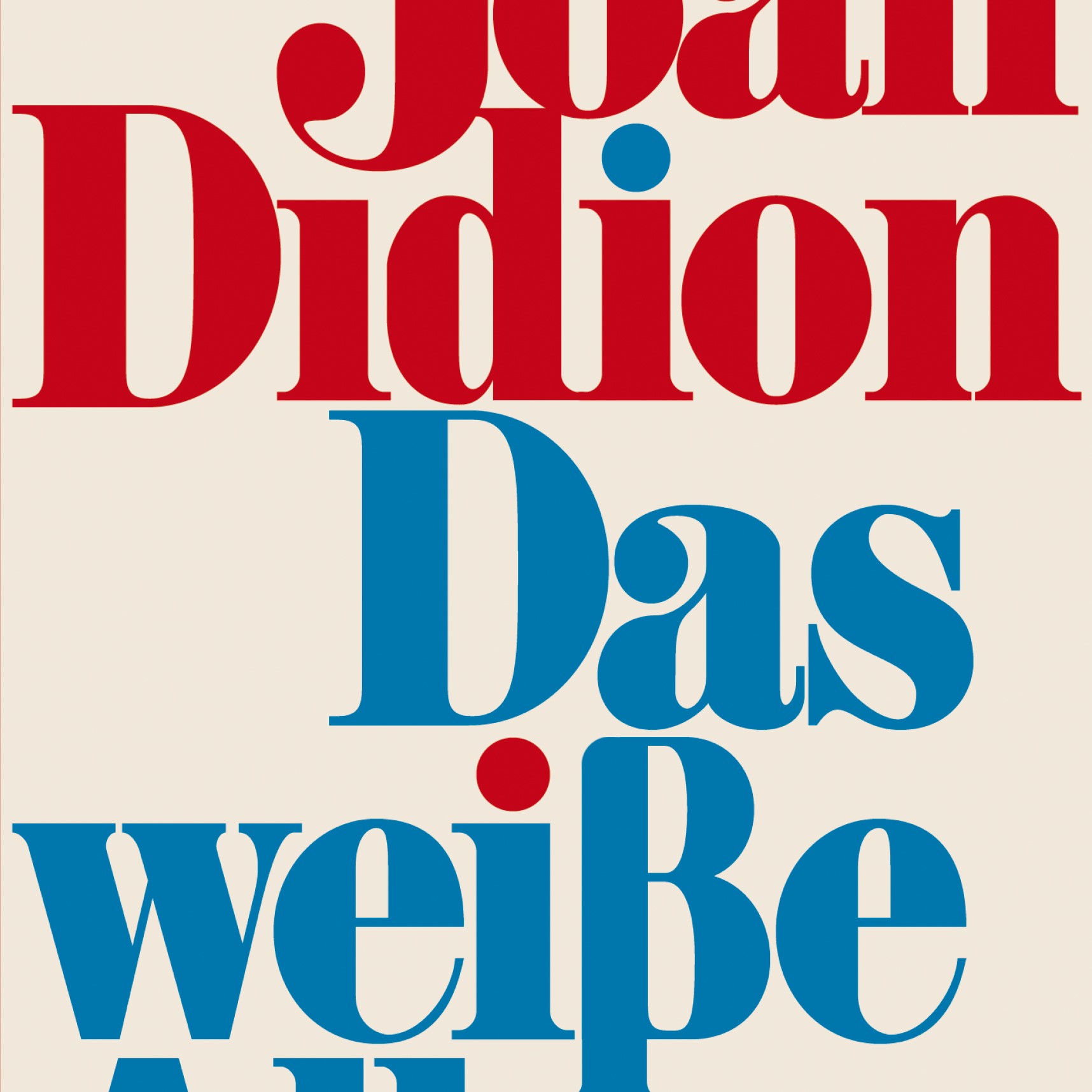
Ronald „Rea-gun“ Reagan, noch lange nicht Präsident, regiert von 1967 bis 1975 einen der - im Rahmen des Achtundsechziger-Aufbruchs - rebellischsten Bundesstaaten. Der außerparlamentarischen Opposition so wie allen anderen subkulturellen Gegenöffentlichkeitsplattformen gefällt Reagan als Hassfigur. Er gibt bereitwillig den harten Hund. 1969 lässt er Proteste auf dem Berkeley-Campus von der Nationalgarde auflösen. Die Bilder gehen um die Welt. Nancy Reagan liefert mit ihrer Homestory das Kontrastprogramm. Sie stützt ihren Mann, der unter seinesgleichen als „guter Kerl“ kursiert.
mehr

Die ganze Geschichte, wie wir sie in Bausch und Bogen für einen Gewinn unter dem Banner der Freiheit zu halten gelernt haben, wogt bei dem Zeitgenossen mächtig hin und her. In Paris macht man Hausdurchsuchungen, um „innere Bundesgenossen des äußeren Feindes“ zu entwaffnen. Um den 30. August 1792 „stürzt ein junger Mensch“ namens Jean-Marie Girey-Dupré (1769 -1793) den „rebellischen Demagogen“ Robespierre, während er selbst von Munizipal-Offizieren der Nationalversammlung bedrängt wird. Der Journalist Girey-Dupré soll Abbitte leisten.
mehr

La Fayette soll dem König die Flucht aus Paris (nach Varennes-en-Argonne) erlaubt haben. Oelsner kolportiert im Stil einer Schnurre Folgendes: Ein Aristokrat verkleidet sich in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 1791 als Sansculotte, nimmt eine Pike zur Hand und mischt sich unter die Menge, die zum Palais des Tuileries drängt. Er lässt sich in das Zimmer des geflohenen Königs schieben. Da weist ihm eine Kanaille des Hofs die Stelle, wo eine Geheimtür zu den Gemächern des Bischofs von Clermont, ich tippe auf François de Bonal, und des Abbé de l‘Enfant führt. Der adlige Abenteurer verstellt den Zugang und schützt so Standesgenossen, ohne Aufsehen zu erregen. Das weiß heute kein Mensch mehr.
mehr

Auf den Soli-Festen der 1970er Jahre gab es keine israelischen Ess- und Informationsstände. Wohl aber das palästinensische Sendungsbewusstsein in jugendsmarten Erscheinungen. Für die Täterinnen- und Täterenkel:innen im Hanni- und Nanni-Land lag die Agitation auf einer Linie mit der Weltrevolution. Es gab den kubanischen Hasta-Siempre-Übersprung; ein schwarzromantisches Commandante- und Kalaschnikow-Momentum, bei dem arabische Freischärler:innen und lateinamerikanische Guerilla verschmolzen. In vielen bürgerlichen Kinderzimmern hing Alberto Kordas fotografische Guerrillero-Heroico-Stilisierung von Che Guevara als Poster.
mehr
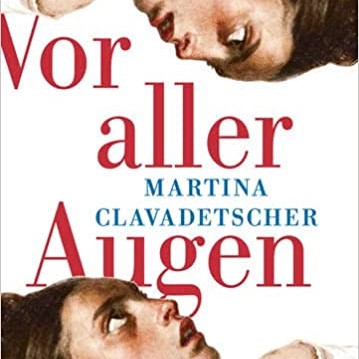
In neunzehn Miniaturen unternehmen Protagonistinnen des kollektiven Universalgedächtnisses introspektive Ausflüge. Gestern sprachen wir über Leonardo da Vincis 1489/90 geschaffenes Gemälde „Dame mit dem Hermelin“. Es zeigt eine Mätresse des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza (1452 -1508), der selbst als „weißes Hermelin“ in die Geschichte einging. Die Porträtierte, Cecilia Gallerani (1473 - 1536), war eine zunächst am Hof ihres Geliebten geschätzte, dann aber von Sforzas Gattin verdrängte Poetin.
mehr
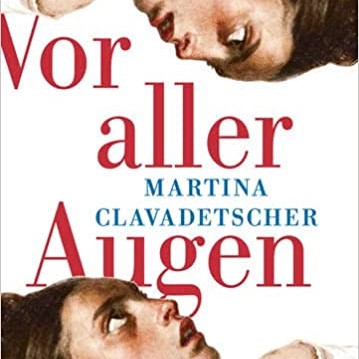
Nicht jedes Bilddetail verdankt sich der Intension des Urhebers. Die nachträgliche Verdunklung der Umgebung, aus der Cecilia hervorsticht, suggeriert einen (historisch haltlosen) Menetekel-Charakter. Auch das kritisiert Cecilia: nämlich den Verlust des vermutlich von da Vinci erfundenen Sfumato. Die allegorischen Übersetzungen fürstlicher Macht und Zwiespältigkeit offenbaren sich in sprechenden Äquivalenten. Das Hermelin, sprich der Herzog, schmiegt sich zwar an Cecilia ...
mehr

„Liebe Artists, hallo zum November-Newsletter! Während der Aktionswochen gegen Antisemitismus haben wir uns vor allem auf twitter konzentriert und dort fleißig eure Statements gepostet. Auch wenn aus der frühesten Phase noch die ein oder andere Stellungnahme über ist, gehen uns diese so langsam aus. Deshalb immer wieder unser Aufruf: Schickt uns euer Statement gegen Antisemitismus - am aller liebsten als kurzes Video (30 bis 90 Sekunden ist die ideale Social Media Länge)*, so kreativ wie ihr mögt!“
mehr
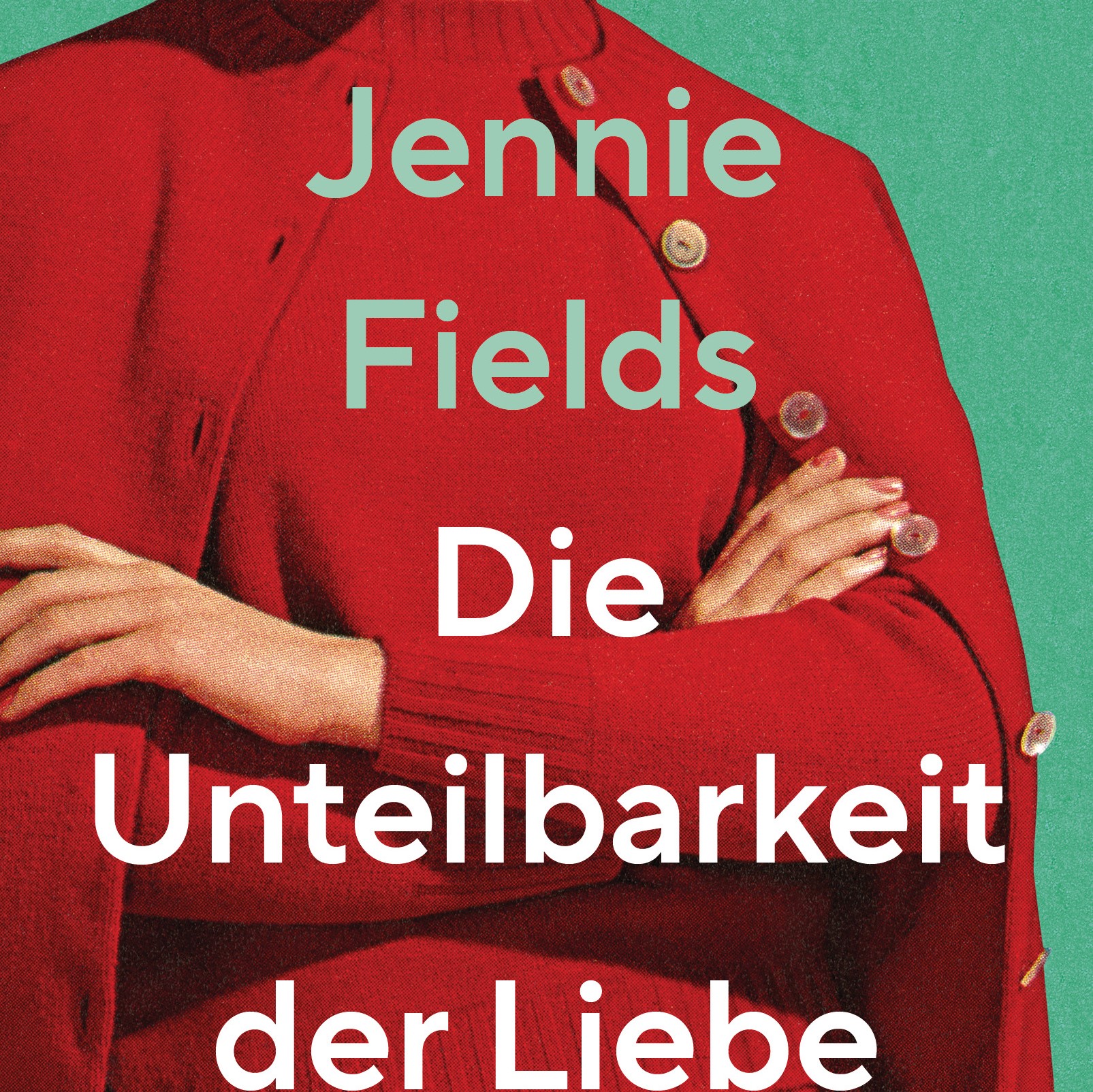
Während des Krieges übernahmen Frauen an Werkbänken und Fließbändern ‚untypische‘ Aufgaben. Nach 1945 erleben sie ihre Verdrängung aus den Sphären der Produktionsprozesse so wie gesellschaftliche Rekalibrierungen nach Maßgabe überkommener Rollenstandards. Auch die Physikerin Rosalind ‚Roz‘ Porter verliert ihre Position in der Herzgegend des Manhattan-Projekts. Fünf Jahre nach Kriegsende arbeitet Rosalind in der Schmuckabteilung von Marshall Field & Company - einer Antebellum-Gründung.
mehr
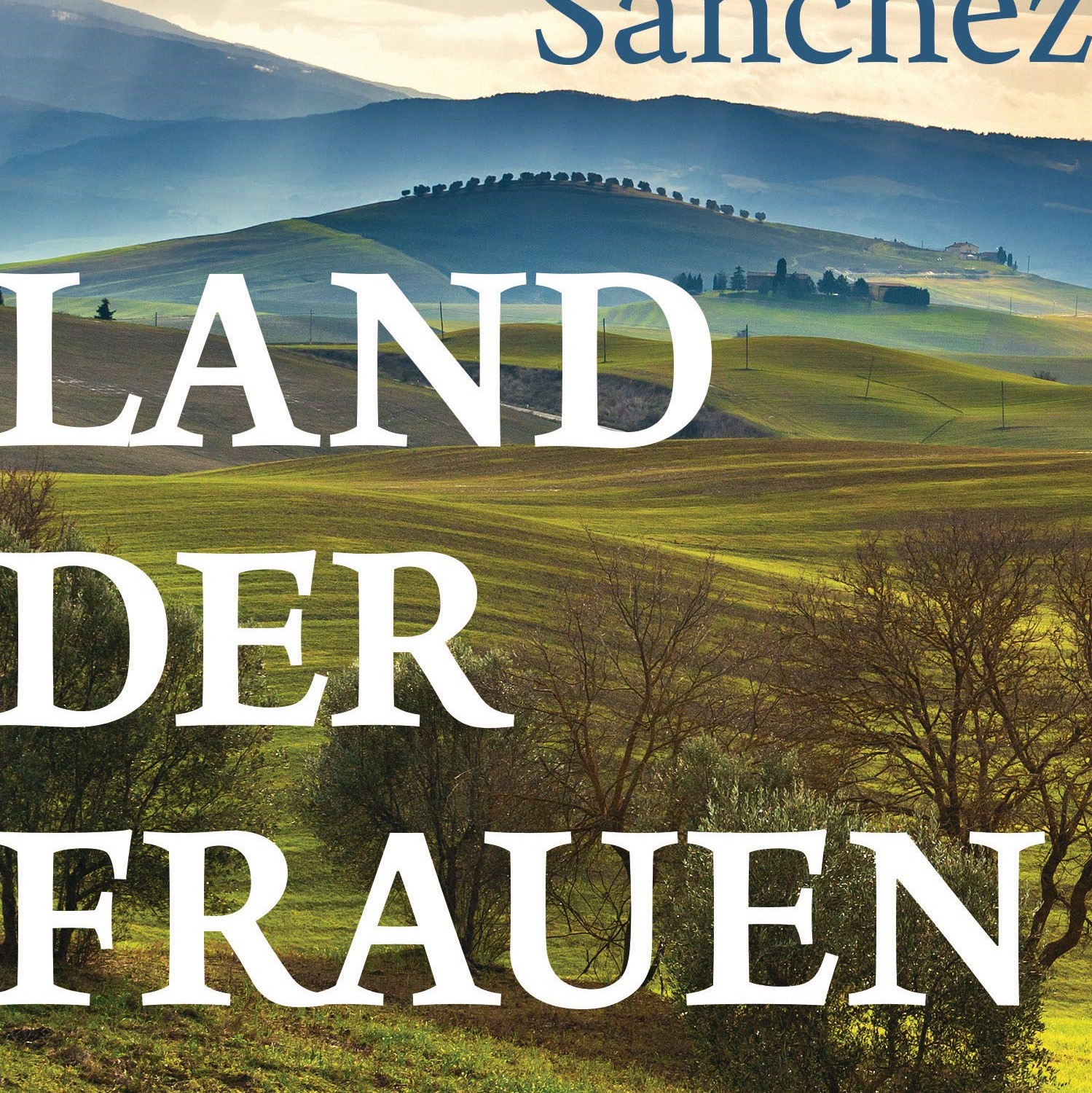
Den Seziersaal erlebt die Studierende als Rückzugsraum. Sie erklärt das Sezieren zu einem dem Schreiben verwandte Tätigkeit. Für beides brauche man Geduld. In jedem Fall taste man sich „nach dem Prinzip Versuch und Irrtum vor, bis man am Ende auf etwas stößt, dass einen überzeugt“. Die Prozesse der Aneignung von väterlichem Wissen koinzidieren mit einer „Verschlechterung“ der familiären Kernbeziehung. Das Idol zieht sich vor den Stimmungsinterferenzen der Adeptin zurück. Der Vater verweigert seiner Tochter das Recht auf melancholische Durchgänge und lyrische Exaltation.
mehr
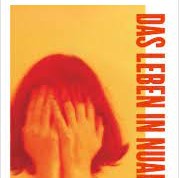
„Die Erinnerungen (an Grace) sind nie vollkommen verblasst, aber es gelang mir … sie stumm zu schalten.“ In Rückblenden memoriert die Erzählerin Eve glückliche Momente aus einem Fundus unwiederbringlicher Gemeinsamkeit. Grace, Tochter pädagogisch versierter Eltern, tauchte aus einer unbeschwert-ländlichen Kindheit im London auf. Die Freundinnen inspizierten die Vergnügungsfront. Sie teilten Rausch und Katzenjammer.
mehr

Herr Lehmann-Zwo verausgabte sich nur bei Nonsens-Bandwurmdebatten. Lag etwas Wesentliches an, verstummte er. Er hielt sich gern bedeckt. Der Kinoverweigerer verfügte über ein (offenbar aus der Luft gegriffenes) film-noir-Repertoire lakonisch-pathetischer Gesten und Ausflüchte. Wäre Herr Lehmann-Zwo, der im Jahr des Mauerfalls genregerecht dreißig geworden war, jünger gewesen, hätte man ihn für einen adoleszenten Spinner halten können. Er war aber zu alt für seine zaunkönigliche Saumseligkeit.
mehr
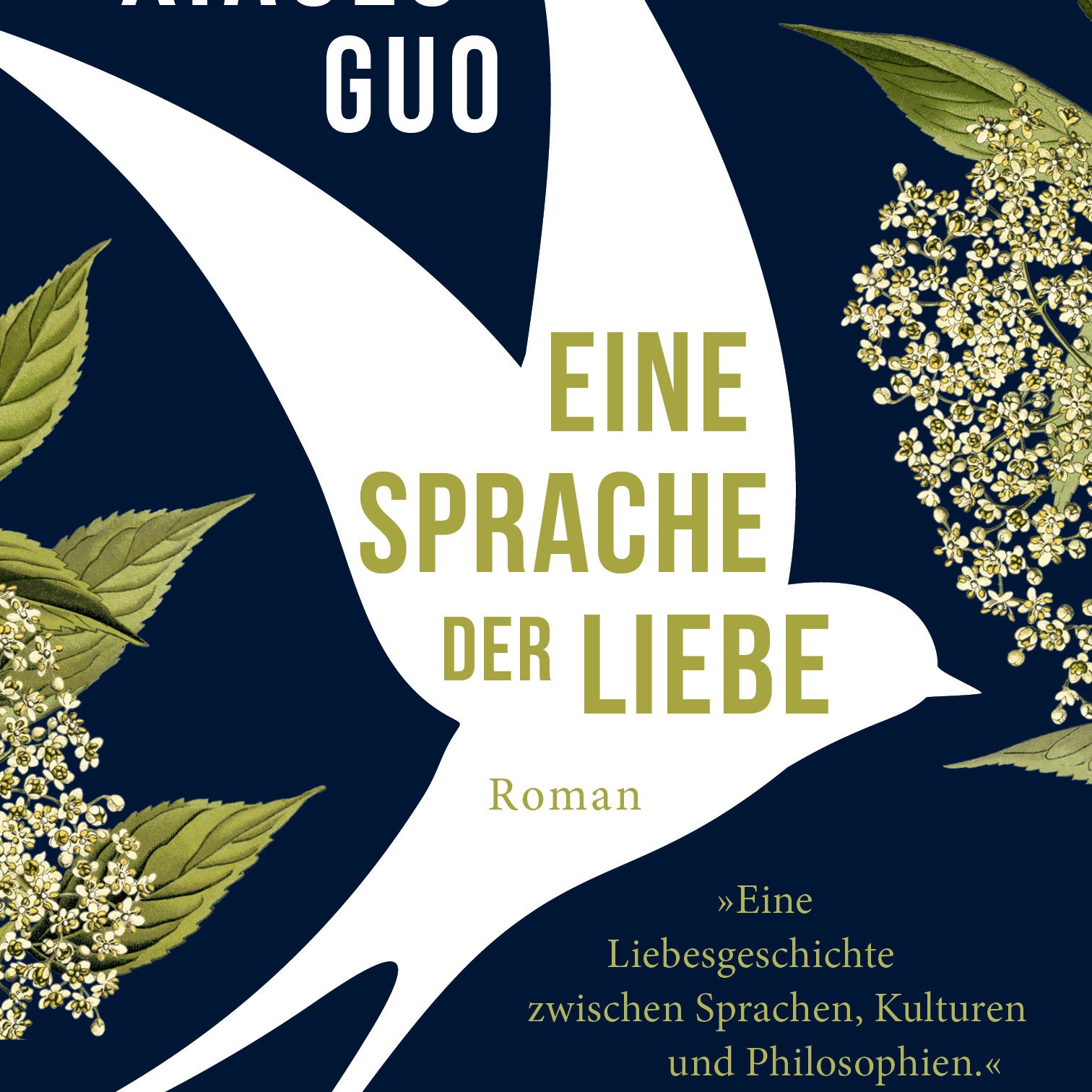
Mit ihrem Doktorvater am Londoner King’s College diskutiert die Stipendiatin kontrovers „Phänomene der Postmoderne“. Kunsthandwerklich seriell arbeitende, auf Meister:innenwerke spezialisierte Kopist:innen sind für Xiaolu Guo keine Fälscher:innen, sondern avancierte Akteure im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit von Kunstwerken. Sie zitiert Roland Barthes poststrukturalistisches Fanal vom „Tod des Autors“ und erwähnt Walter Benjamins bahnbrechende Analyse ...
mehr
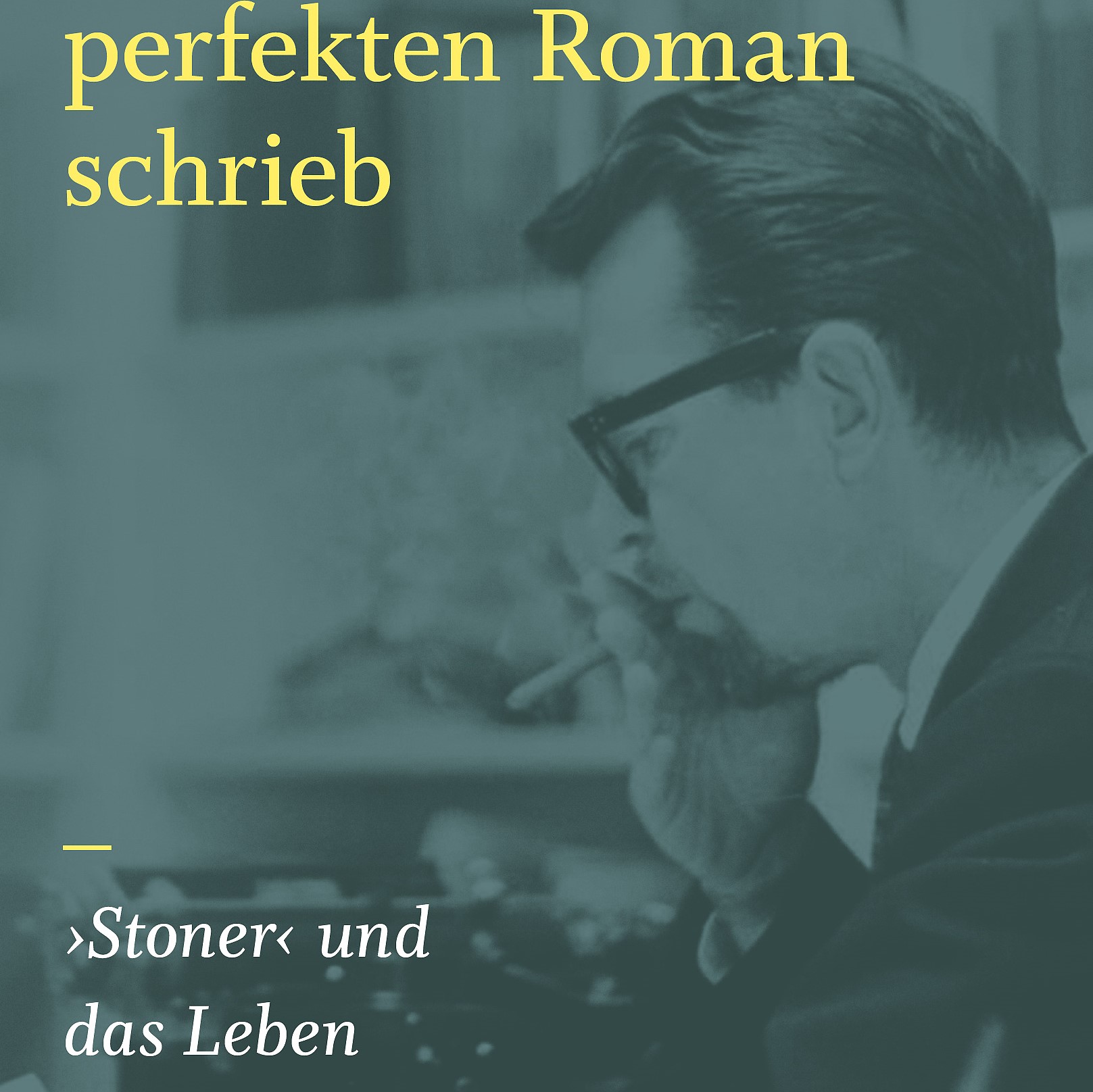
1939 ist Wichita Falls noch nicht lange nur ein Endbahnhof mit Verladestation für den Viehtrieb in Nordtexas. Der Bau des ersten Wolkenkratzers in Texas endete vor Ort als Schildbürger:innen-Posse. Dem Tycoon John G. Hardin verdankt sich immerhin eine Hochschule. „Den Enkeln der Pioniere“ öffnen sich die Pforten von Academia fern der traditionsreichen Universitäten an der Ostküste.
mehr
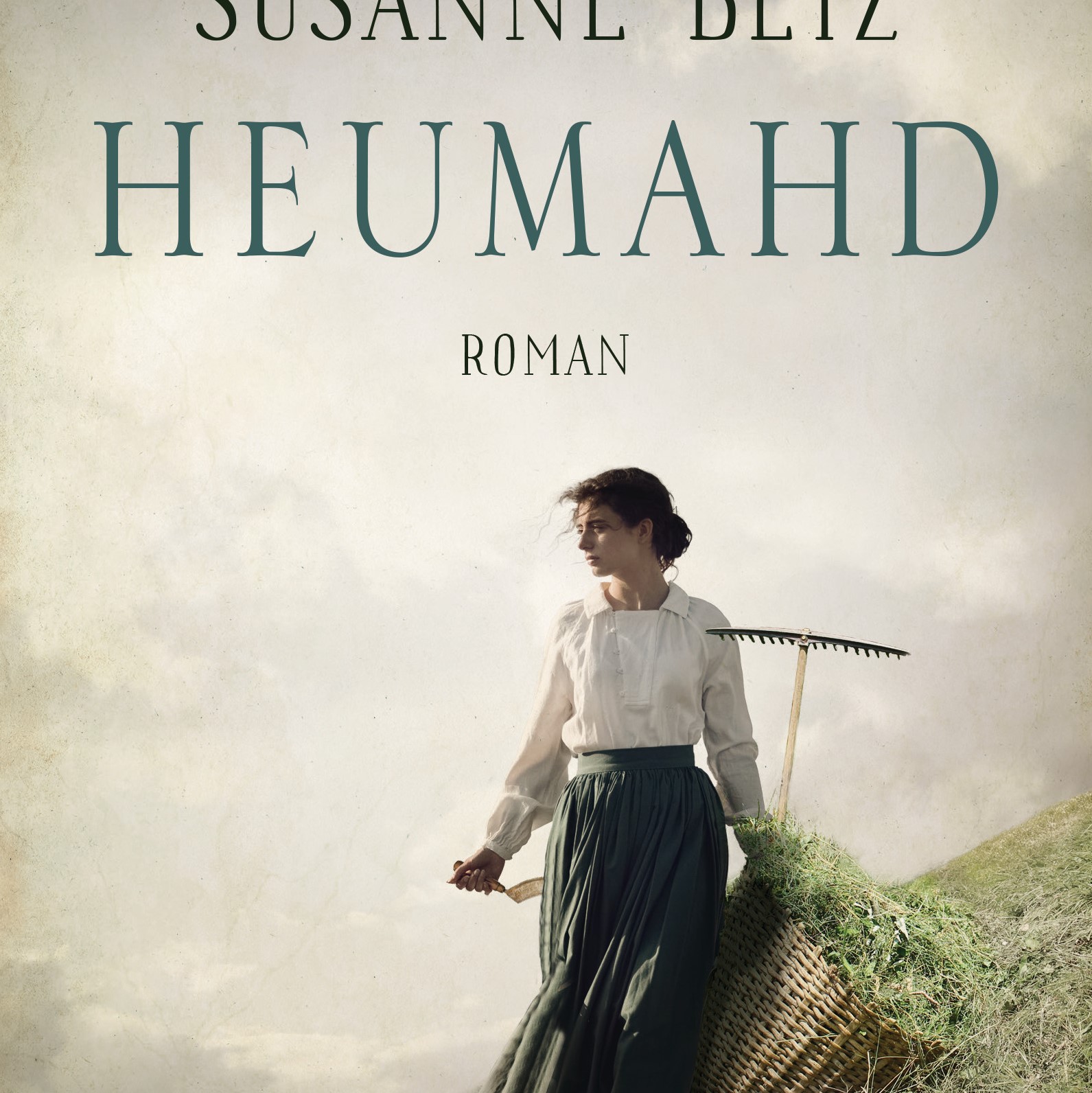
Schon als Halbwüchsige verdingt sich Vroni als Magd. Beizeiten heiratet sie den kaltherzigen Bauern Grasegger, der einen „einsamen Hof auf dem Geißschädel“ bewirtschaftet. In einer eiskalten Nacht kommt er so blau aus der Kneipe, dass ihn der Heimweg überfordert. Er erfriert zur Erleichterung seiner Witwe.
mehr
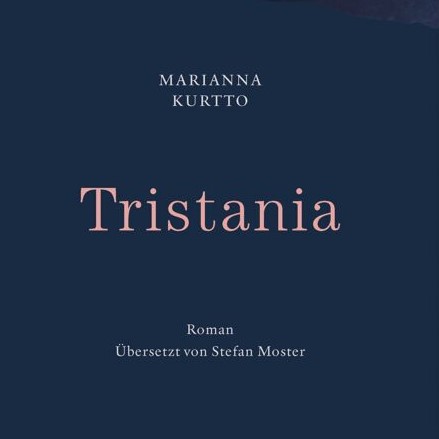
Voller Sehnsucht nach seinem isolierten Hügel aus Ergussgestein und doch längst verloren für die kleine Welt, verherrlicht Marianna Kurttos Held Lars das Glück im ozeanischen Winkel: „Auf meiner Insel ist das Wasser Wasser und der Nebel Nebel und auf den Tischen sieht man die Spuren vom Entschuppen der Fische.“
mehr
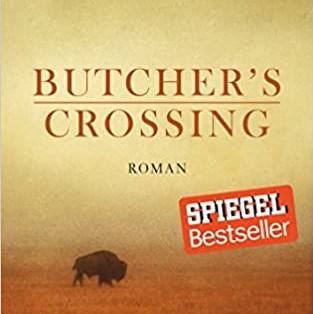
Der Roman spekuliert auf die Prisen einer grauenhaften Vergeblichkeit. Während die Schlächter mit hohen Gewinnerwartungen ein Paradies verwüsten, fallen die Preise für Büffelfelle.
mehr
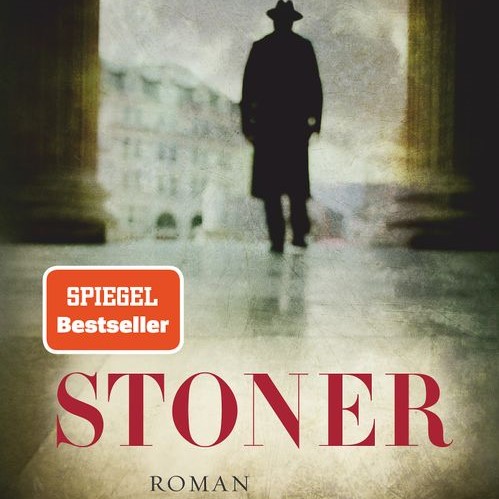
1939 ist Wichita Falls noch nicht lange nur ein Endbahnhof mit Verladestation für den Viehtrieb in Nordtexas. Der Bau des ersten Wolkenkratzers in Texas endete vor Ort als Schildbürger:innen-Posse. Dem Tycoon John G. Hardin verdankt sich immerhin eine Hochschule. „Den Enkeln der Pioniere“ öffnen sich die Pforten von Academia fern der traditionsreichen Universitäten an der Ostküste. Zu jenen, die dem bodenständigen Cowboystyle modischen Eigensinn entgegentragen, gehört der Sohn des Hausmeisters im Postamt von Wichita Falls. John Edward Williams (1922 -1994) flaniert mit der Extravaganz eines „englischen Junkers“ im Blazer und mit Seidenschal über die Magistrale ...
mehr

Blick auf Venedig - Das 'Fondaco dei Tedeschi - Lagerhaus der Deutschen' ist ein Kaufhaus mit einer Aussichtsplattform. Der Name erinnert an eine deutsche Niederlassung am Canal Grande, die im 13. Jahrhundert bereits Gegenstand des Schriftverkehrs war.
mehr

Venedig war das New York der Renaissance. Seine Kirchen bilden eine sakrale Skyline.
mehr
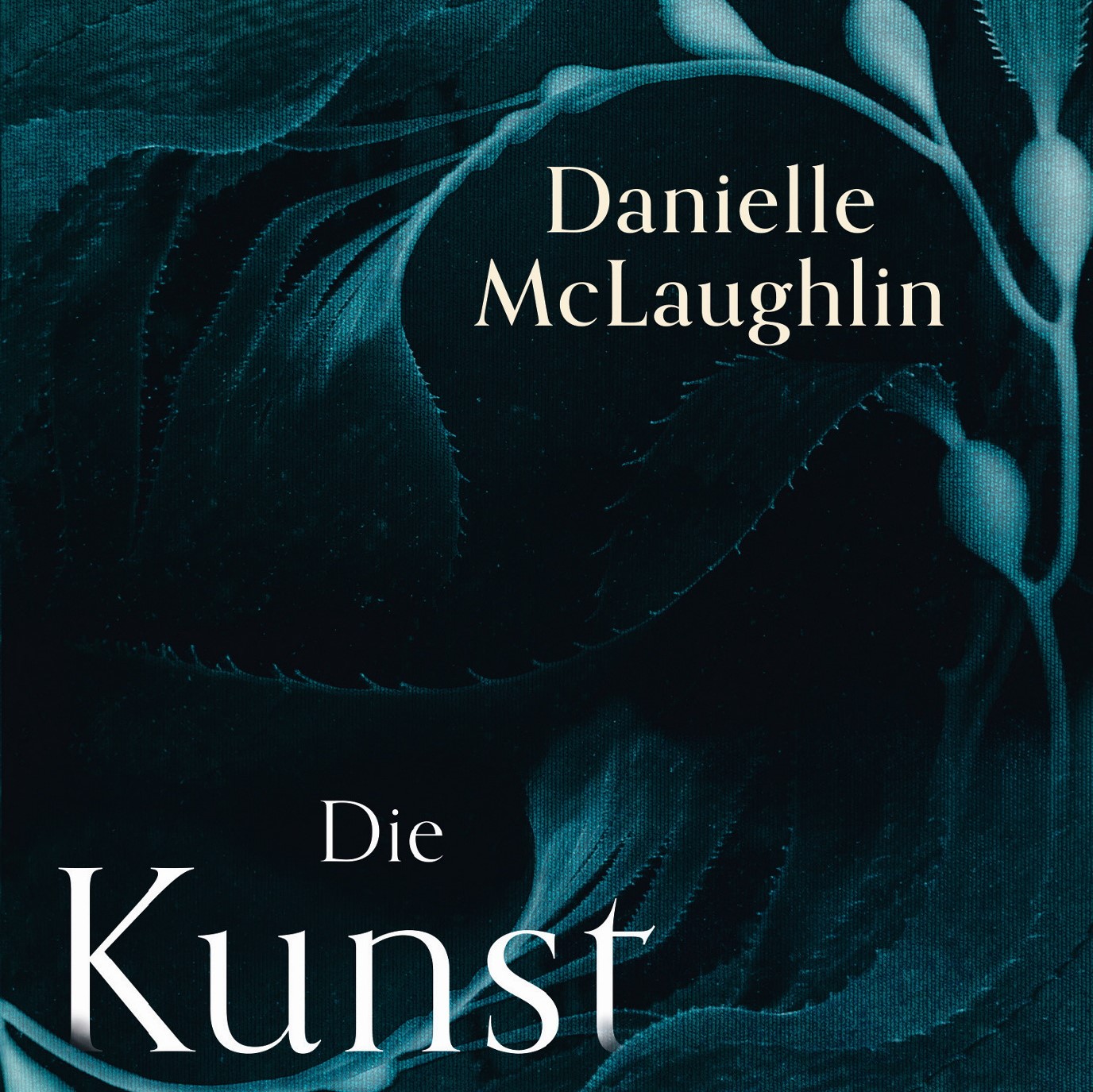
Nessa McCormack brilliert als Kuratorin. Sie betreut das mit öffentlichen Mitteln kanonisierte Werk des verstorbenen Bildhauers Robert Locke. Niemand steckt tiefer in der Materie als Nessa. Die Deutungswurmfortsätze eines jeden biografischen Splitters und Genese-Fadens sind ihr geläufiger noch als der gralshütenden Witwe Eleanor ...
mehr

Venedig war das New York der Renaissance. Seine Kirchen bilden eine sakrale Skyline.
mehr

Venedig war das New York der Renaissance. Seine Kirchen bilden eine sakrale Skyline.
mehr
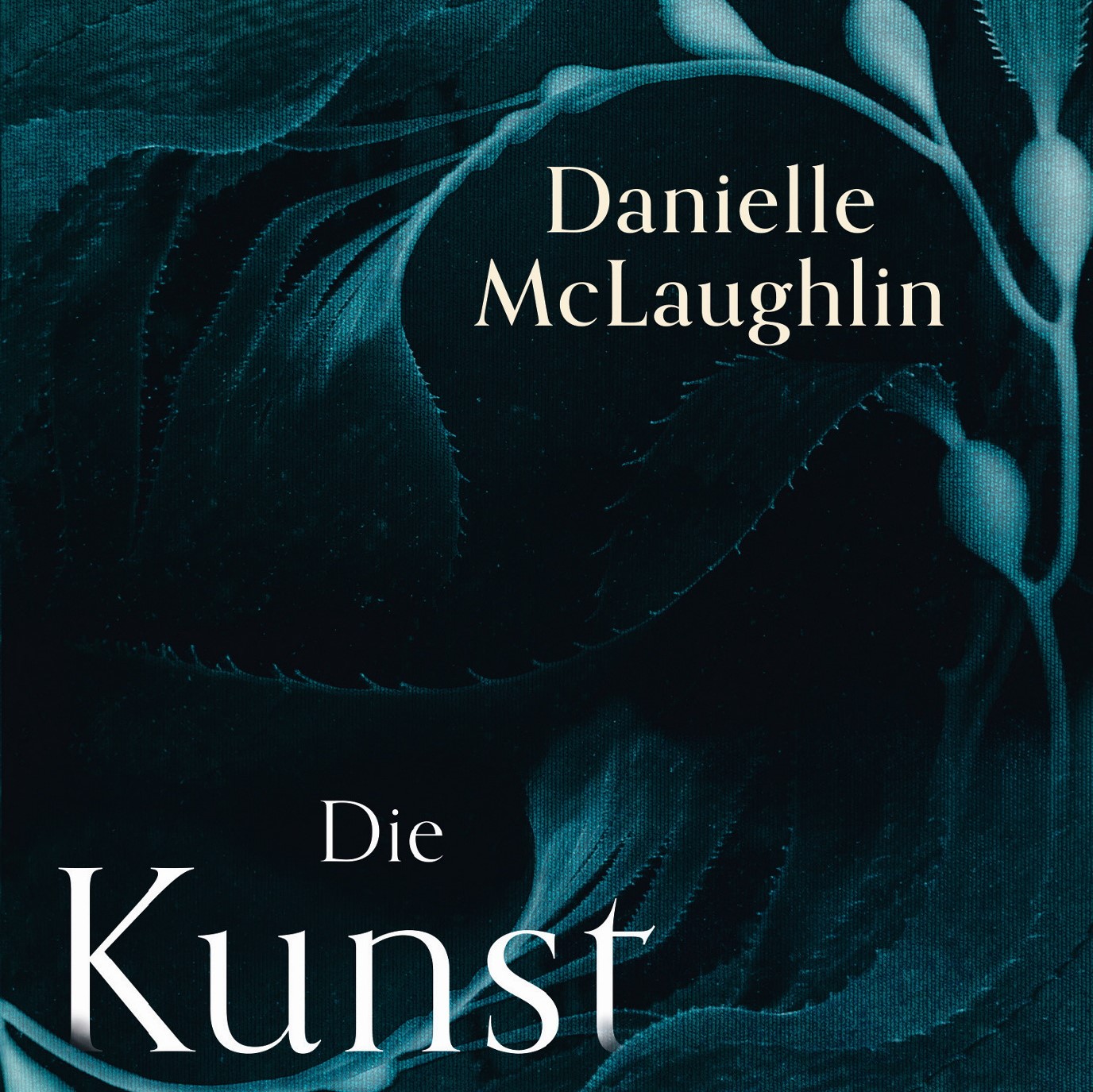
Anfang der 1970er Jahre verdingt sich die Kroatin Melanie Petrovic alias Doerr als Putzfrau und Köchin in einer Künstler:innenkolonie auf der irischen Halbinsel Inishowen. Die Dienstleistungen dienen der Tarnung. Ohne Vorbildung möchte Melanie in eine Kunstproduktion einsteigen. Sie nähert sich dem Bildhauer Robert Locke, einem in Irland heimisch gewordenen Schotten. Sie entfacht das Feuer der Kollaboration. Der frisch Verheiratete lässt sich hinreißen. Er initiiert Melanie.
mehr

Venedig war das New York der Renaissance. Seine Kirchen bilden eine sakrale Skyline.
mehr
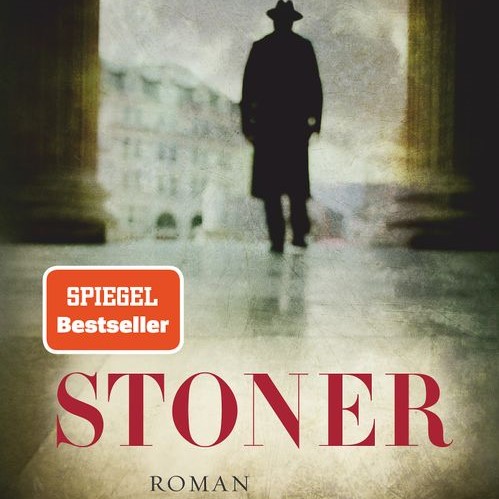
Der Autor unterläuft den biblisch-elementar grundierten Epos-Charakter des Einstiegs mit einem Verzicht auf Sprachgewalt. In kargen Worten schildert Williams Stoners erste akademische Krise, ausgelöst von einer Pflichtveranstaltung, die der naturwissenschaftlichen Ausrichtung des Agrarstudiums zuwiderläuft. Die angehenden Ingenieure müssen eine Einführungsvorlesung in Literatur über sich ergehen lassen. Die meisten erleben den Unterricht als Störung.
mehr
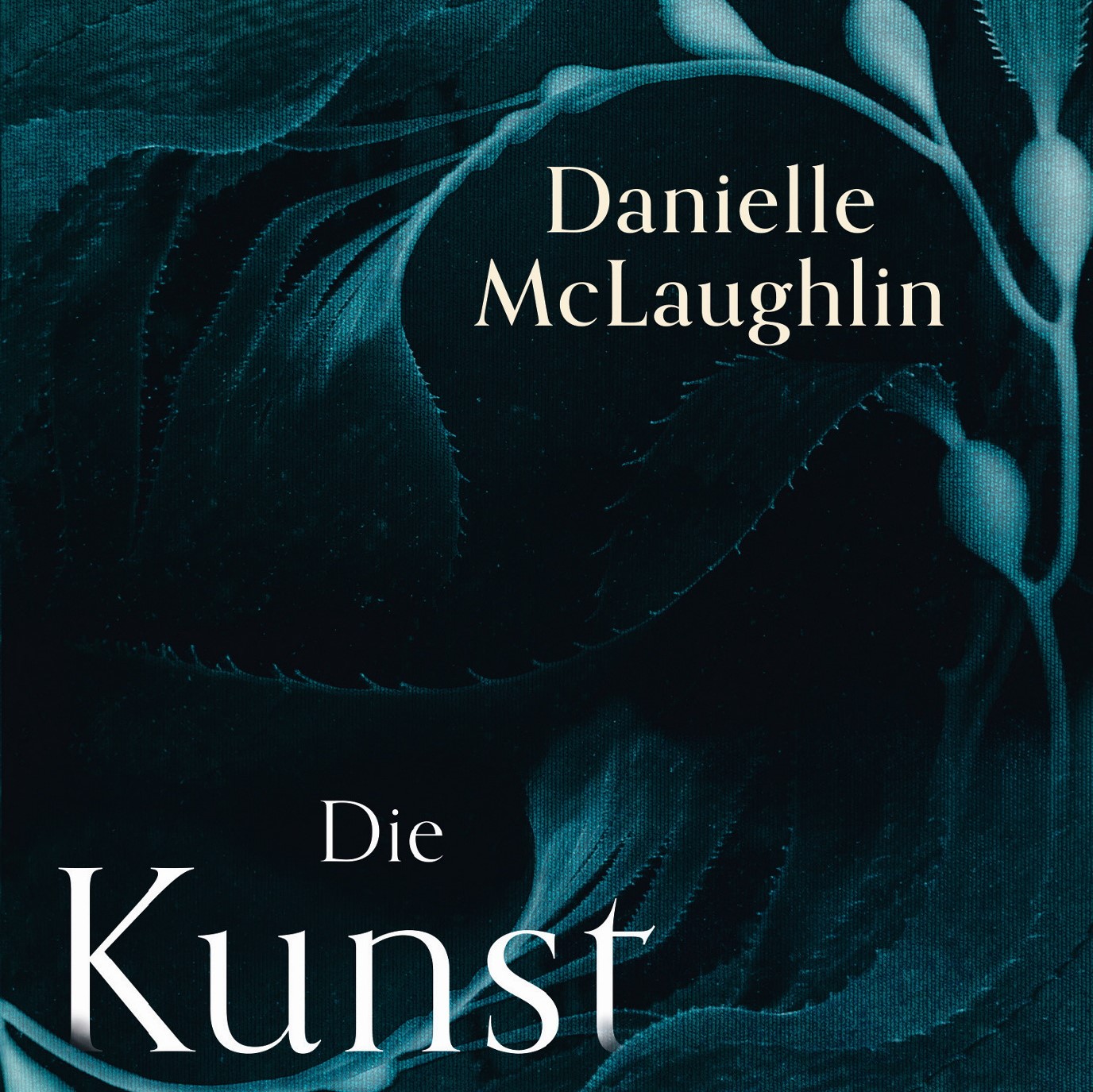
Lange war Irland das Armenhaus Europas. Hunger dezimierte die Bevölkerung im Kahlschlagmodus. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konkurrierten irische Migrantinnen und Migranten in den USA mit den soeben aus der Sklaverei entlassenen Schwarzen. Die irische Diaspora sprengte den Referenzrahmen. Im 21. Jahrhundert drehte sich das Rad. Der keltische Tiger boomte mit atemberaubenden Wachstumsraten.
mehr
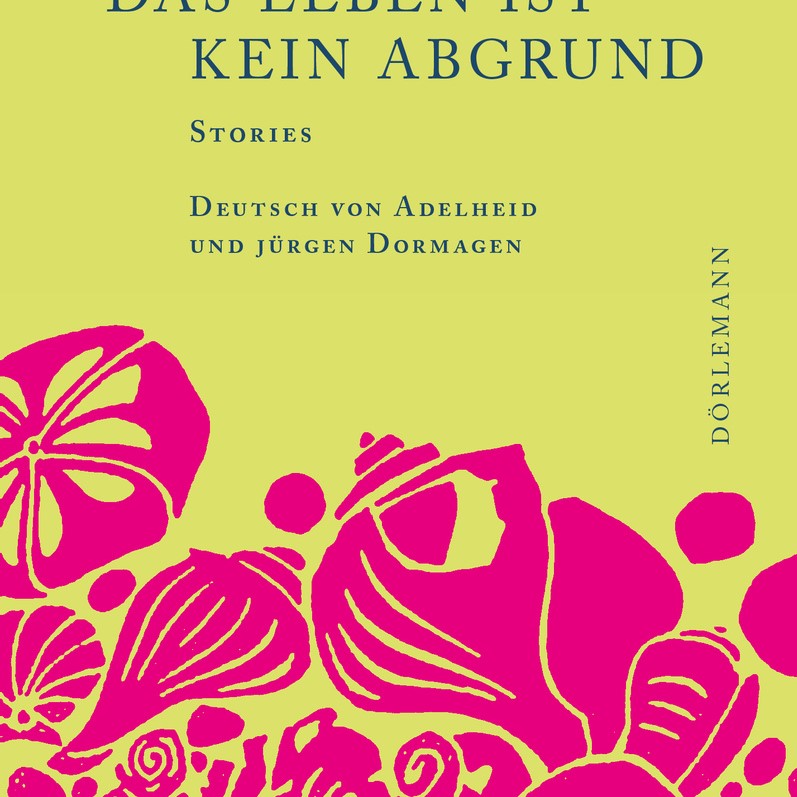
Ralph Fawett ist kaum halbwüchsig und ahnt doch schon „die lieblose Einsamkeit, die auf ihn (im Alter) wartet, wie ein mürrischer Hund“. Der weise Knabe spielt eine Hauptrolle in Jean Stafford 1947 erstmals erschienenen Roman „Die Berglöwin“.
mehr
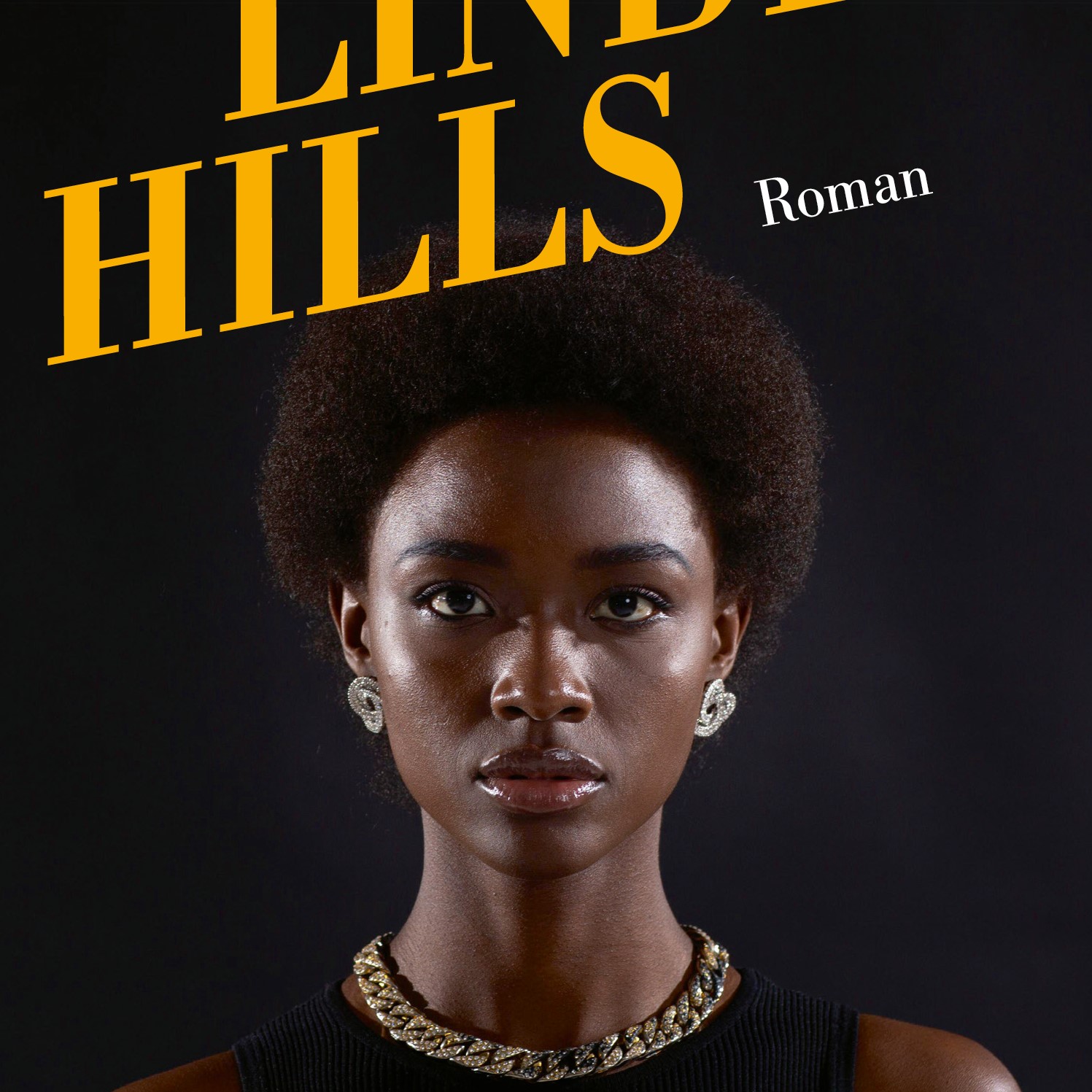
Priscillas Vorgängerinnen waren mit der Erwartung in das Herrenhaus von Linden Hills gezogen, ihre Spielräume als Ehefrauen in Aushandlungsprozessen mit Männern zu bestimmen, die nicht nur stur das Programm ihrer Väter reproduzierten; eine uralte, abweichungsresistente, frauenfeindliche Alltagslitanei.
mehr
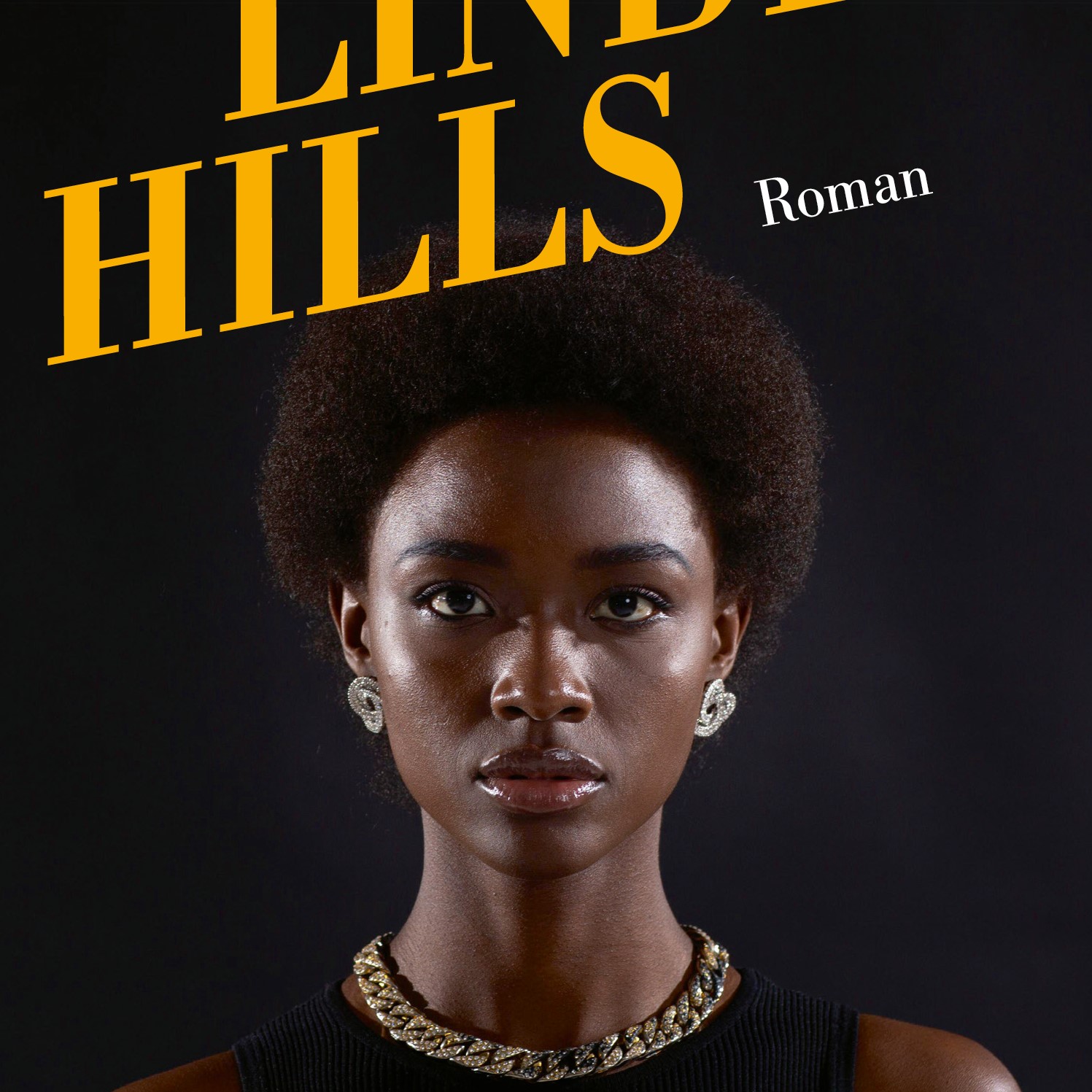
Auf einem Schauplatz Schwarzen Stolzes, einer Bürgerhochburg, die ihren Charakter nicht dem Zufall, sondern den - im Widerstand gegen die weiße Anmaßung formulierten - Absichten grandios vorausschauender, dynastisch verbundener, und nach einem rituellen Geheimrezept in die Welt gesetzter Bestattungs- und Bauunternehmer verdankt, ergibt sich schließlich die Komplikation, dass der weiße Sohn eines Schwarzen Vaters zum Doyen der Großartigkeit würde, ließe man den Dingen ihren Lauf.
mehr
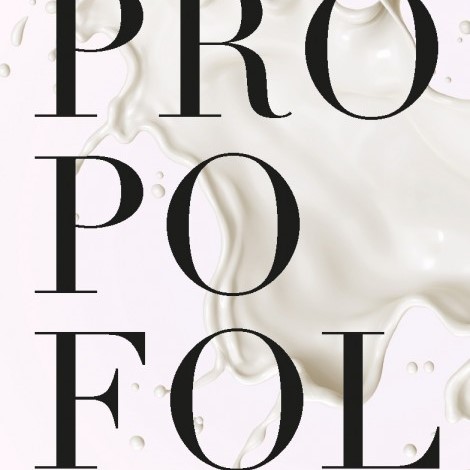
Der Abstieg vom Gott zum Gatten ist ein Klacks gegen den finalen Abstieg vom Arzt zum Autor. Nach einem OP-Versagen erleidet der Chirurg Bernard Rohr einen sozialen Schlaganfall. Auf den letzten Metern seines Lebens verpasst Rohr die Abzweigung in die Bescheidenheit. Stattdessen haut der bald Siebzigjährige einen Arztroman mit dem aufrauschenden Titel „Propofol“ raus.
mehr
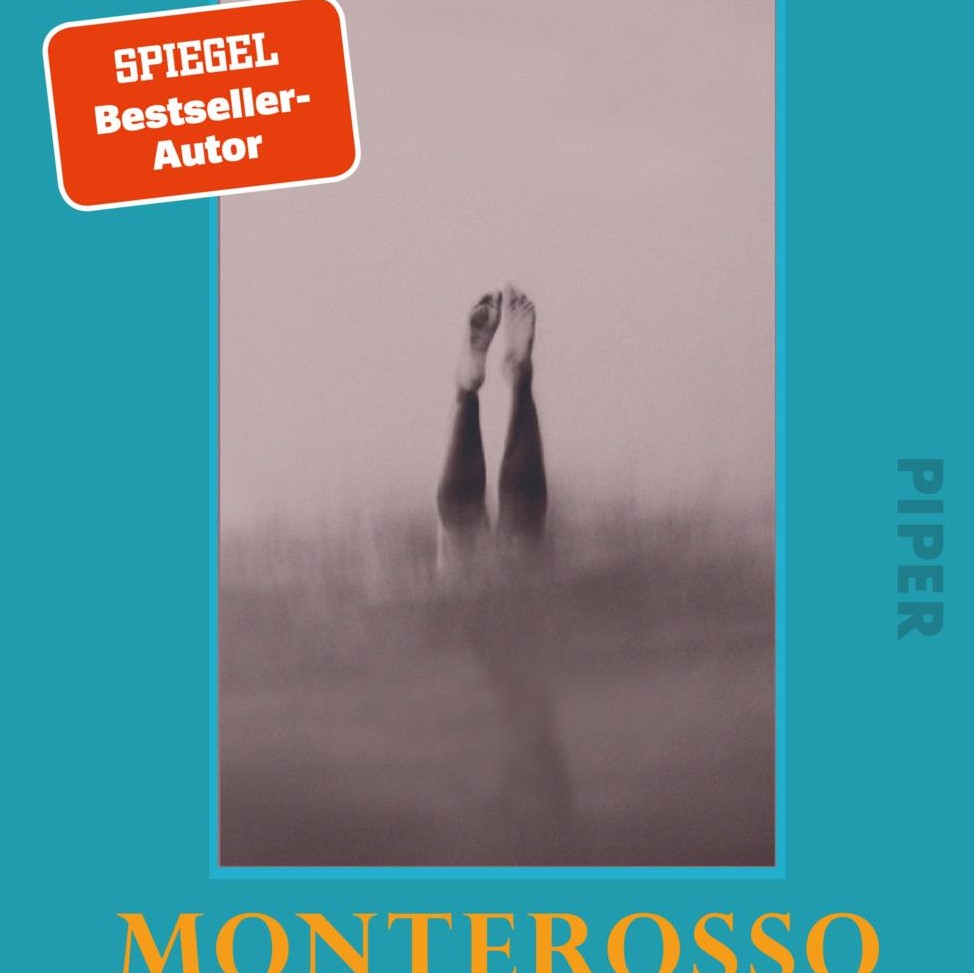
„Das Wort stellt sich vor die Dunkelheit des Nichts.“ Chaim Nachman Bialik
mehr
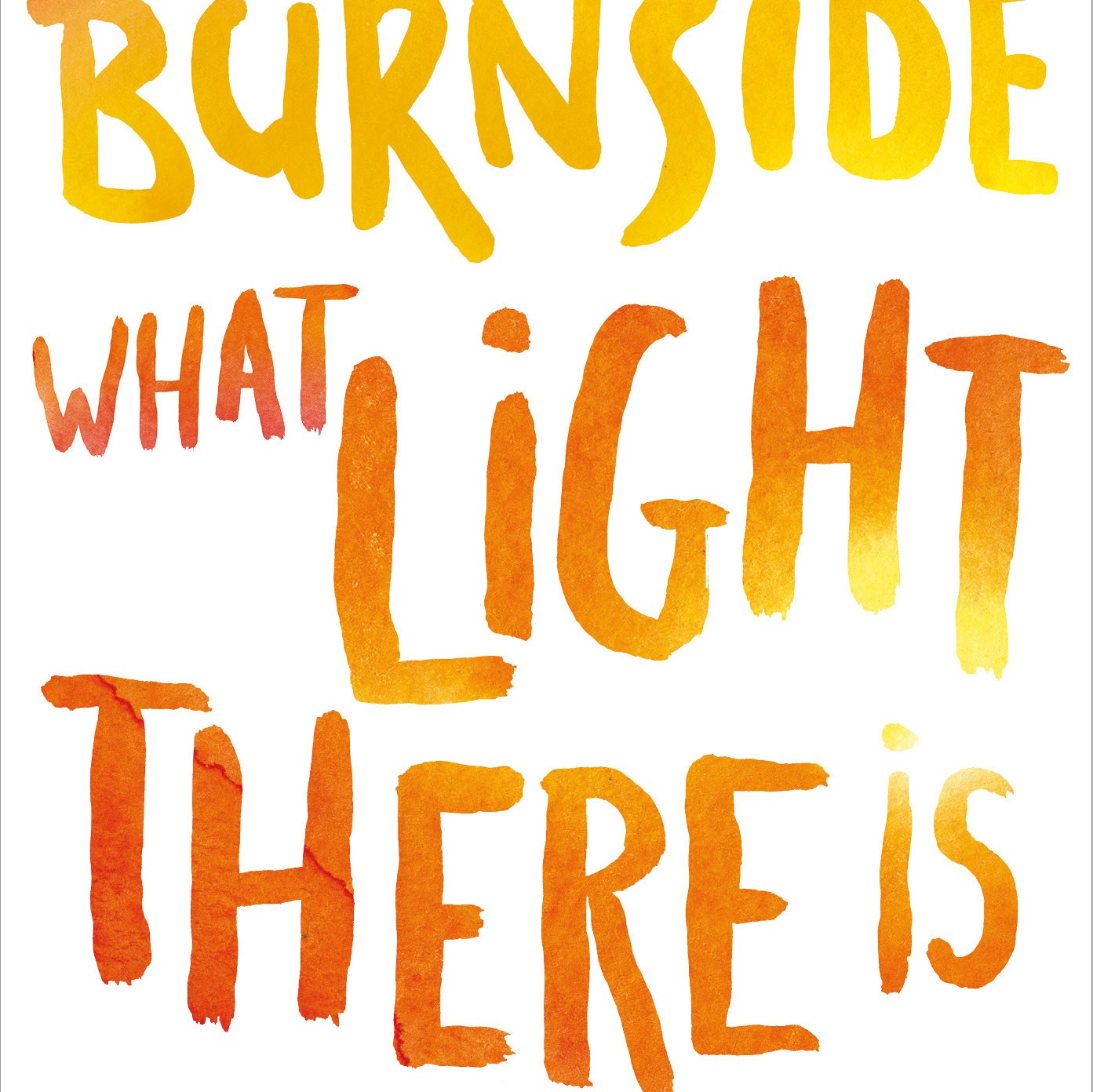
Kritiker:innen erkannten in Robert F. Scott den pompösen Stümper. Francis Spufford fand „devastating evidence of bungling“. Paul Theroux bezeichnete Scott als „Mysterium für seine Männer … (als einen) Nichtskönner … Scott was insecure, dark, panicky, humorless, an enigma to his men, unprepared, and a bungler, but in the spirit of a large-scale bungler, always self-dramatizing”.
mehr
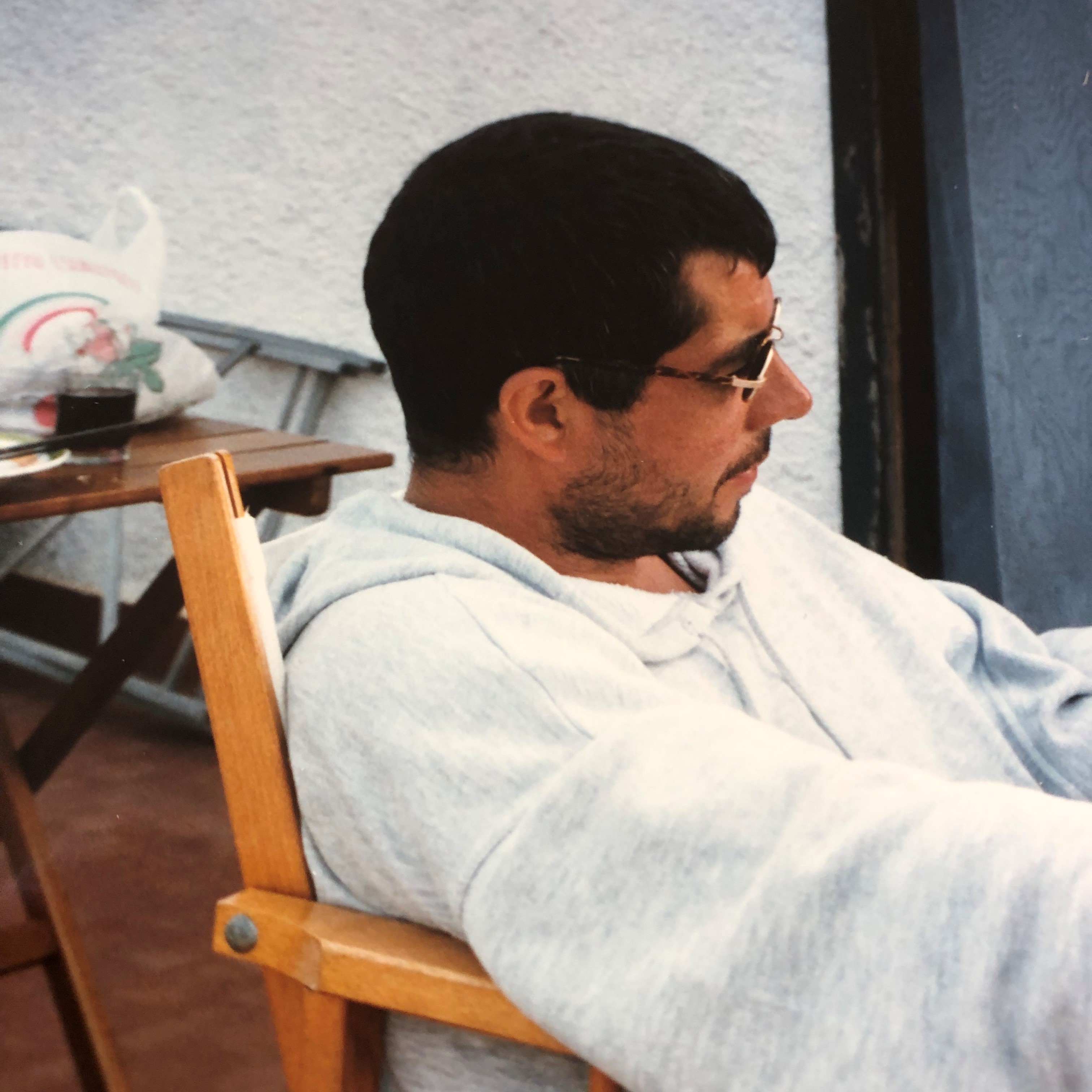
… die ins Allgemeine diffundierte, in Academia populäre Idee, man könne der bürgerlichen Karriere ein revolutionäres Krönchen aufsetzen. Ulrike Meinhof avancierte nicht zuletzt deshalb zum Idol. Die Pistole in ihrer Handtasche wirkte ikonografischer als das Emblem der Roten Armee Fraktion. Gleichzeitig symbolisierte die Waffe ein biografisches Desaster.
mehr
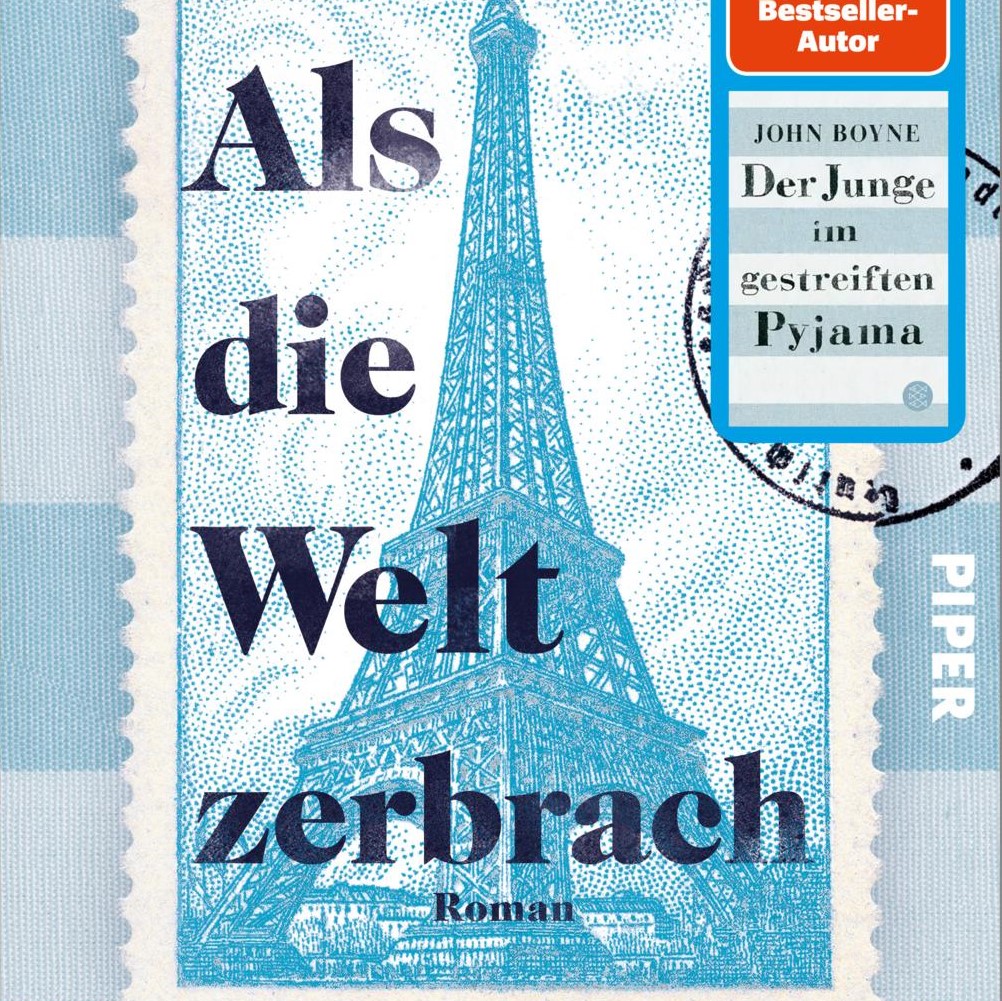
Thérèse und Laurent sind ein heimliches Liebespaar in einem Dreieck mit Thérèses Ehemann Camille. Eines Tages fahren Laurent, Thérèse und Camille nach Saint-Ouen-sur-Seine, einem ländlichen Industriestandort in der Pariser Agglomeration. Das Trio mietet einen Stechkahn. Auf dem Fluss stößt Thérèses Liebhaber den Gehörnten über Bord, einem Vorsatz entsprechend. Das erzählt Émile Zola in „Thérèse Raquin“. Zolas drittem, erstmals 1867 erschienenen, mit Erzählkonventionen brechenden ...
mehr

„Ich bin eben gnädig geführt worden von einem Schicksal, das es zwar streng, darunter aber immer grund-freundlich mit mir meinte.“ Thomas Mann
mehr
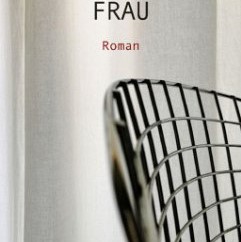
Elena wohnt noch nicht lange an der Hauptstadtmagistrale eines untergegangenen Landes. Der Makler avisierte die ehemalige Stalin-Allee als „Flaniermeile“ der Berliner Gentrifizierungsbourgeoisie in naher Zukunft.
Die Erzählerin entdeckt eine „ereignislose Straße“. Die zur Ohnmachtskulisse heruntergekommene, realsozialistische Triumpharchitektur liefert als Beton-Alp dem DDR-Scheitern ein Nachbild.
mehr
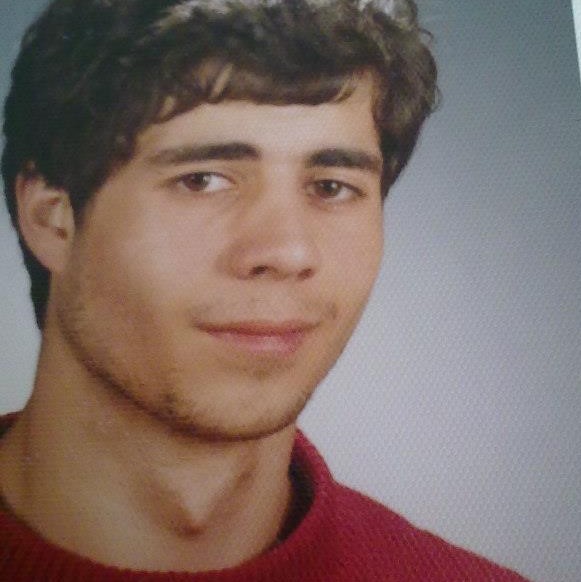
“We want to make sure all of our movements contain our total body weight in order to maximize our power output.” Maksem Manler
mehr
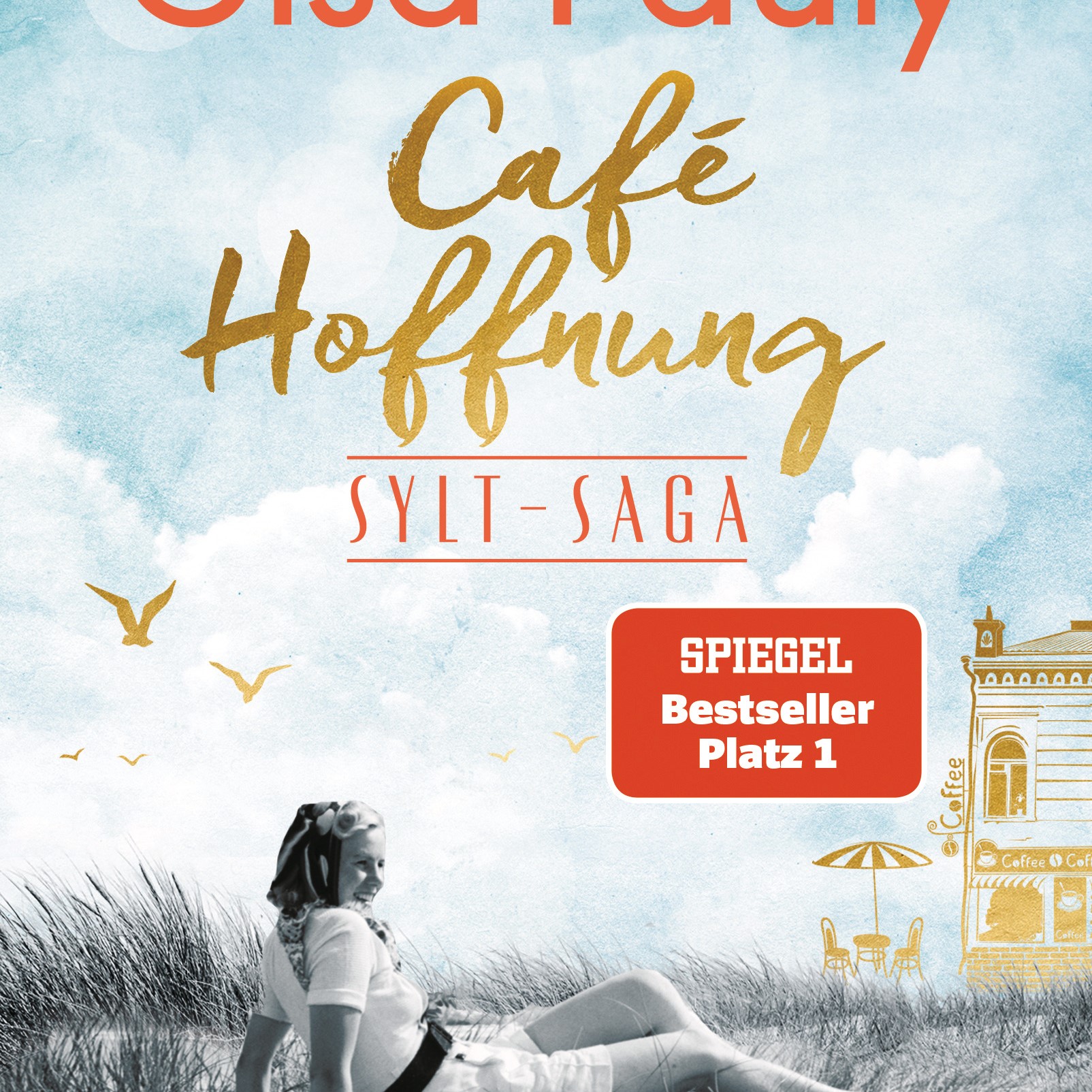
Kari Rensing lebt da, wo andere Urlaub machen. Sie ist ein Kind der Lieblingsinsel aller Sechzigerjahre-Deutschen, diesen keimzeitlichen Bundesrepublikaner:innen* im Spätlese-Rausch des Wirtschaftswunders.
mehr
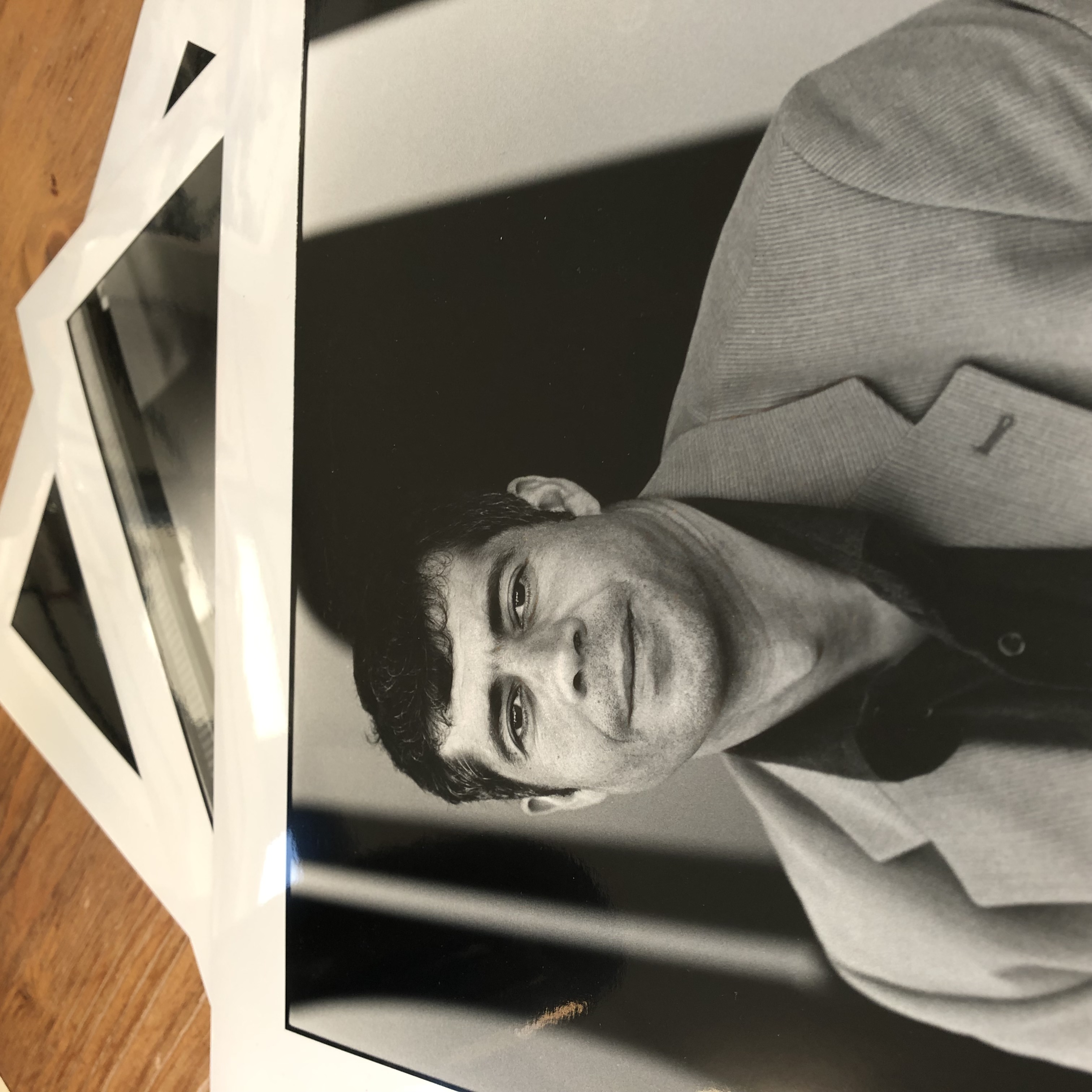
Ein Kavalier des 18. Jahrhunderts unterschied nicht zwischen Arbeit und Sklaverei. Das Leben wollte von der passablen Seite genommen werden, die Wände des Pechstein’schen Wohnzimmers waren von carrarischem Marmor, den Plafond trugen acht Säulen. Der Ritter ergab sich dem Raumgefühl auf vierhundert Fuß Länge, sechzig Fuß Breite und zweiundvierzig Fuß Höhe.
mehr
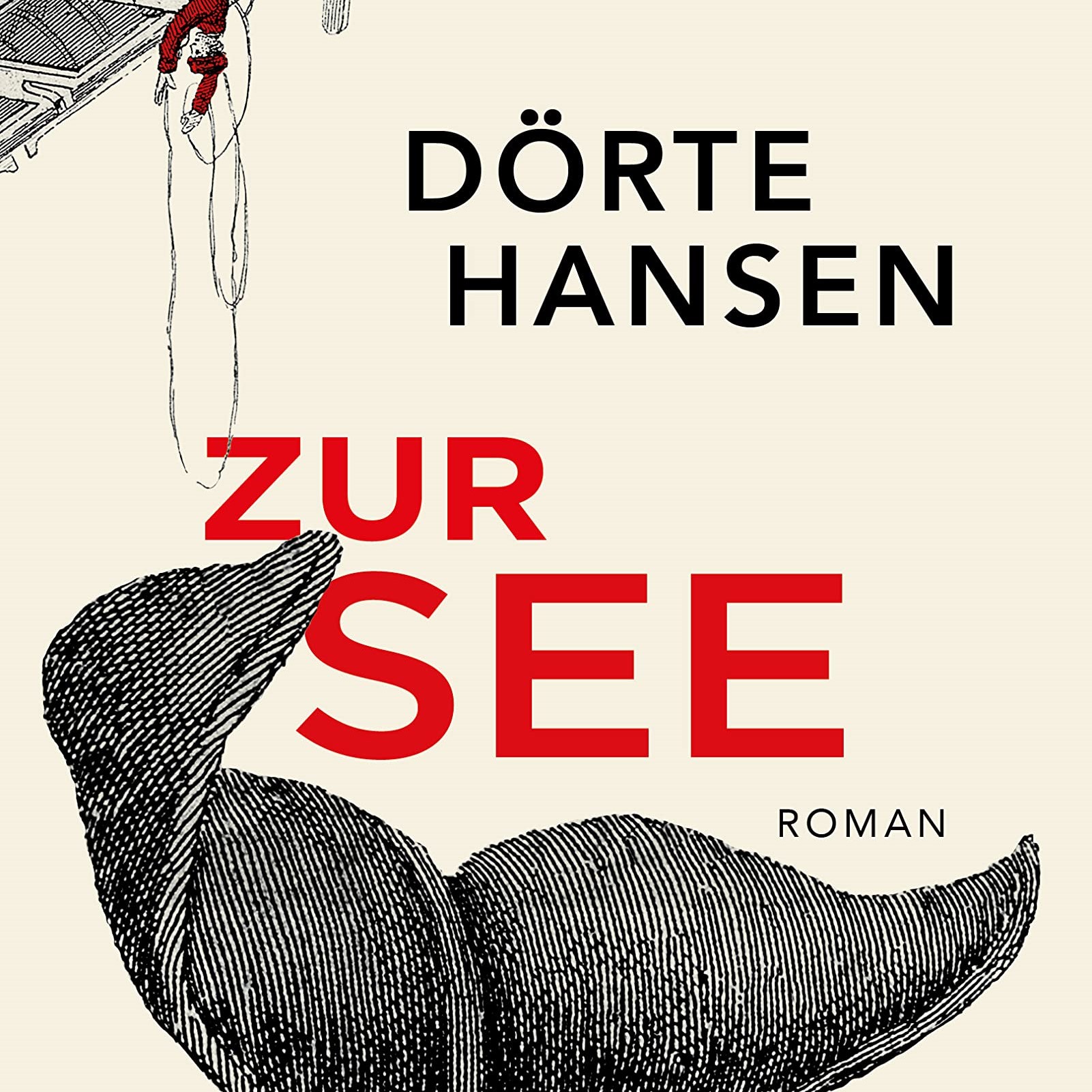
Hanne und Jens Sander nehmen die Wut ihrer Ahnen persönlich, so als wäre die entbehrungsreiche Ära des Walfangs auf Segelschiffen nicht schon seit Jahrhunderten Geschichte gewesen, als sie sich zusammenrauften.
mehr
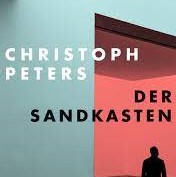
In seinem jüngsten Roman erzählt der Autor vom hauptstädtischen Haifischbecken im zweiten Jahr der Pandemie. Sein Held, der kratzbürstige Kurt Siebenstädter, schiebt Frühschichten in der Öffentlichkeit einer Rundfunkanstalt. Seine Stimme hören Millionen, während sie sich für den Tag rüsten.
mehr
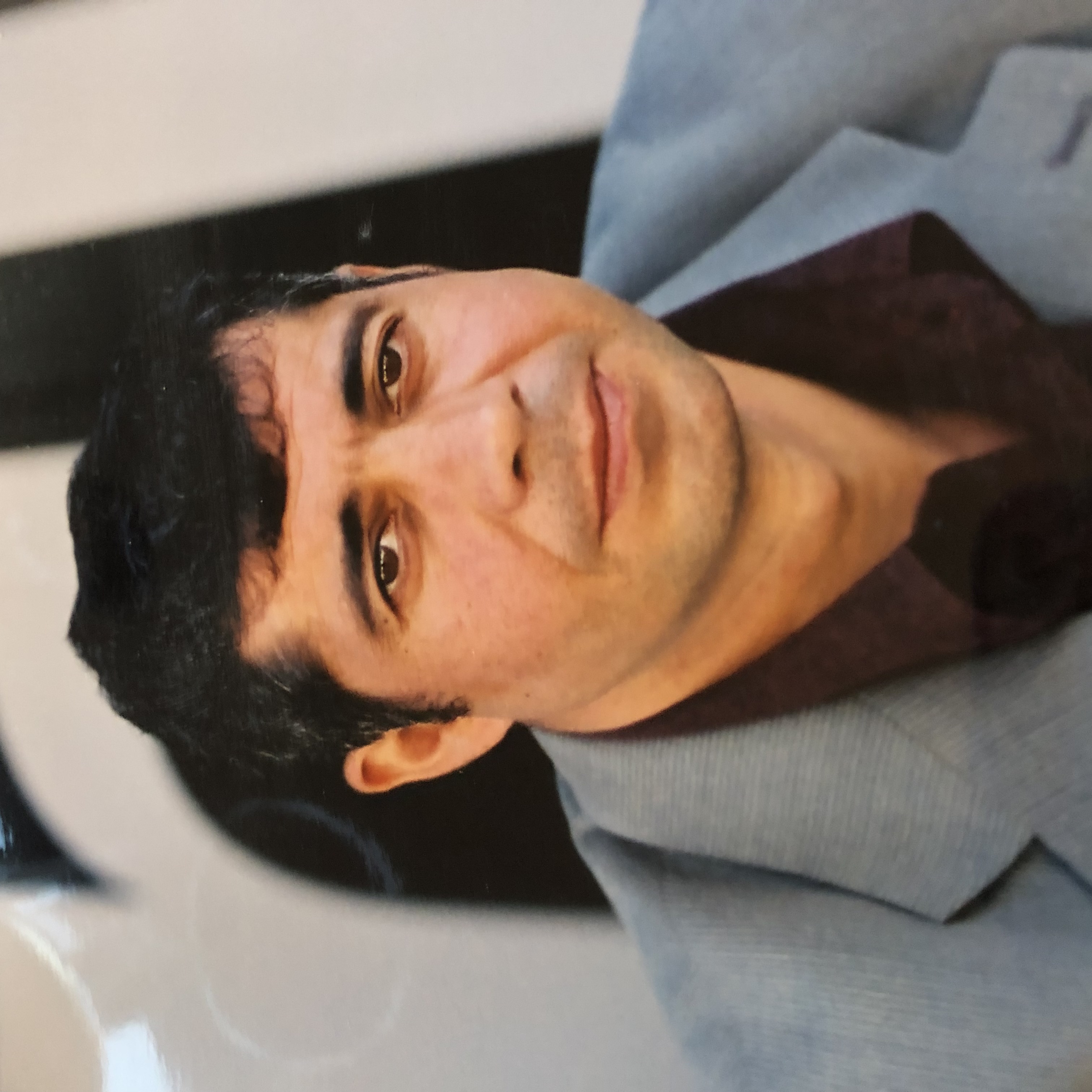
“We are ... training ... to command our movement. In other words, we are reprogramming our body’s ability to follow our intention.” Maksem Manler
mehr
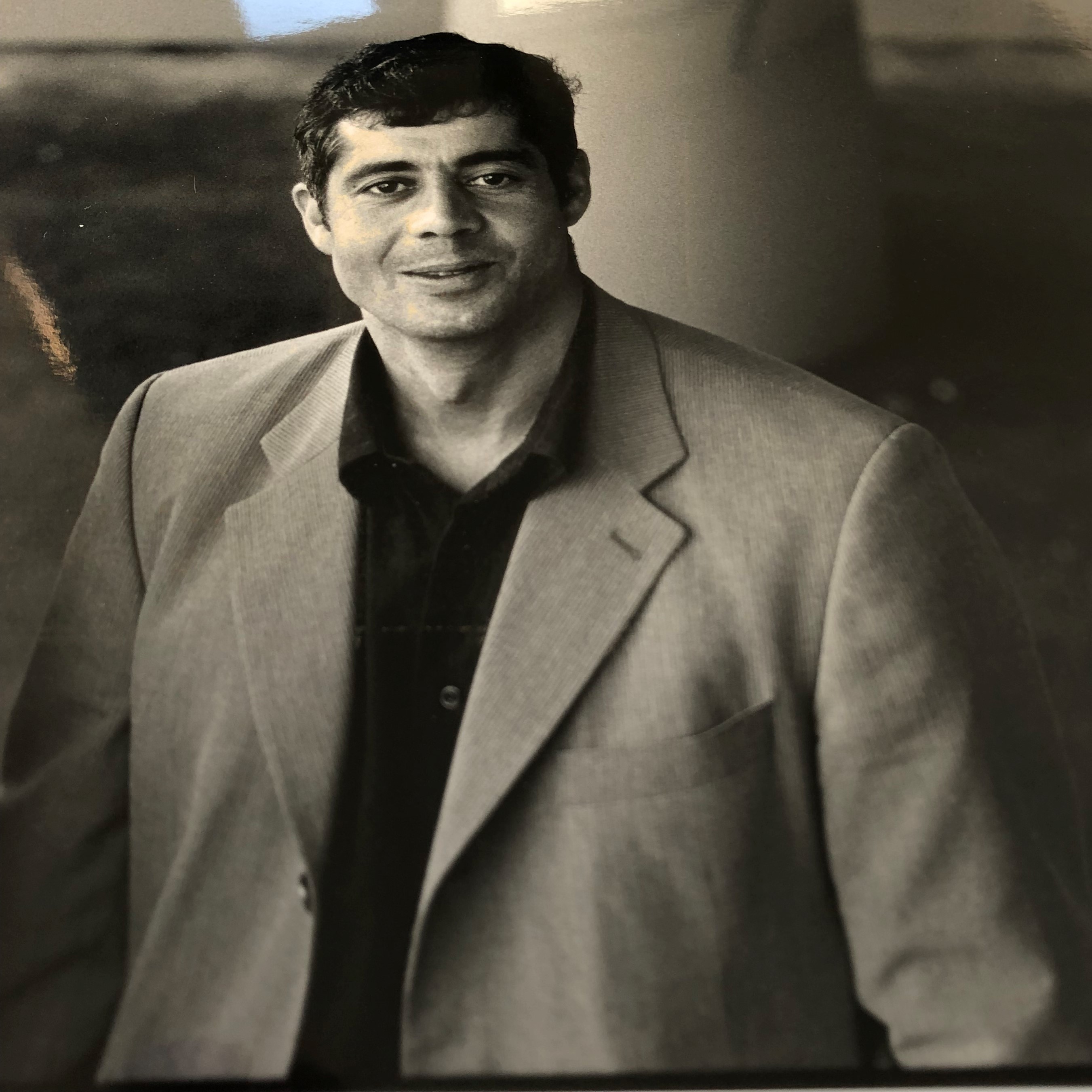
“The purpose of Siu Nim Tao* is to train the brain to accept the idea of not using force.” Chu Shong Tin, zitiert nach Maksem Manler
mehr

In Biotensegrity-Systemen gibt es nur Spannung und Kompression.
mehr
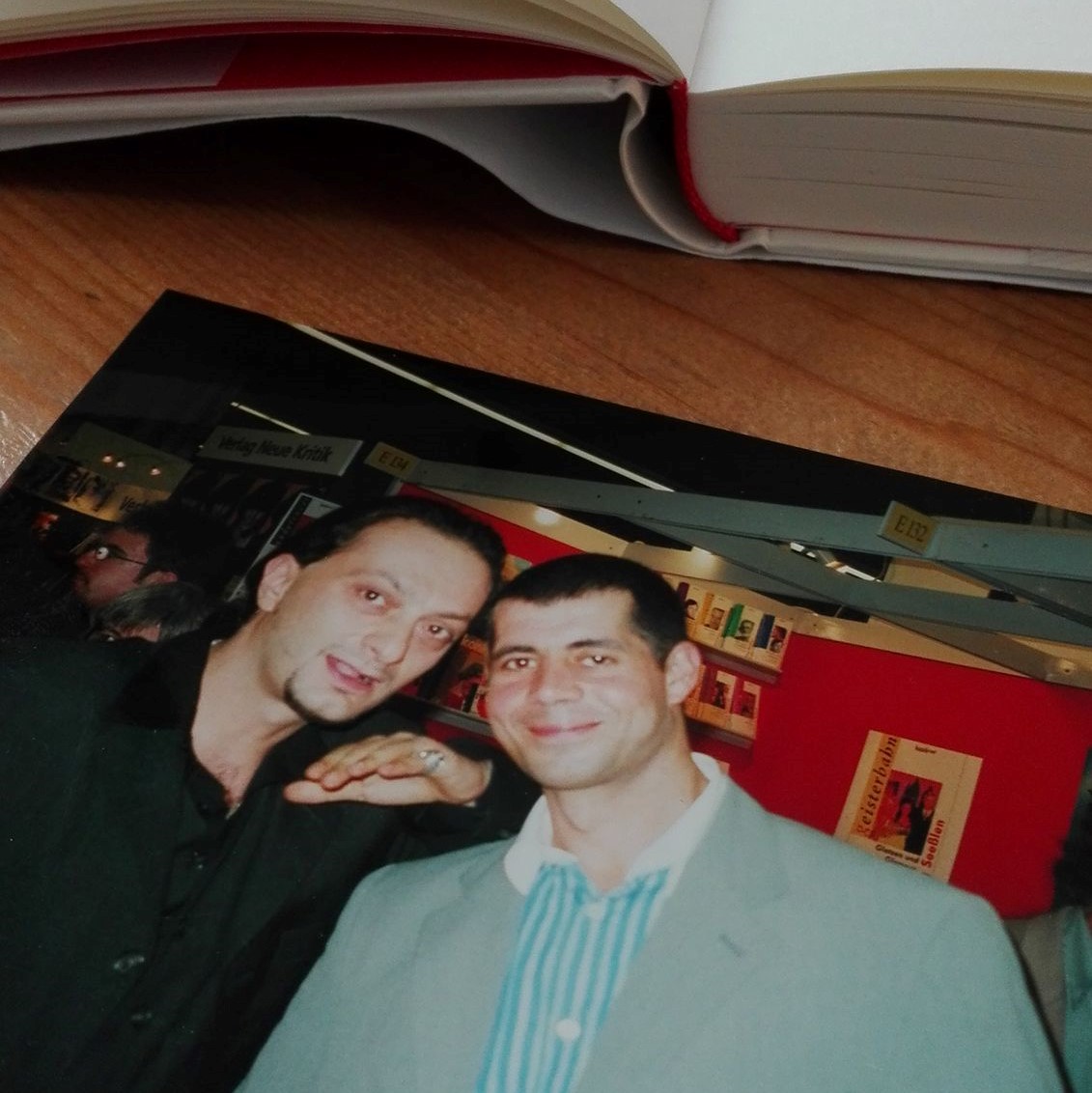
„Der Kampf zwischen Israel und Palästina ist ein Kampf zwischen zwei Opfern Europas.“ Ulla Berkéwicz
mehr
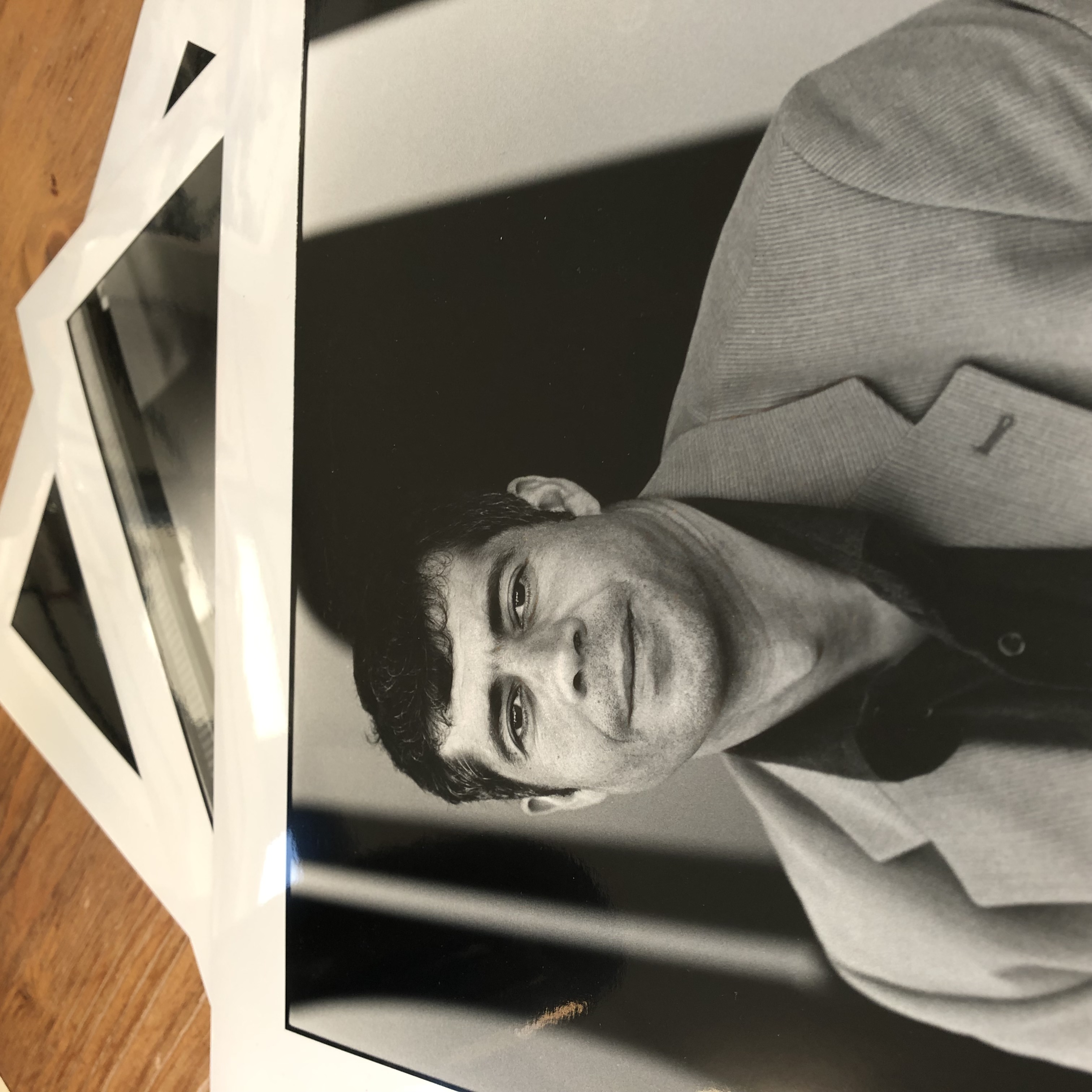
„Das Spiel der Könnerschaft beginnt da, wo unter Druck jenes Gleichgewicht entsteht, dass der Druck brechen soll.“ Cole von Pechstein
mehr
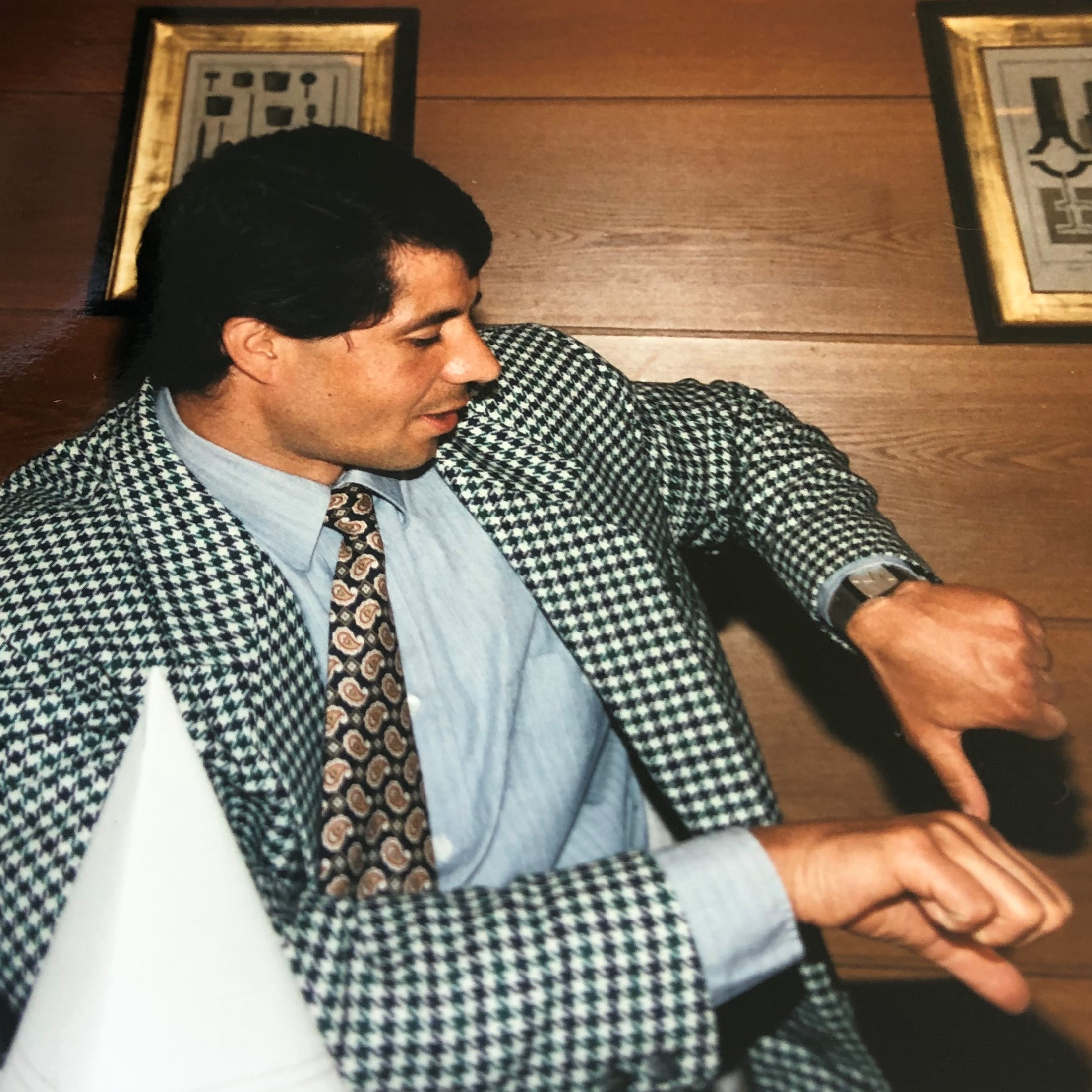
“First (we) destroy the opponent’s ability to guard his centre.” Dr John Fung ---
“My centre is everywhere.“ Chu Shong Tin, zitiert nach Maksem Manler
mehr
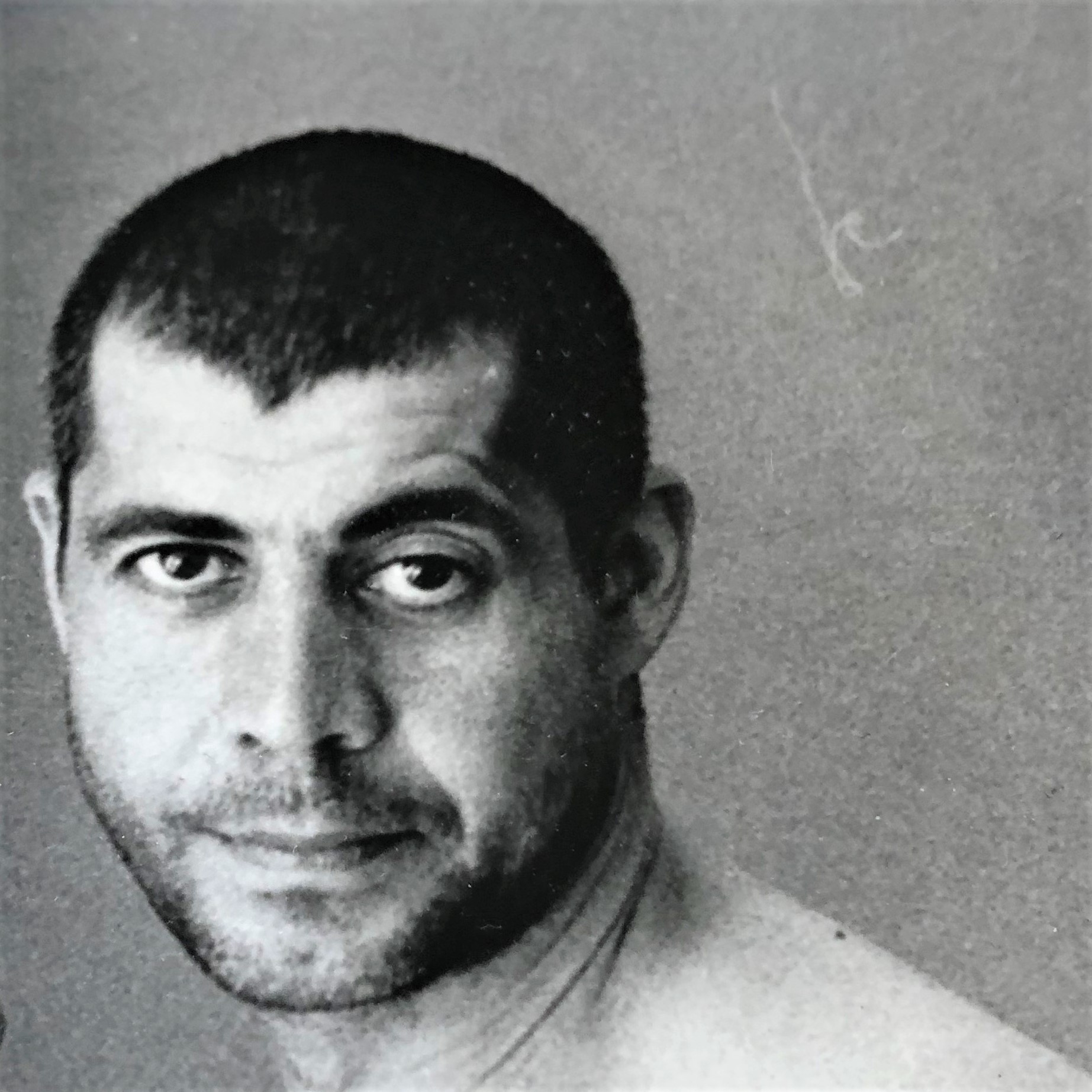
„Варіантів немає, тільки перемога, тільки вперед. А потім знову, знову і знову! - Es gibt keine Optionen, nur Sieg, nur vorwärts.“ Irina Galay zum Kampf der Ukrainer:innen*
mehr

Paul Mason erzählt irgendwo von seinem Vater, einem Mann, der in seinem Milieu keine herausragende Stellung einnahm und mit der Kumpel-Akzeptanz über die Runden kam, die sich die Bergarbeiter im englischen Leigh gegenseitig einräumten. Der alten Mason hatte die Depression der 1930er Jahre als Kind erlebt und prophezeite 1980 als Großbritannien „in die Rezession schlitterte: Wenn eine weitere Depression kommt, werden die Rassenvorurteile zurückkehren.“
mehr

Was hat Bruce Lee tatsächlich gesagt, und was wurde Miyamoto Musashi in den Mund gelegt? Ein schrecklicher Verdacht mischte die allgemeine Euphorie auf. Sollten sich die Verschworenen der Karateschule Pechstein mit erfundenen Zitaten aufgepulvert haben? In Zweifel gezogen wurde folgende Ansage von Musashi (angeblich) nicht zuletzt: “Do not sleep under a roof. Carry no money or food. Go alone to places frightening to the common brand of men. Become a criminal of purpose. Be put in jail, and extricate yourself by your own wisdom.”
mehr

Mit mir hatte Frau Banshee nicht gerechnet. Sie trug Holgers Bademantel mit hochgeschlagenem Kragen. Ich half ihr aus der Verlegenheit. In den Sommerferien war Frau Banshee in Rio de Janeiro gewesen, sie erzählte von Straßenjungen, undankbar und wild ... bis ich verstand, dass die Jungen von Ordnungskräften totgeschlagen wurden wie Katzen im Sack. Besitzende zahlten dafür, um dem solventen Publikum den Anblick der Armut zu ersparen.
mehr

„Vergangenes Wochenende ist in Kassel die 15. Ausgabe der Weltkunstschau documenta zu Ende gegangen. Begleitet wurde die Veranstaltung von einer erbitterten Debatte über den in unterschiedlichen Kunstwerken ausgedrückten Antisemitismus. Vorwürfe gegen das Kurator*innenkollektiv ruangrupa, aber auch gegen andere eingeladene Kollektive, sowie Mitglieder des Artistic Teams waren schon zu Beginn des Jahres ...“
mehr

Zurzeit beschäftigen wir uns mit der Kombination von Vorwärtsspannung, Bewegungsökonomie, Einheitlichkeit und Gelenkfreiheit mit Mühelosigkeit, Gleichzeitigkeit und Gegenwärtigkeit.
mehr

Im Tokioer Rotlichtdistrikt Kabukichō verkörperten Yakuza eine unübersehbar schillernde Ordnungsmacht. Sie schlugen Pfauenräder. Sechzig Prozent ihrer „Söhne“ rekrutieren sich aus dem Elend der Burakumin - Unberührbaren. Ihr Straßenkarate ging auf Ōyama Masutatsu (1923 - 1994) zurück. Ōyama Masutatsu gehörte der koreanischen Minderheit an und hatte gewaltige Akzeptanzprobleme in einer offensiv rassistischen Gesellschaft. Zu den Rivalen der Yakuza zählten die Snakehead, eine chinesische Schlepper:innen*formation ...
mehr
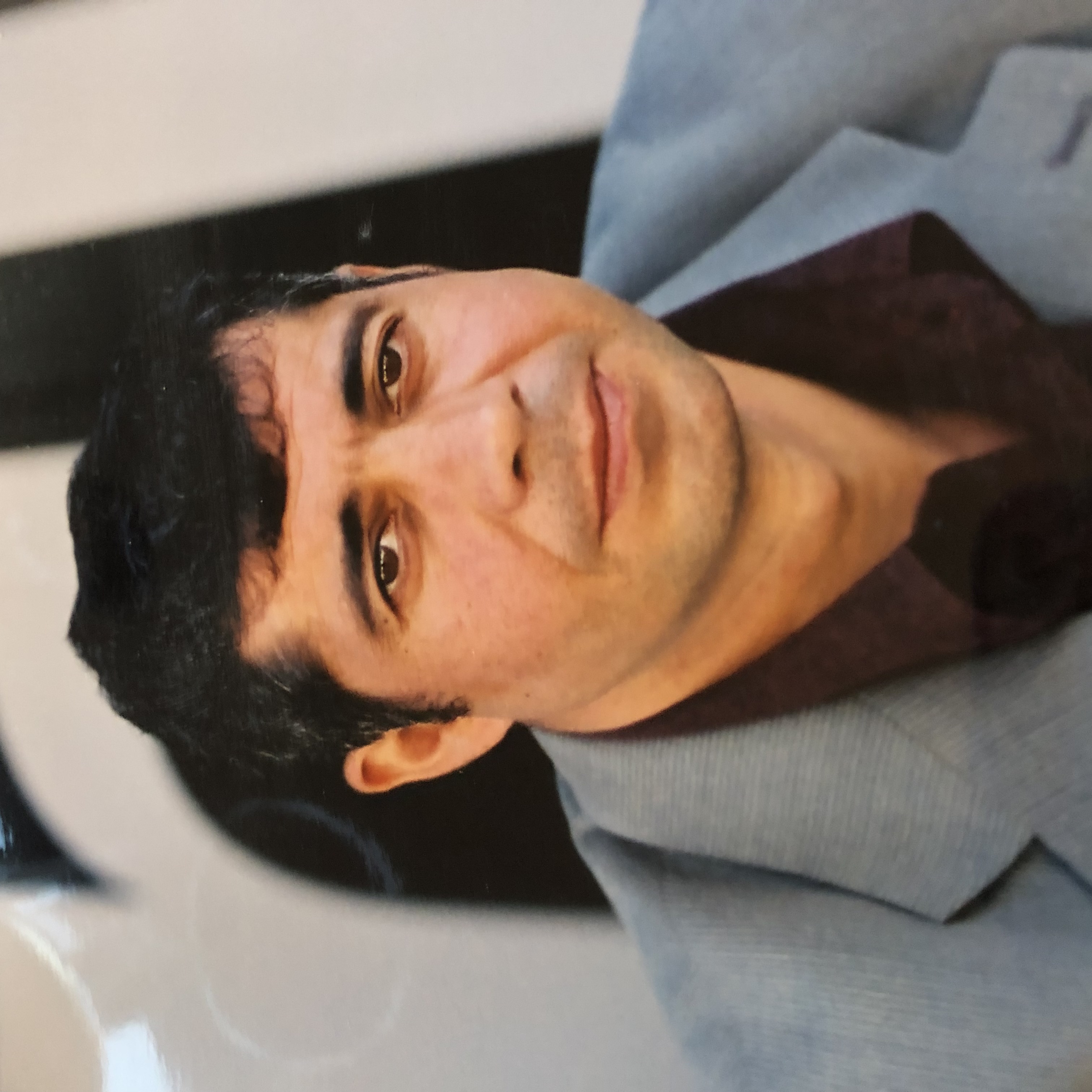
Die Mafia versprach Leoluca Orlando den Tod, er sollte sich fühlen wie ein Gast kurz vor Ende der Feierlichkeiten. Leoluca Orlando fühlte sich weiter wohl. Er pfiff auf die Drohungen, er sang sein eigenes Lied. Ich habe viele beeindruckende Frauen und Männer getroffen, aber nicht drei in all den Jahrzehnten der Jagd nach Gesichtern und Geschichten von Leoluca Orlandos Kaliber. Er kam mir selbst wie ein Killer vor. Er hatte nicht nur keine Angst. Die ständige Gefahr, in der er schwebte, verlieh ihm eine Aura.
mehr
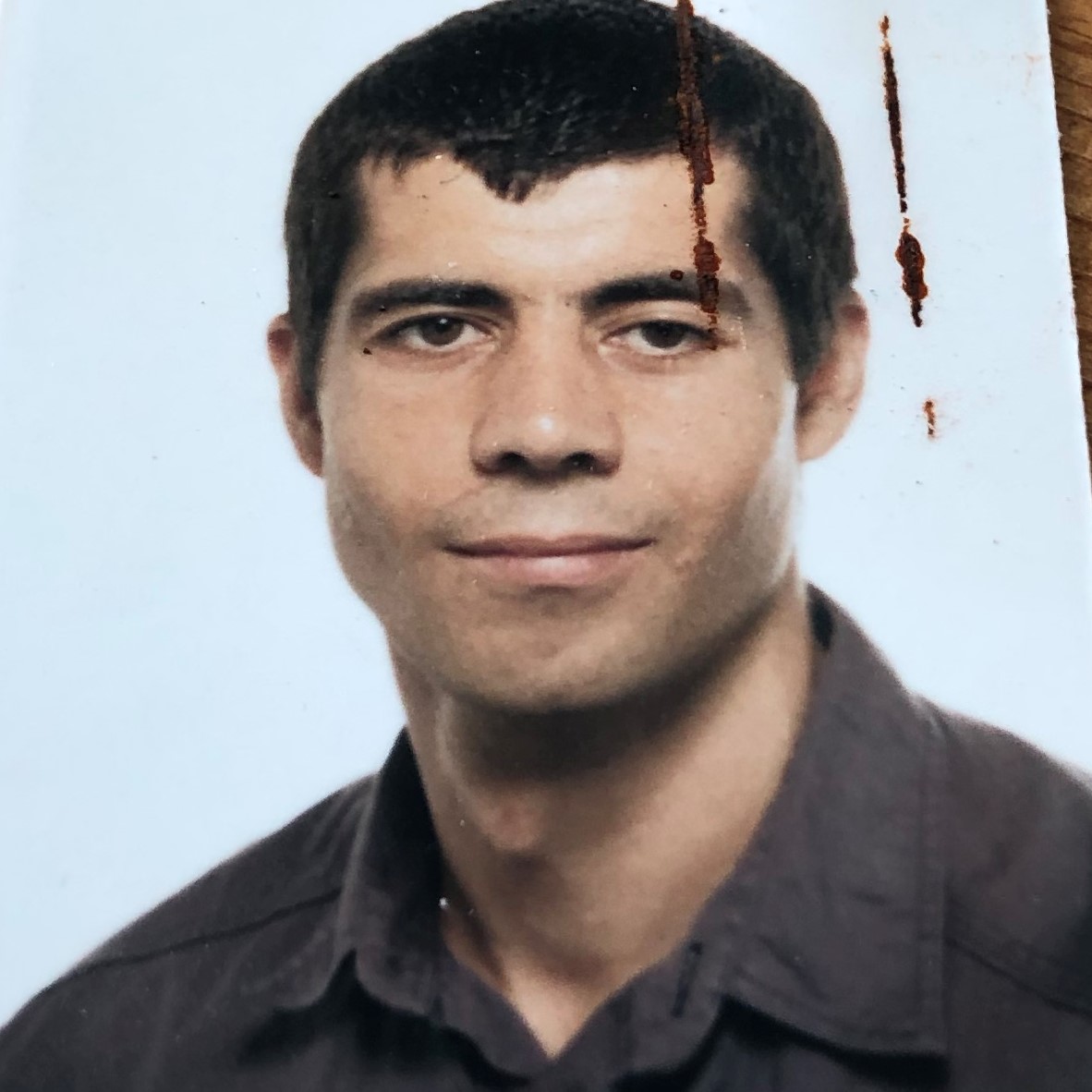
Auf Instagram lässt sich eine Karateliebe mit internationaler Ausstrahlung verfolgen. Die Liebenden liefern der Glamourmaschine perfekte Bilder. Die Weltklasse-Karateka Sandra Sánchez und ihr Couch-Gatte Jesus del Moral inszenieren sich als ebenso trainingsemsig wie genussfähig.
mehr

Auch Blandine und Cole verbindet eine Folie à deux. Blandine hält Cole für einen unsterblichen nordhessischen Hochländer. Das in Lubbock, Texas, geborene Karategenie …
mehr
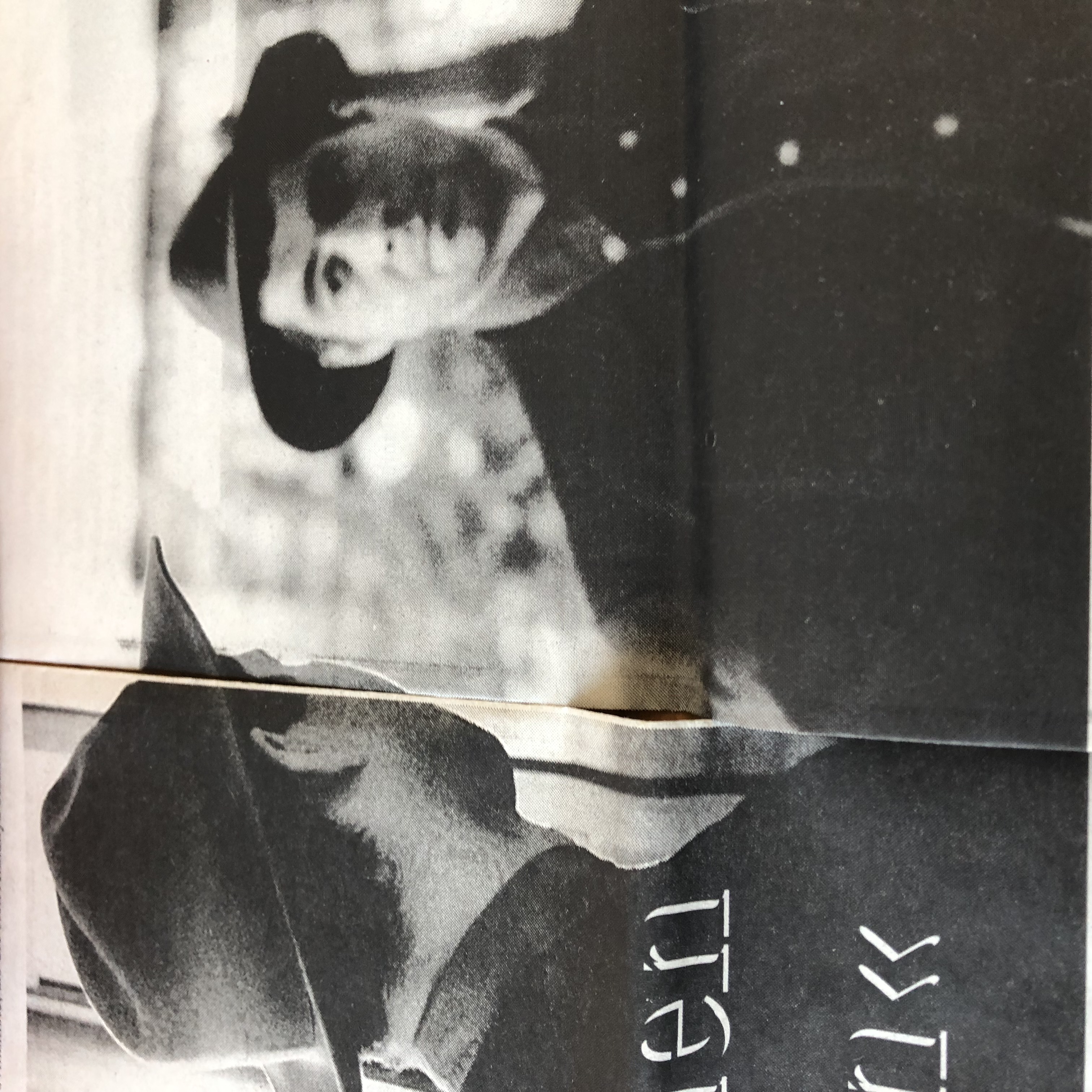
The art consists in being able to decompress your joints under pressure. If you can do so, you’re allowed to ask your opponent for more pressure. Give me as much pressure as you like; I turn your blow into my flow. © Jamal Tuschick
mehr

Toranaga erschien am kurhessischen Hof als Gesandter und Gartenbauexperte des Shogun Tokugawa Ieyasu (1543 – 1616). Als Unsterblicher überlebte Toranaga Reichseiniger Ieyasu um Jahrhunderte. Er war der Liebling einer Reihe von Fürsten. Er unterstützte schließlich noch unseren Freund Akira Kurosawa beim Abdrehen der „Sieben Samurai“, eine Variation des Märchens von den „Sechs Schwänen“ oder „Sieben Raben“.
mehr

Natürlich wussten unsere Genoss:innen*, dass „die Krise die historische Normalität des globalen Turbokapitalismus“ ist, und der Neoliberalismus, der damals noch anders hieß, „das Leben in eine Ware verwandelt“ (César Rendueles). Trotzdem durfte das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden.
mehr

Im Steckrübenwinter 1915 ging gar nichts mehr. Danach wurde es nicht viel besser. 1917 baumelte einmal ein Hering delinquent über dem Küchentisch im Haushalt meiner Urgroßeltern. Die Kinder durften an der Flosse saugen. Der Fisch kam schließlich im Ganzen jenem zugute, von dessen Arbeitskraft alles abhing. Mein Urgroßvater, der dicke Karl, war für den Einsatz an der Front zu alt. Er starb trotzdem vor Kriegsende.
mehr

1978 zog die Besatzung eines deutschen Frachters vierhundertfünfzig Vietnames:innen* aus dem Südchinesischen Meer. Die Landesflüchtlingsverwaltungen, bis dahin vor allem für Aussiedler:innen* zuständig, hatten ein neues Thema. Der Motor einer neuen Migrationsdebatte war Ernst Albrecht.
mehr

Vor langer Zeit bezeichnete Bodo Morshäuser Berlin als jene Stadt, in der die Dinge kurz vor ihrem Eintreffen schon einmal (wie) zur Probe stattfinden. Das beschreibt Kassel in den 1980er Jahren, soweit es um Karatefeminismus ging.
mehr

Was hatte Max Schmeling gesehen? Der Herausforderer hatte gesehen, dass Joe Louis die Deckung aufgab, sobald er einen kurzen rechten Haken setzte. Unbewusst entblößte der Gigant das Kinn. Der Rest ist Geschichte. Die Deckungslücke machte den Favoriten zum Scheinriesen. Der krasse Außenseiter, die Wetten standen zehn zu eins gegen Schmeling, schlug den Favoriten k.o.
mehr
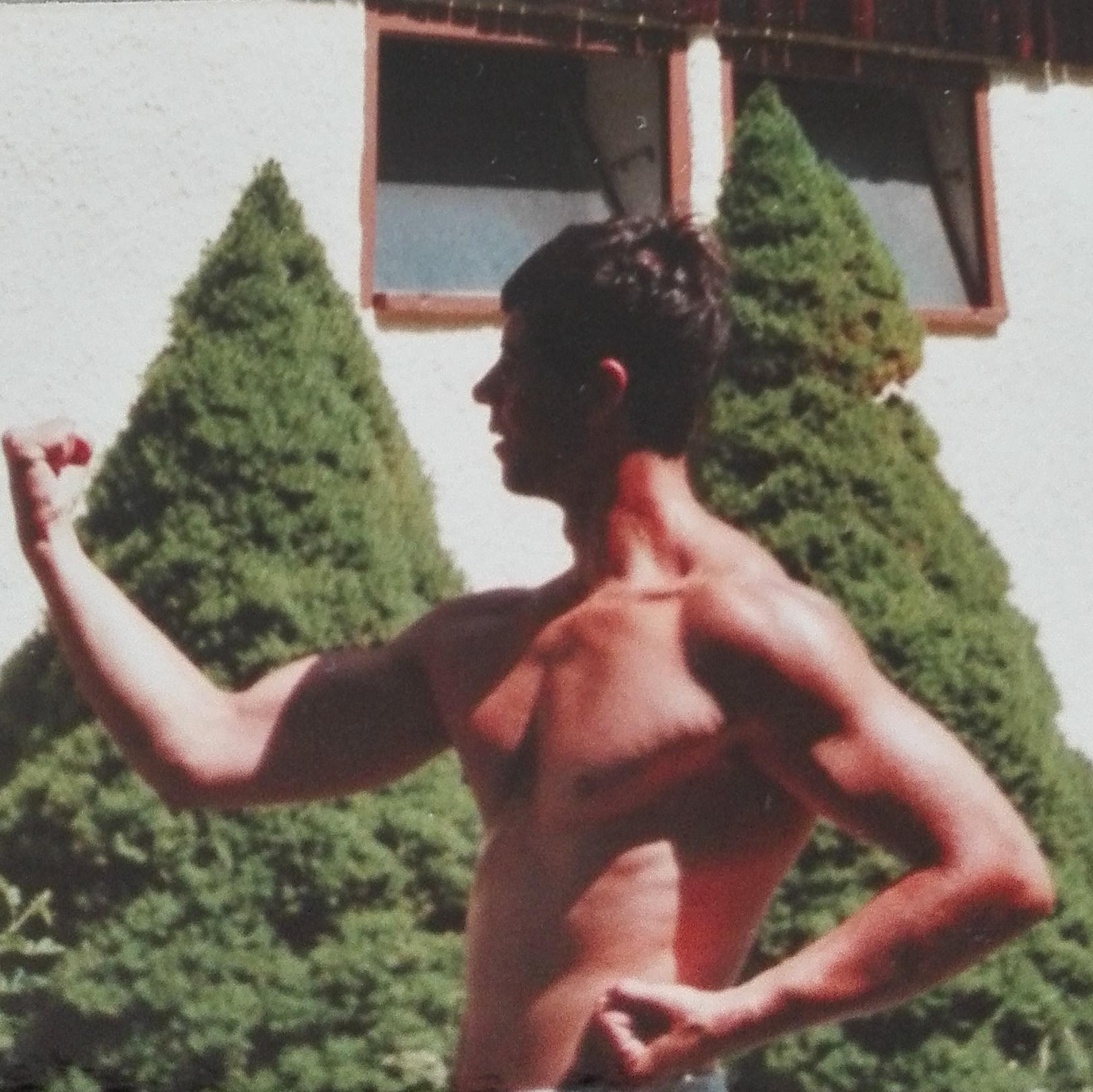
Karate ist von jeher kein Derivat herrschaftlicher Devisen. Vielmehr waren die ersten Karateka* mehrfach deklassierte (Stichwort: Intersektionalität) und von Mangelerscheinungen geschwächte Bäuerinnen* und Bauern*, die nicht das Recht hatten, sich konventionell zu verteidigen. Sie salzten den gesellschaftlichen Bodensatz mit ihrem Schweiß, und sie hatten die denkbar schwersten Feind:innen*: beritten, bewaffnet und befugt. Armiert an Leib und Seele. Staatlich und halbstaatlich autorisiert. Daraus ergibt sich die Einsicht, dass man keinen Status braucht, um zu kämpfen.
mehr
Gleich nach der französischen Revolution entdeckte frau/man, dass Ansichten, die vorher die herausragenden, bei Hof zugelassene Denkerin gemacht hatten, rasend volkstümlich geworden waren. Die Revolution habe den menschlichen Geist beschleunigt, meldet Karl August Varnhagen von Ense dem Freund Karl Georg Jacob. Antigone von Conrady reichte der Skepsis ihre Feder: „Die avancierte Kanaille treibt bei jedem Wetter Ideenkommerz, bläst sich auf und hat leichtes Spiel. Jeder Unfug vervielfältigt sich wie ein Blitz im Spiegelsaal.“
mehr
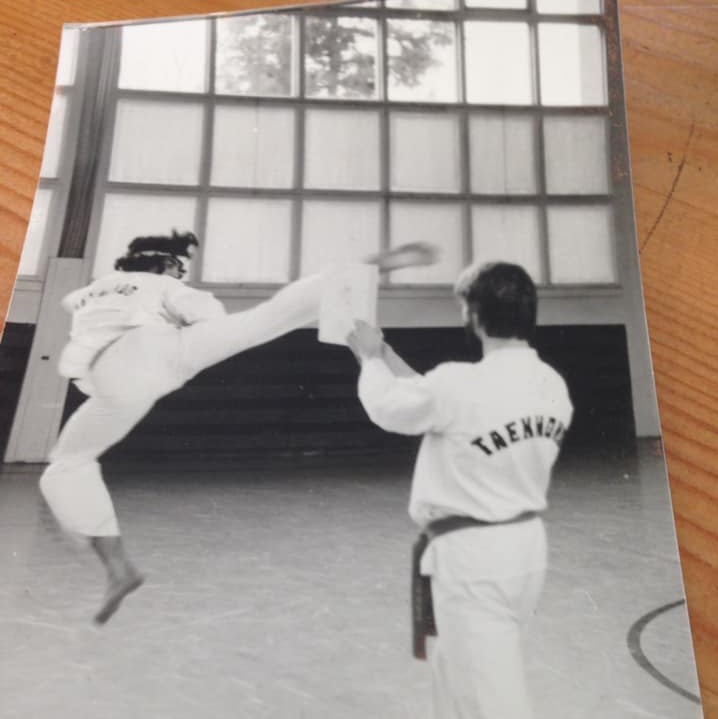
Ich kenne Spitzenjudoka, die von Zen noch nie gehört haben. Mein PSV-Karatelehrer ist ein beamteter Nussknacker, der Zackigkeit für den Schlüssel zum Verständnis seines „Sports“ hält. Der schillerndste Gong-fu-Praktizierende in Kassel qualifiziert sich in den Augen der Gemeinde, weil er sogar den Boxer:innen* überlegen ist.
mehr

In Marburg stieg Hannes Wader zu. Ihm räumte Madeleine Platz ein. Hannes Wader war unser Pete Seeger. Wir sangen „Bella Ciao“, bis wir in Frankfurt am Main einfuhren und uns die Lederjacken der Putzfraktion frenetisch einen großen Bahnhof bereiteten.
mehr
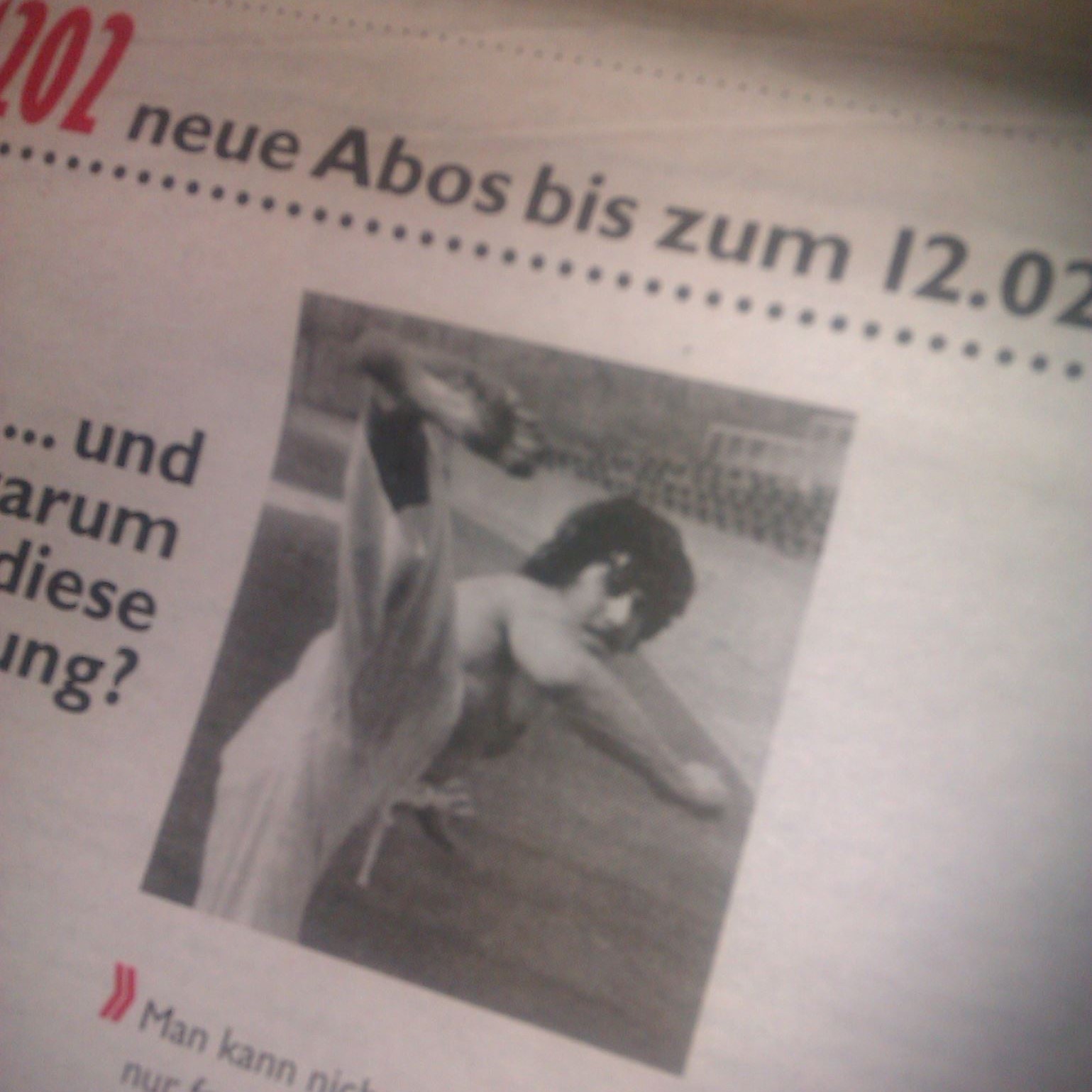
„Unser Zentralnervensystem ist eine gigantische energetische Bibliothek, in der alles hinterlegt ist, was sich je in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit ereignet hat.“ Thomas Hübl
mehr
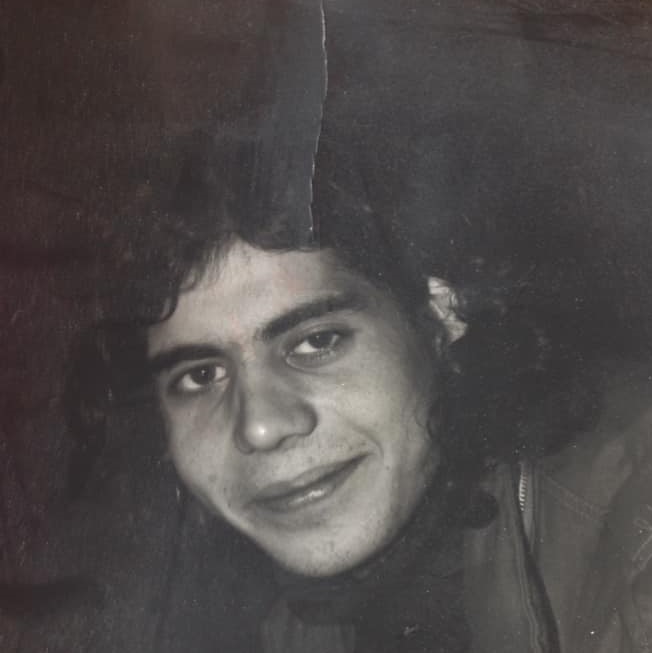
“To reach me, you must move to me. Your attack offers me an opportunity to intercept you.” Bruce Lee
mehr

The art consists in being able to decompress your joints under pressure. If you can do so, you’re allowed to ask your opponent for more pressure. Give me as much pressure as you like; I turn your blow into my flow. © Jamal Tuschick
mehr
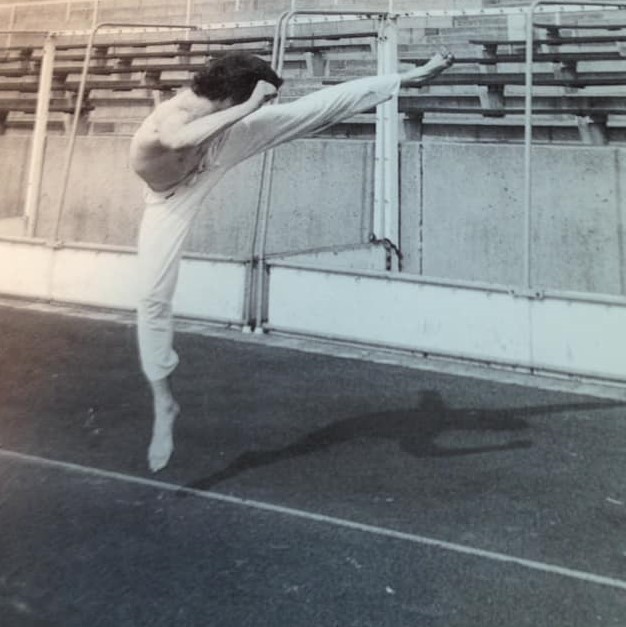
Ende der 1970er Jahre bot Sensei Maeve von Pechstein den ersten Theoriekurs an. Cole leitete das Repetitorium. Ich schrieb mit. Guten Morgen, mein Name ist Keno Teichmann.
mehr
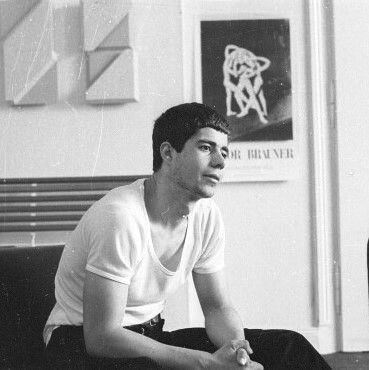
Das Freud’sche Es der Kampfkunst (© Jamal Tuschick): It’s not me who hits, it’s it, which hits you. (Poetisierter Bruce Lee)
mehr
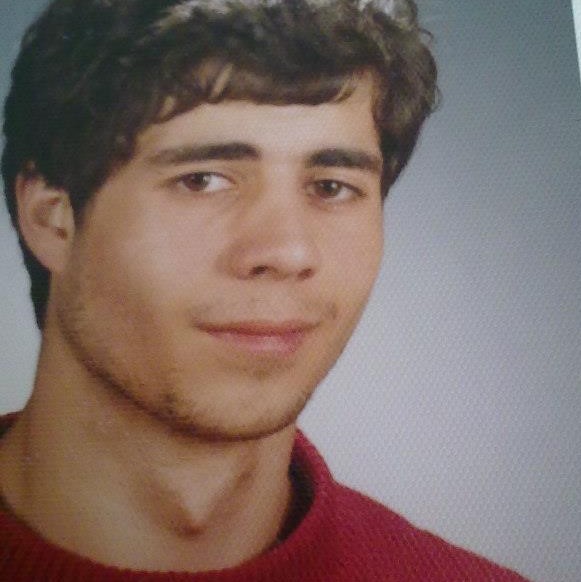
“Running water never grows stale. So you just have to keep on flowing.” Bruce Lee
mehr
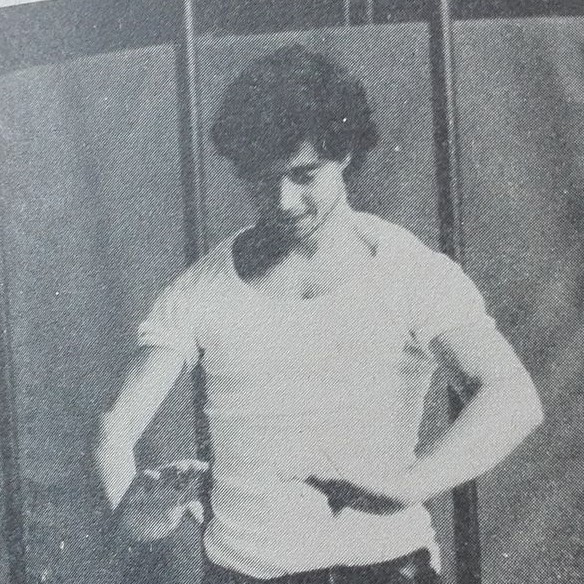
Turn effort into desire. © Jamal Tuschick
mehr
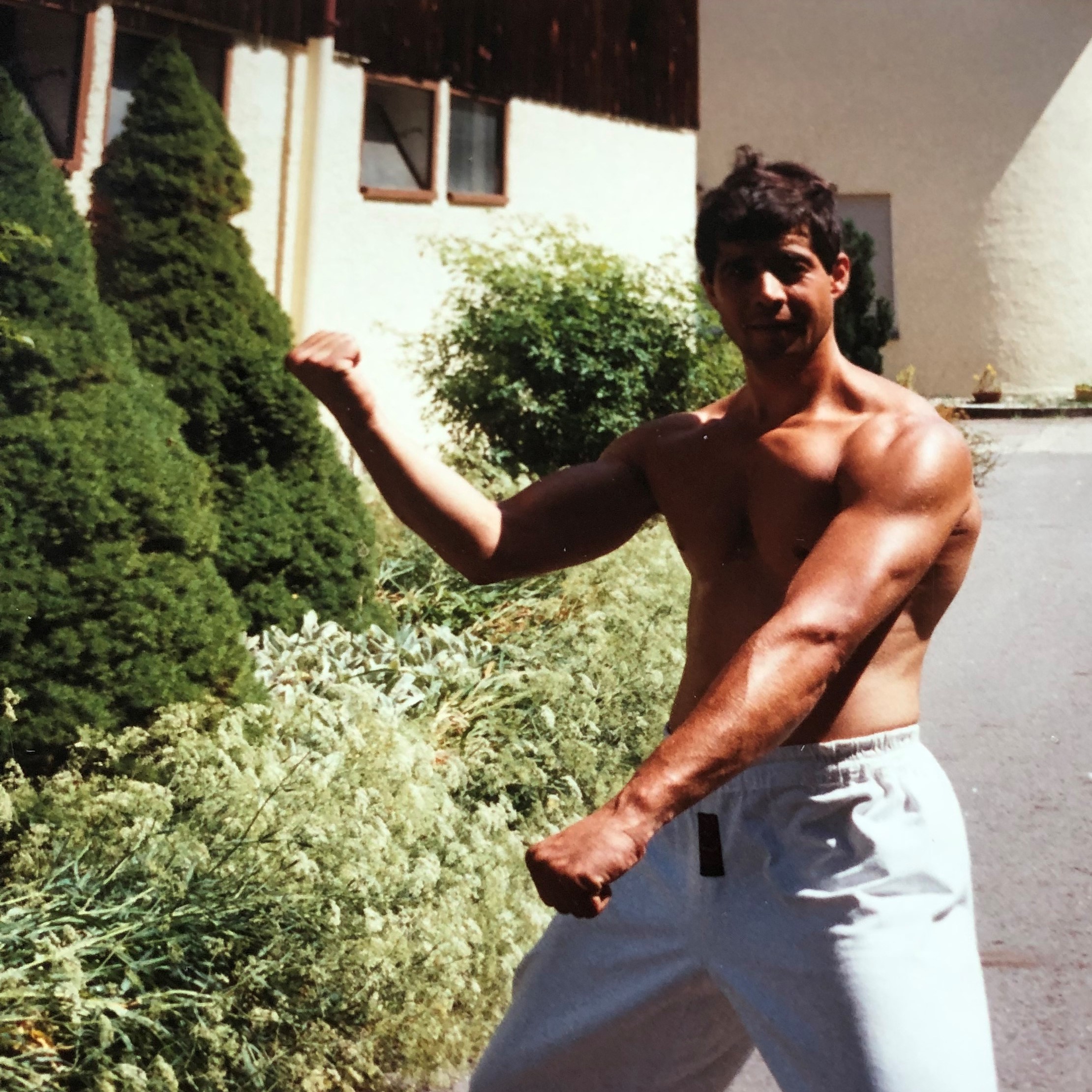
„In der heutigen Realität ist es so: Wenn du am Leben bist, gesund und nicht verletzt, dann muss es dir gut gehen.“ Vitali Klitschko
mehr
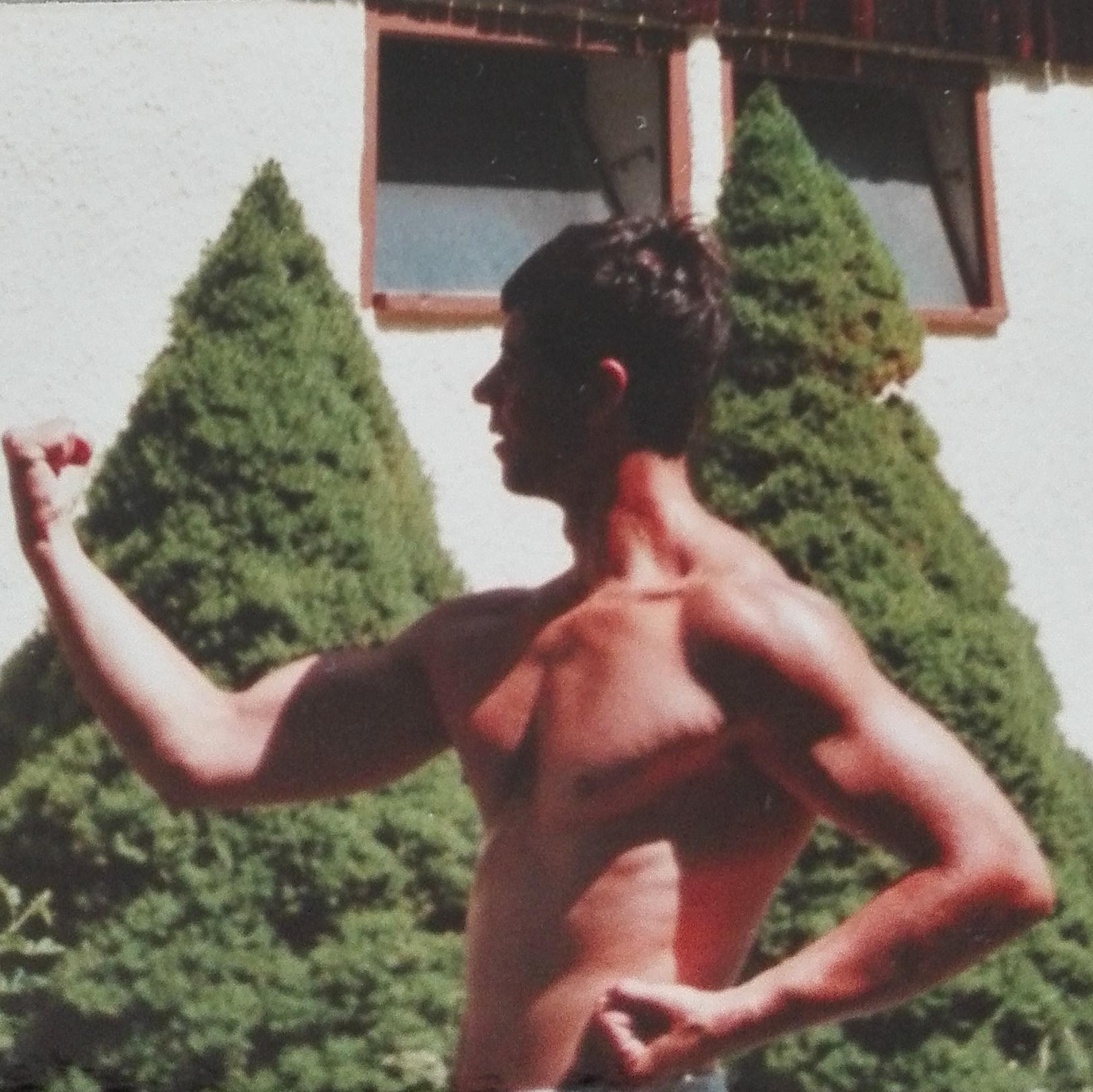
“A man who has attained mastery of an art reveals it in his every action.” Yamaguchi Gōgen
mehr

“Muscle Tension overrides your intention” (Sifu Nima King), but thoughts drive physiological processes.
mehr
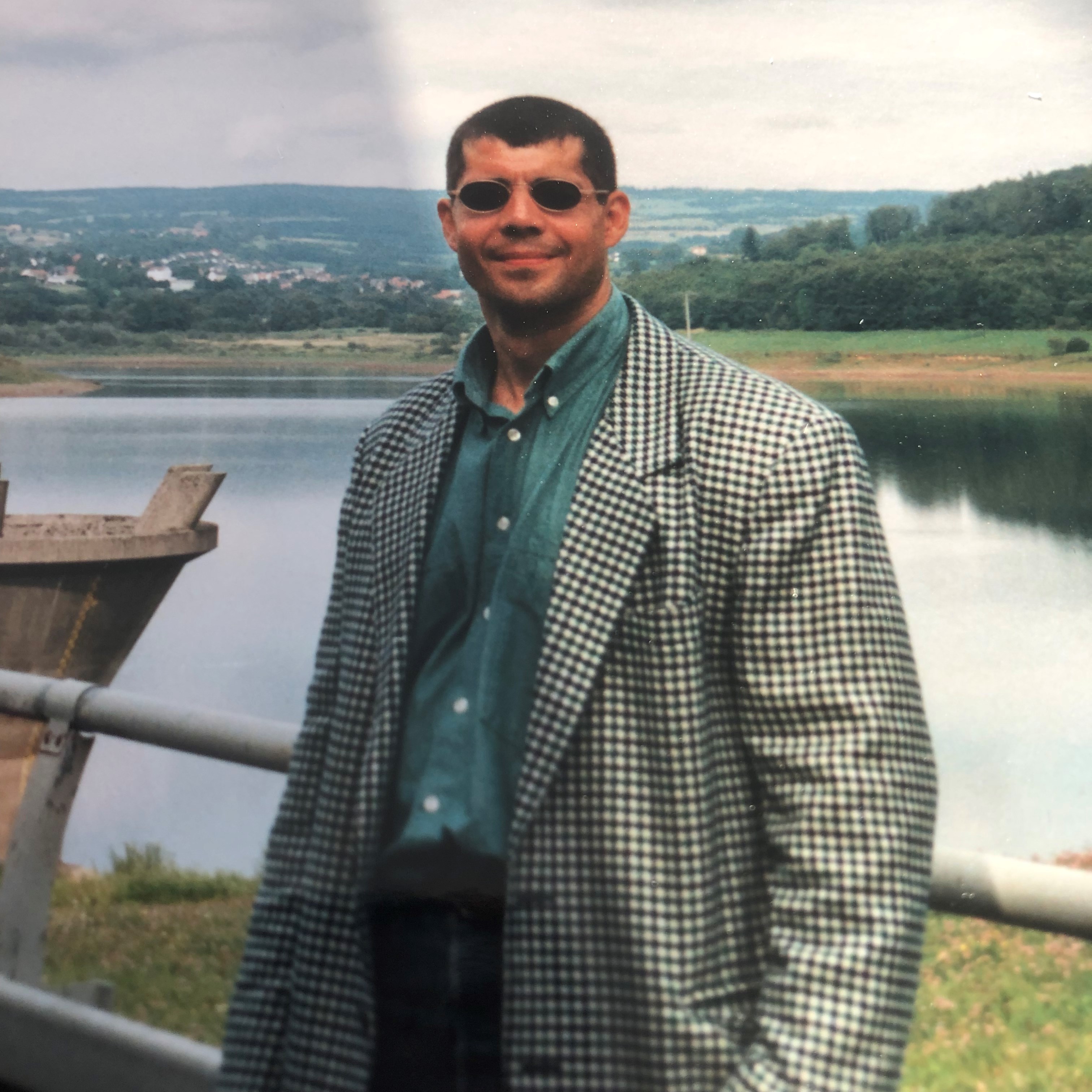
The art consists in being able to decompress your joints under pressure. © Jamal Tuschick
mehr

Christoph Martin Wieland gab sich große Mühe, seiner Gönnerin Herzogin Anna Amalia zu schmeicheln, indem er die guten Anlagen ihres Sohnes herausstrich. Er verwandte zwei Schlüsselbegriffe der Kampfkunst. So betonte er: „Ich sage mühelos, denn … das Schwierigste … (ist) bereits geleistet; und … richtige Prinzipien haben in seinem Herzen … Wurzeln geschlagen.“
mehr

Keno erkennt eine Ähnlichkeit zwischen Goethe, so wie ihn Angelica Kauffmann 1787 sah, und John Wayne. Madeleine entzückt die Koinzidenz. Ihre Wangen röten sich im Feuer der Begeisterung für die gute Beobachtung.
mehr

Hanif Kureishi zitiert André Gide und Pablo Picasso, um seiner Bewunderung für die Beatles einen Rahmen zu setzen. Die Beatles sind nicht bloß ins kulturelle Weltgedächtnis eingegangen, sondern, so wie Goethe und Shakespeare, zum Verbindungsstück zwischen Vergangenheit und Zukunft geworden, zu einer Matrix und eben auch zu einem Darm für den Brei aus dem Fleischwolf der Zeit.
mehr

Am Horizont zeichneten sich Kämpfe in Brokdorf und in Walldorf ab. Die Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses war ein SPD-Projekt in nächster Zukunft. In der Partei prallten die Gegensätze aufeinander. Die vermittelnden Instanzen erlagen dem Fieber der Empörung auf allen Seiten.
mehr
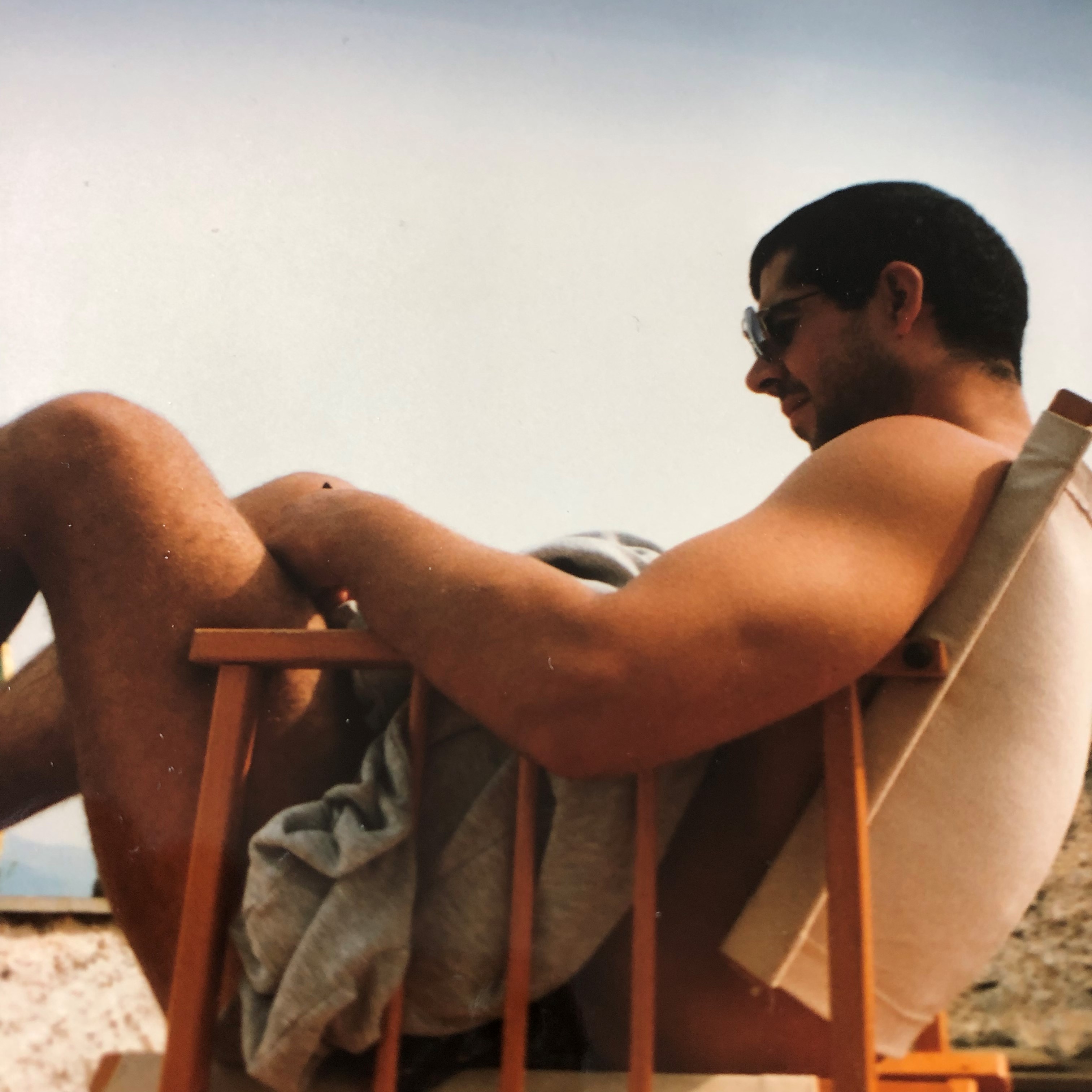
Unter der Woche reichte die Katzenwäsche. Wasser war mit Vorsicht zu genießen. Wasser tat der Haut nicht gut. Selbstgemachte Marmelade hatte einem besser zu schmecken als gekaufte. Die eingelagerten Äpfel und Kartoffeln schmeckten vor ihrer Neige im Frühjahr nach bitterer Not und ließen sich nur mit schwersten Ermahnungen und Hinweisen auf den Kohldampf der Kriegskinder herunterwürgen.
mehr

Alle hatten das Gefühl, sich zu wenig zu engagieren. Im Iran, in Afghanistan und in Nicaragua standen die Zeichen auf Revolution. Bei uns tat sich nichts. Nachmittags widmete sich Madeleine Wieland der Frau im Sozialismus. Der Veranstaltungstitel zitierte ungenau August Bebels theoretischen Vorstoß „Die Frau und der Sozialismus“. Außer Madeleine und mir hatte das Buch keiner gelesen.
mehr

In einer keineswegs besonders abwegigen Lesart brachte Maeve es fertig, ihr Mündel im zarten Alter von sieben Jahren in Asien ausgesetzt. Sechs Jahre verbrachte Cole als Novize und Kampfkunstlehrling im Dunstkreis verstiegener Asket:innen* und rauschaffiner Senseis und Sifus in Japan und China.
mehr

Der SPD-Philosoph Johannes Täufer war ein schräger Vogel mit gutem Riecher. Als Maeve von Pechstein Anfang der 1970er Jahre ihre Karateschule am Lokalbahnhof Wilhelmshöhe eröffnete, trat er da als Kurator einer philosophischen Reihe auf. Wie ein Schwarzwälder Kuckuck schoss der Schrat aus dem Uhrenhäuschen seines Wahnsinns und riss das geistige Rahmenprogramm an sich.
mehr

Es war die Zeit der ersten Ölkrise, der abflauenden Entspannungspolitik und von Verschärfungen auf dem Arbeitsmarkt, mit denen im Vollbeschäftigungsrausch niemand gerechnet hatte. Willy Brandt erreichte seine Grenzen als einziger Visionär der regierenden Klasse. Das Ansehen des vierten Bundeskanzlers schwand. Seine Gegner:innen*, die ihn Jahrzehnte als Vaterlandsverräter denunziert hatten, witterten Morgenluft. Die Wutbürger:innen* von damals nannten ihn „Asbach-Willy“, während die Molle zum Bauarbeiter gehörte wie die frische Luft, und Führungskräfte sich vormittags mit Sekt und Likör in Form brachten.
mehr

Coles Eltern waren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Eine Schwester seiner Mutter, unsere Großmeisterin Maeve von Pechstein, hatte Cole aufgenommen und ihn nach ihrem Ideal geformt. Von seinem siebten bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr durchlief er zwei kampfkünstlerische Exzellenzstationen in Asien; zuerst als Novize in einem Karatekloster auf Okinawa und dann als Schüler im ursprünglichen Shaolin Tempel (in Dengfeng). In dieser Spanne erzogen ihn durch Biernebel geisternde Expert:innen*. Monolithische Erscheinungen. Hermetische Existenzen im Orbit ihrer Zazen-Sucht.
mehr

Heimlich mochte Maeve den rauen Stil. Sie war in Japan durch drei Karateschulen gegangen. Sie konnte Straßenkarate, eine in Japan diskreditierte Kunst, die man mit Yakuza und mehr noch mit den Zainichi-Gemeinden assoziierte. Ōyama Masutatsu, geboren als Choi Hyung-yee, und Begründer des Kyokushin, gehörte genauso zur koreanischen Minderheit in Japan wie sein Meisterschüler Shokei Matsui aka Moon Jang-gyu.
mehr
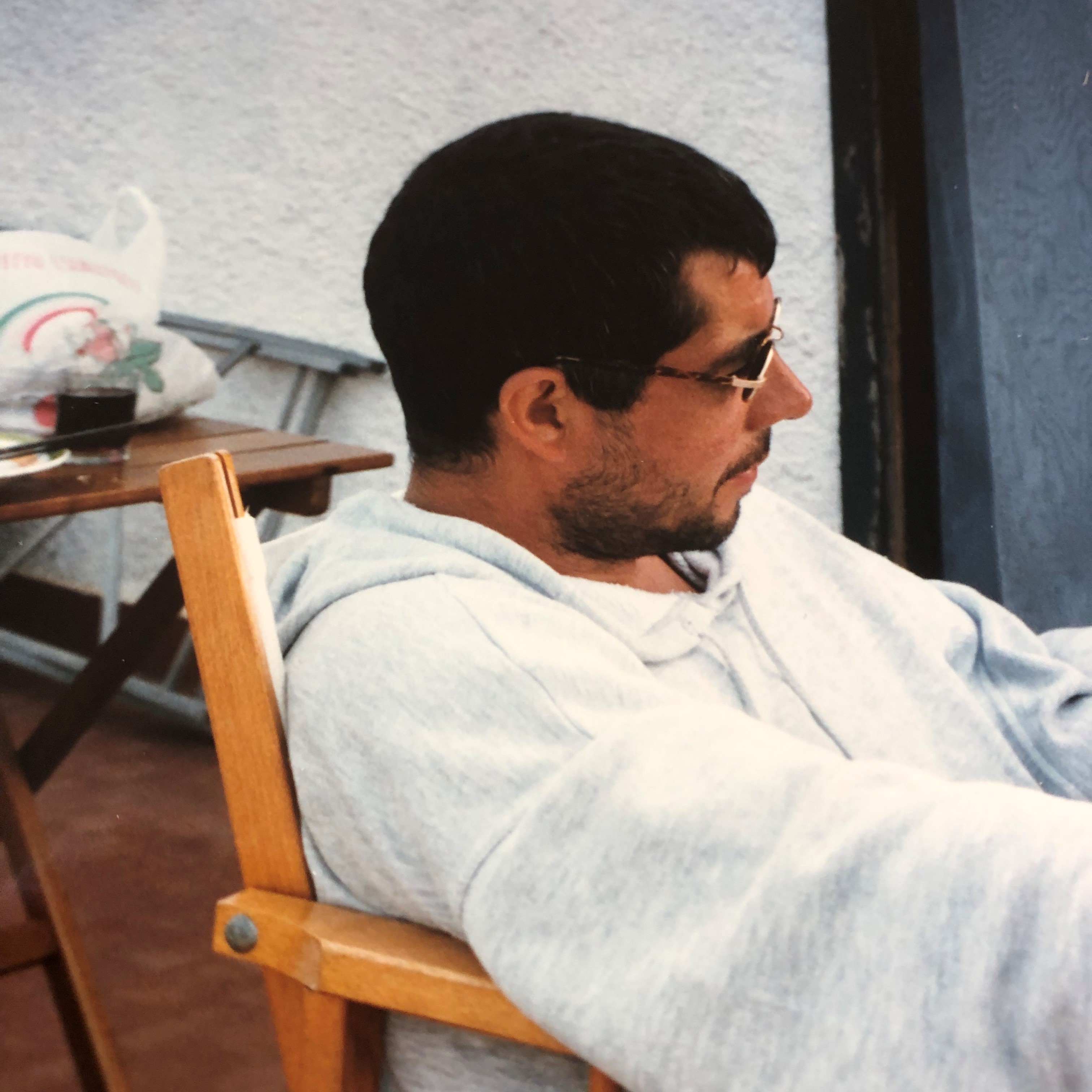
Heute kommen die Mitglieder* in einen gigantischen Spa voller wispernder Grotten, buddhistisch bebilderter Nischen, bizarr begrünter Brunnen, Wasserspender, Solen und Entspannungsoasen, die mit Zen-Binsen gepflastert sind. Leistungsträgerinnen leben in dem Wohlfühltempel wie in einem Internat. Überall haben sie Amina vor Augen.
mehr

„Ein Pessimist könnte die Geschichte von Paris zusammenfassen in einer ununterbrochenen Folge von Katastrophen: (von) Kriegen, Feuersbrünsten, Massakern, Hinrichtungen, Überschwemmungen, Epidemien, Hungersnöten.“ Ré Soupault
mehr

Cole beschwor das Wunder der Dehnung. Power comes from stretching, erklärte er. Nicht, dass das eine geglaubt hätte. Und doch war es wahr. Die Exzellenz stellte sich bei Amina wie von selbst ein. Übrigens hieß sie mit zweitem Namen Athirat nach einer ugaritischen Meeresgöttin. Auf einer Metaebene der Betrachtung stieg sie aus dem Whirlpool direkt aufs Siegerinnentreppchen.
mehr
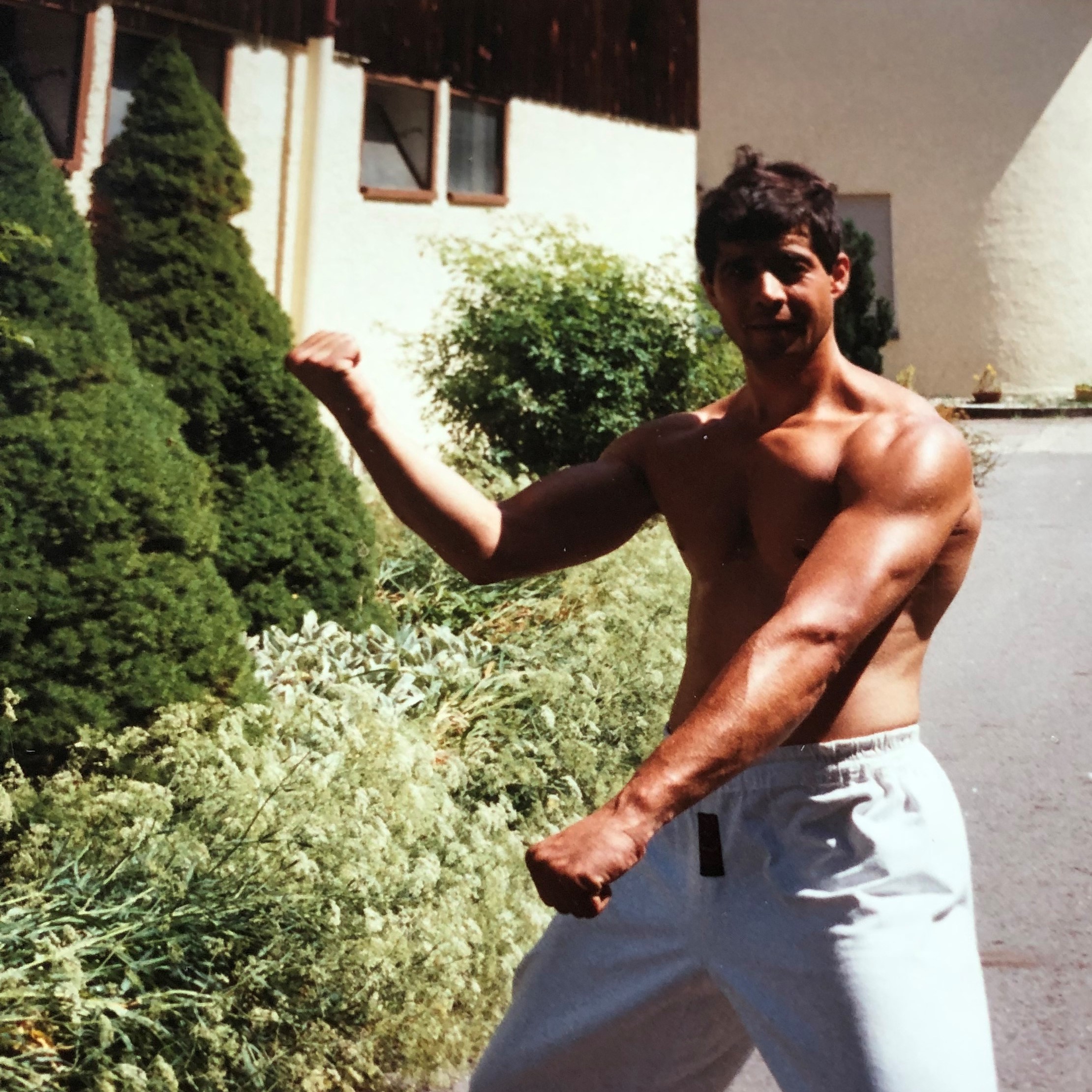
An der kroatischen Adria kündigt der Tramontana schönes Wetter an. Es erwacht ein Tag, da üben Serena Hideyoshi und Sensei Cole von Pechstein, der als Colt Winchester in Lubbock, Texas, zur Welt kam, im Schatten des Dinarischen Orogens und an einem dalmatischen Strand in einem geschlossenen Harmoniekreislauf eine Form, die in keinem Prüfungsprogramm der Karateschule Pechstein auftaucht.
mehr

Eine gehemmte und ungelenke Person, die auf die unglücklichste Weise zu reagieren geneigt ist, entdeckt mit bizarren Verzögerungen die Freuden der Leichtigkeit. Irgendwann unterbricht zum ersten Mal ein flockiger Move das alltägliche Trauerspiel. Serena weiß nicht, wie ihr geschieht. Das Glück durchschießt sie. Sie verweigert dem Gefühl die Zustimmung. Dann sieht sie ihren Trainer so lächeln wie noch nie in ihrer Gegenwart.
mehr
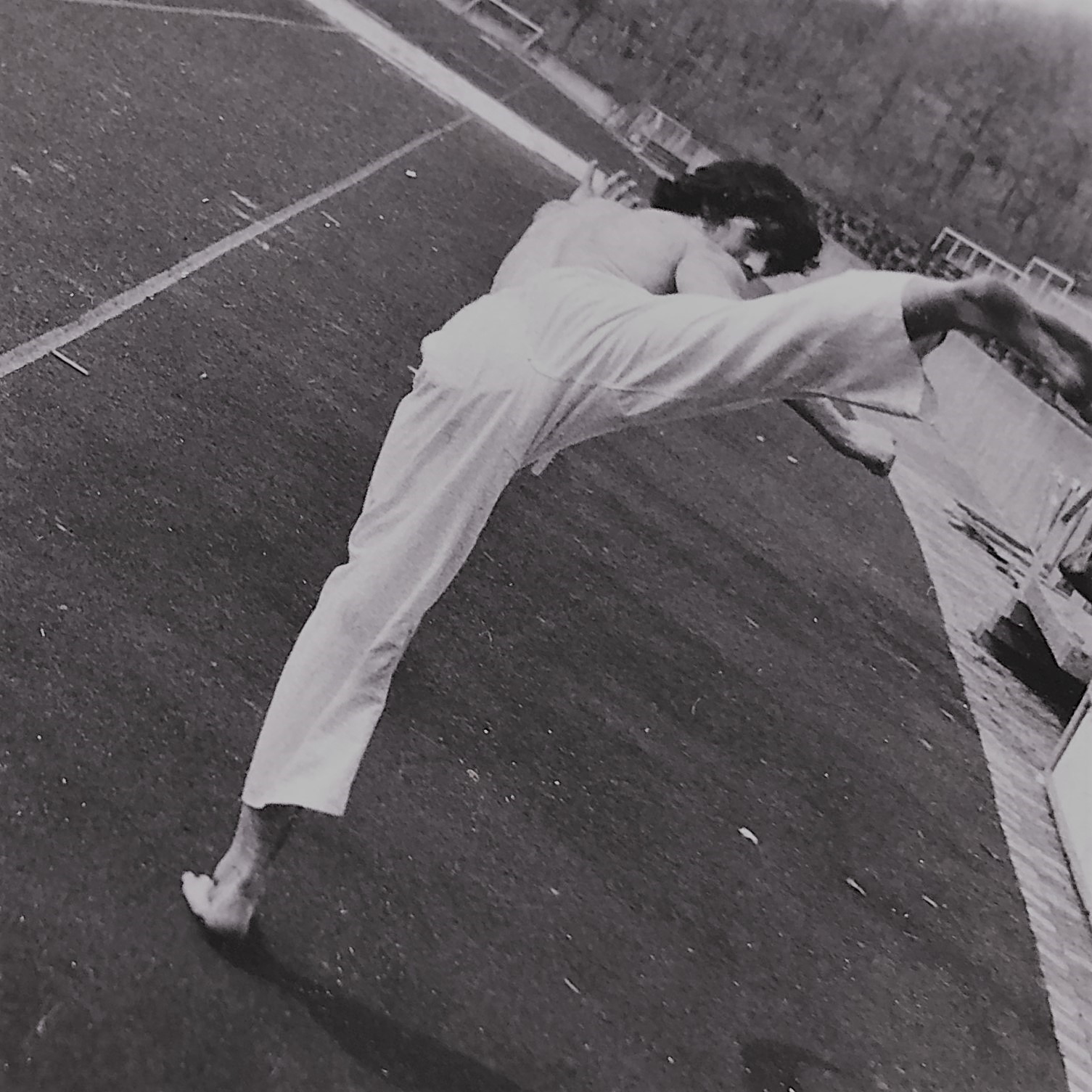
Maeve und Ruth folgen beinah von Geburt dem Budo Path von Miyagi Chōjun und Ōyama Masutatsu sowie Chiba Shūsakus Hokushin Ittō-ryū. Bald wird die Jüngere und Passioniertere ihr Wissen an uns Nordhess:innen* weitergeben. Ich schalte mich kurz ein, nur um mich vorzustellen. Mein Name ist Nikolaus Graf Speer zu Schauenburg.
mehr
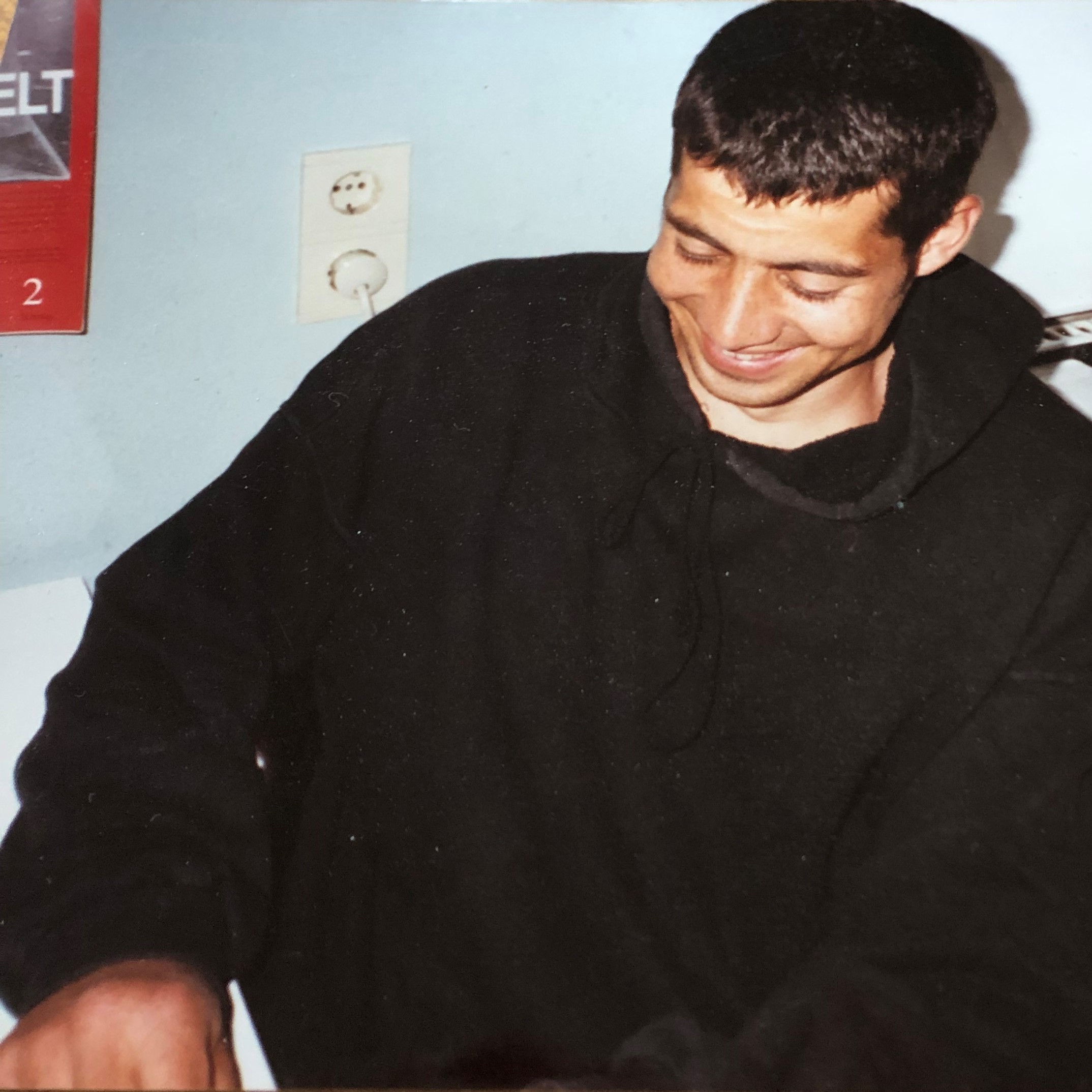
Kameko setzt in der Londoner City Karatedevisen um. Die Brokerin gehorcht Prinzipien, die ihr seit dem dritten Lebensjahr eingetrichtert werden. Das Publikum sieht eine erstklassig gekleidete, nach dem letzten Schrei frisierte Person. Kameko trägt ihren Hosenanzug wie einen Dschungel-Camouflage-Keikogi. Sie lebt in der Vorwärtsspannung. Sie bewegt sich auf dem Budo Path.
mehr

Niemand war je glücklicher als ein Bushi (Samurai). Er fürchtete und erwartete nichts. Sein Gleichmut war ein Kunstwerk. Sein Handwerk trieb er auf die Spitze wenigstens einer Kunst. Idealerweise folgte er zwei Wegen: dem Schwert- und dem Schreibweg.
mehr

Als sich Cole von Pechstein zum ersten Mal einen Schwarzen Gürtel umbindet, ist er sieben. In seinen Adern fließt Karateblut. Daran zweifelt keine Meisterin*, die Maeve von Pechstein konsultiert, um sich Gewissheit über die Prädestination ihres Großneffen zu verschaffen. Die Gründerin der Karateschule Pechstein schickt Cole in ein Karatekloster auf Okinawa. Seine Ausbildung setzt er in China fort. Mit dreizehn hat der in Lubbock, Texas, geborene, in Kassel herangewachsene Cole ...
mehr

Amina kämpft gern. Das findet sie befremdlich und würde es nie zugeben; ungeachtet eines Mangels an Anstößigkeit. Eine Karateka, die nicht kämpfen will, kann sich überhaupt nicht entwickeln. Nur wer weiß, wie es sich anfühlt, k.o. zu gehen, begreift den Nutzen der Techniken für die Selbstverteidigung.
mehr

„Du kannst alles haben und brauchst dafür nur dich selbst. Du musst dir einen Körper schaffen, der nie verliert.“ Das sagt Koto Shōgiku. Körper bedeutet in diesem Kontext nicht ausschließlich, aber eben auch etwas Metaphorisches. Das Wesen des Sumō umkreist einen zentralen Punkt: das Gleichgewicht. Alles dreht sich darum, das eigene Gleichgewicht zu wahren, und das Gegner:innen*gleichgewicht zu stören.
mehr
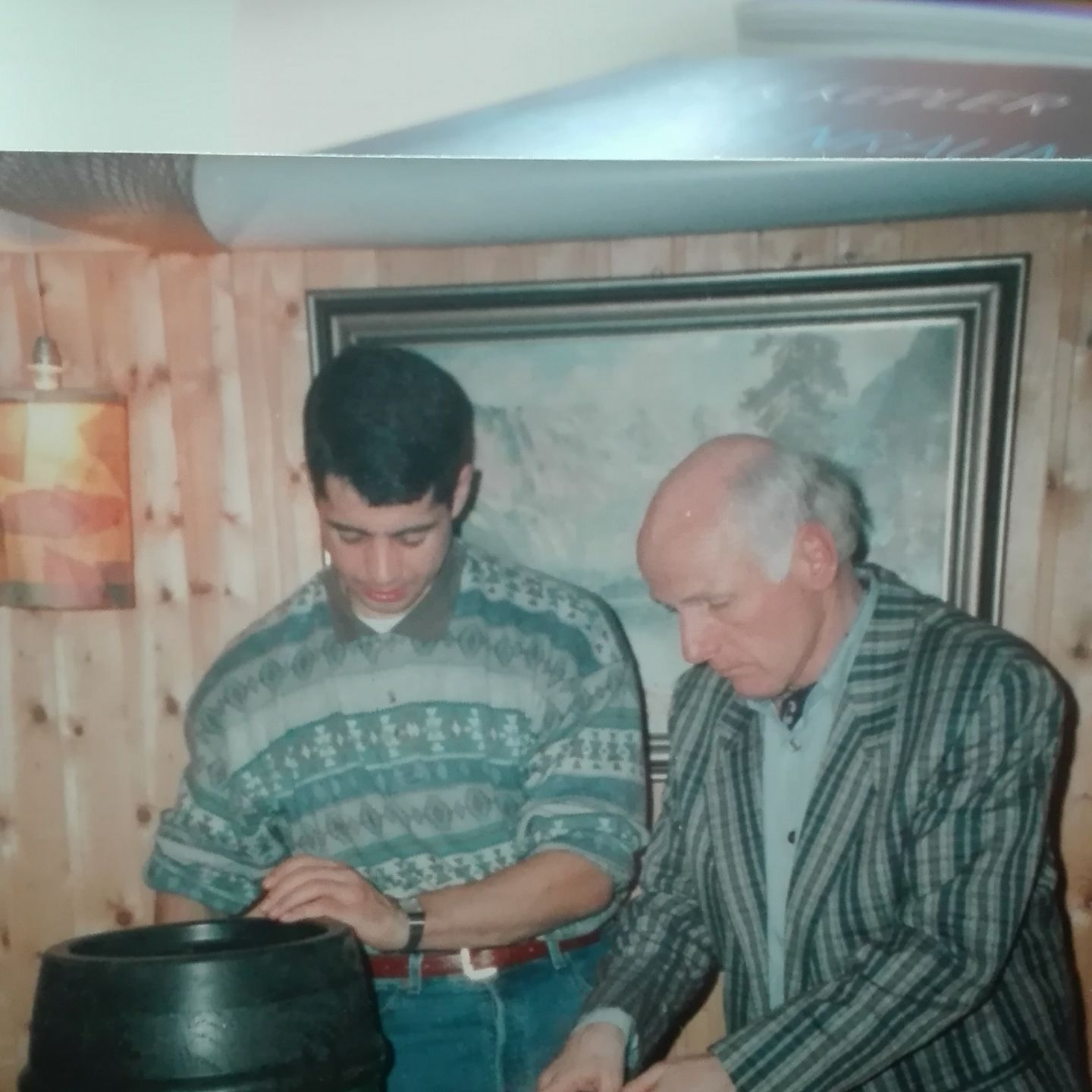
Aminas Techniken kommen gestochen scharf. Schneller als andere setzt sie flankenstrategische Ansagen um. In der Meditation zeigt sie Anzeichen echter, das heißt lustvoller Entspannung. Wie alle, die auf den Trichter gekommen sind, kriegt sie nicht genug von einer Praxis, die den meisten vollständig verschlossen bleibt. „Wir wissen heute, dass das Atmen nicht nur ein Verbrennungsvorgang ist.“ Antoine Laurent de Lavoisier
mehr
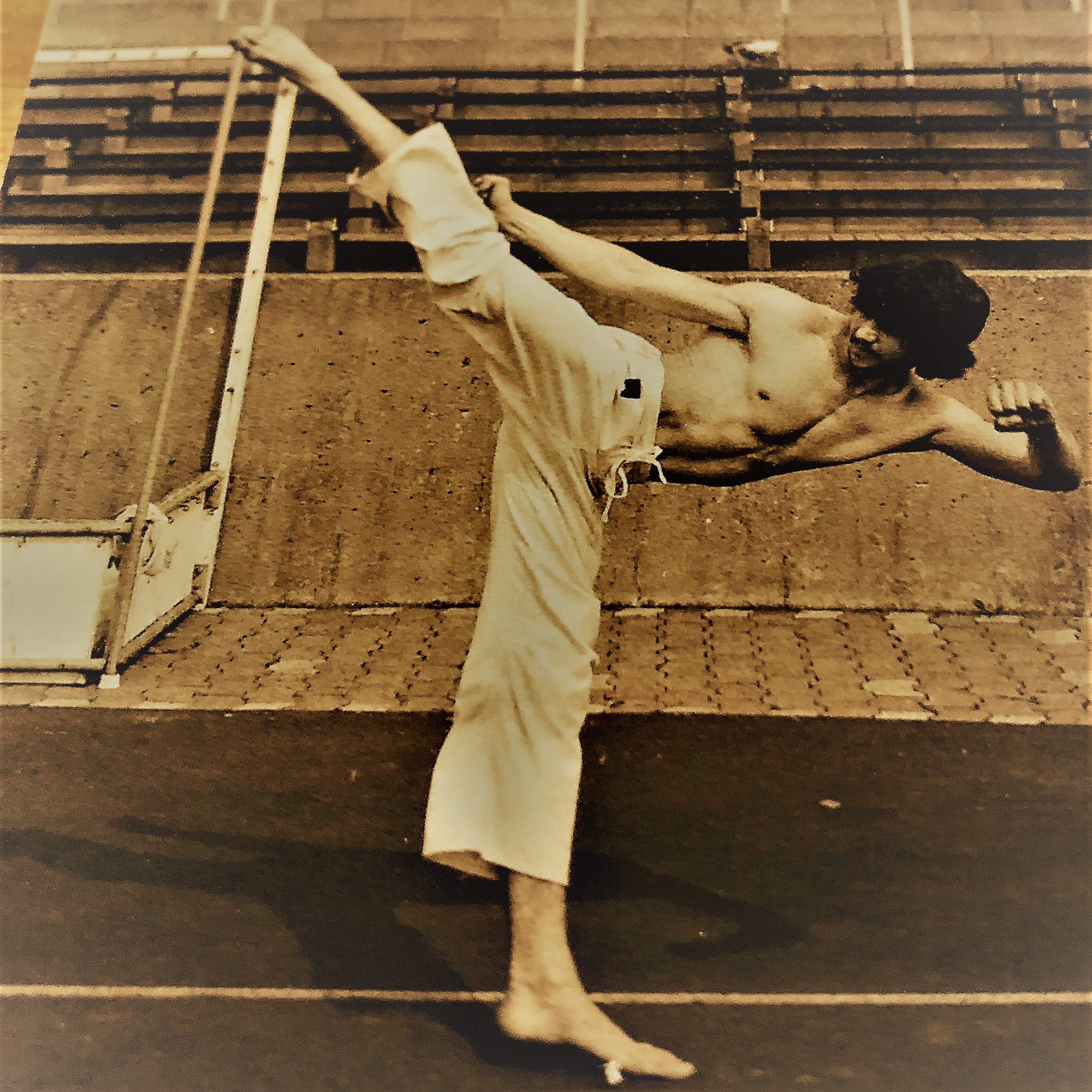
Wir bauen mit Energie Strukturen auf, die uns schützen, sagt der britische Physiker Jim Al-Khalili. Er erklärt, wie „Energie und Information die Welt im Innersten zusammenhält“.
Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Jeder weiß das, der in Coles Dunstkreis die Challenge angenommen hat. Unser Ziel: die erste Kasseler Karatevollkontaktmeisterin. Anwärterinnen auf den Titel sind Anzu, Lien, Minato, Puma, Taki, Tani, Sakura, Yoshi, und Umi. Sie bilden den Leistungs-A-Kader. Alle trainieren täglich zwei Mal.
mehr

„Früher haben Karate Meister nichts anderes als Karate gemacht ... Jetzt muss ein Mann arbeiten, Geld für seinen Lebensunterhalt verdienen, fernsehen, eine Familie haben. Natürlich kann er nicht die gleichen Höhen erreichen ... “ Tetsuji Murakami
mehr

„Die Schilderung, die Sie mir von Frankreich geben, ist mit sehr schönen Farben gemalt. Aber Sie können mir sagen, was Sie wollen, ein Heer, das drei Jahre nacheinander überall geschlagen wird, wo es sich zeigt, ist sicherlich keine Schar von Cäsaren und Alexandern.“ Friedrich an Voltaire 1743
mehr
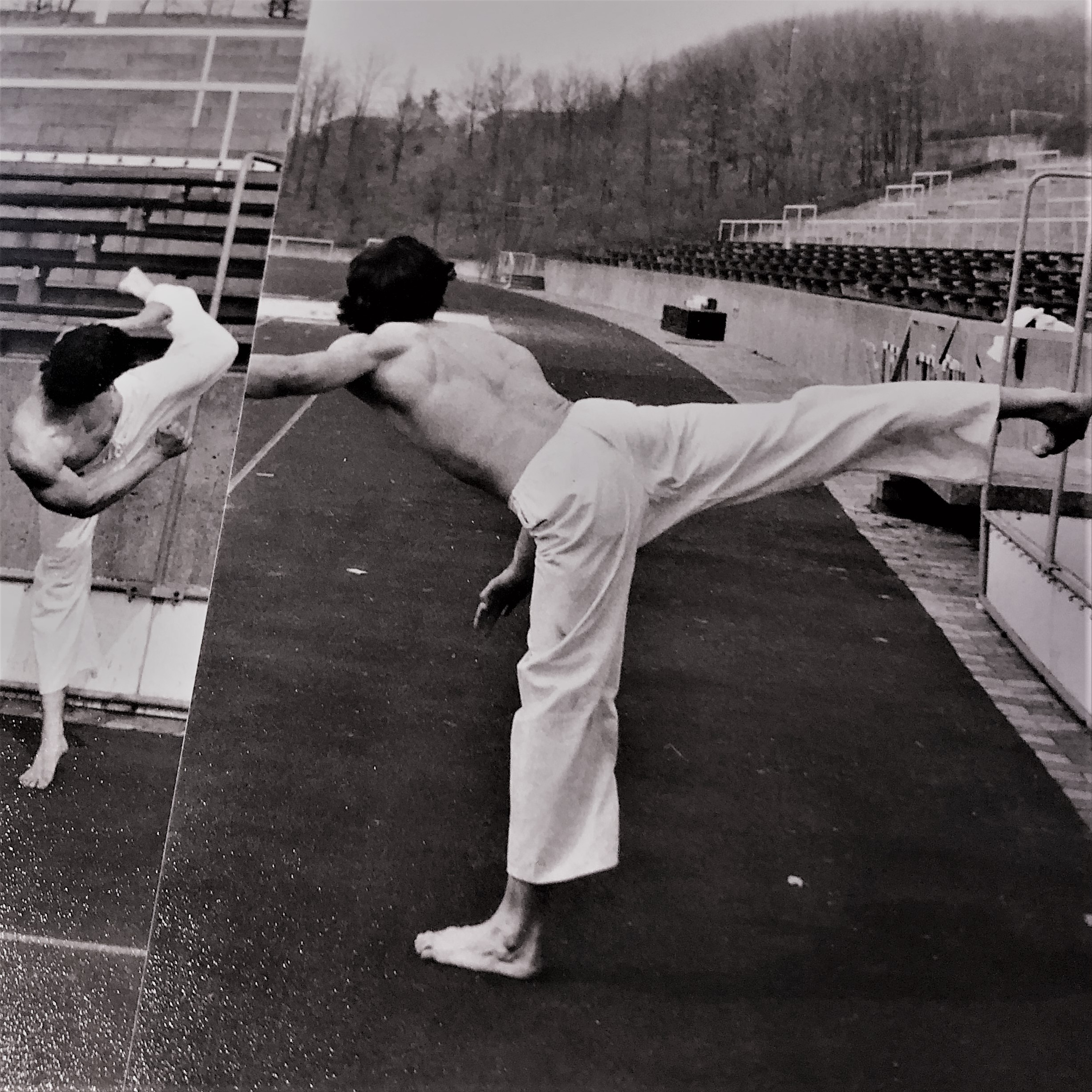
Georg Büchner erkannte Bedingungen, „die nur von Marionetten noch zu ertragen sind“. Nanami Mulligan behauptete, dass das klassische Theater durch und durch naturalistisch gewesen - und mit Heinrich von Kleist gar nicht zurande gekommen sei.
mehr
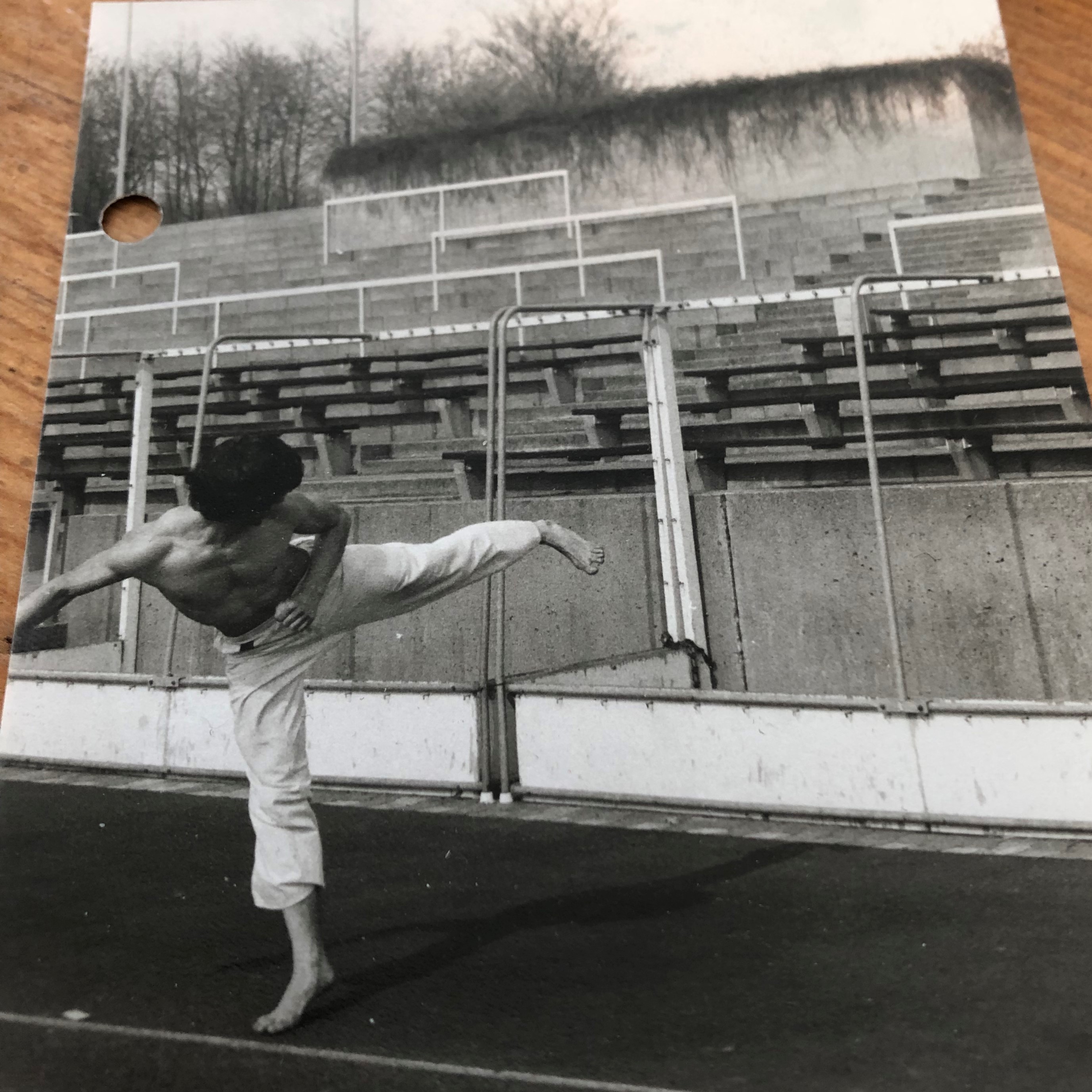
Yip Man tauchte aus den Vermutungen und Legenden weltweiter Eastern-Begeisterung als Lehrer von Bruce Lee auf. Das war in den 1970er Jahren, damals trafen sich ‚Gastarbeiter‘ sonntags auf dem Bahnhof, dem Ort ihrer Ankunft in Deutschland. In den Bahnhofskinos lief Strumpfbanderotik und Gong-fu im Wechsel. „Emmanuelle“ und „Seven Steps of Kung Fu“; Laura Antonelli in „Malizia“ und Alan Chui Chung-San in „7 Grandmasters“.
mehr

Nicht die Werke der Schwestern Brontë oder eine Schwärmerei für Jane Austen hatten Nanami eine romaneske Existenz nahegelegt. Vielmehr gab Henry James ihren Sehnsüchten passende Betonungen. Nanami wollte Philologin werden und dem Andenken wenig populärer Schriftstellerinnen* dienen.
mehr

Freiwillige Isolation ist eine japanische Spezialität. Die Abschließung Japans vollzog sich in einer Serie außenpolitischer Ausschlüsse. Seit den 1580er Jahren schränkte das Tokugawa-Shōgunat die Verkehrsfreiheit der als Südbarbaren geschmähten Portugies:innen* und Spanier:innen* ein. 1635 verloren alle Japaner:innen* ihre Reisefreiheit. Von 1639 bis 1853 blieb frau/man unter sich und behielt solange die mittelalterlichen Standards bei.
mehr

In Rekordzeit fand ein mittelalterlicher Militärstaat Anschluss an die globale Zukunft. Das Tempo war Staatsräson. Die Industrialisierung brachte die Mittel für eine Aufrüstung. Die Kriegsräte frohlockten: Wenn das nächste Mal ein amerikanisches Kanonenboot vorbeischwimmt, schießen wir es mit Gaijin-Knowhow zu Klump.
mehr
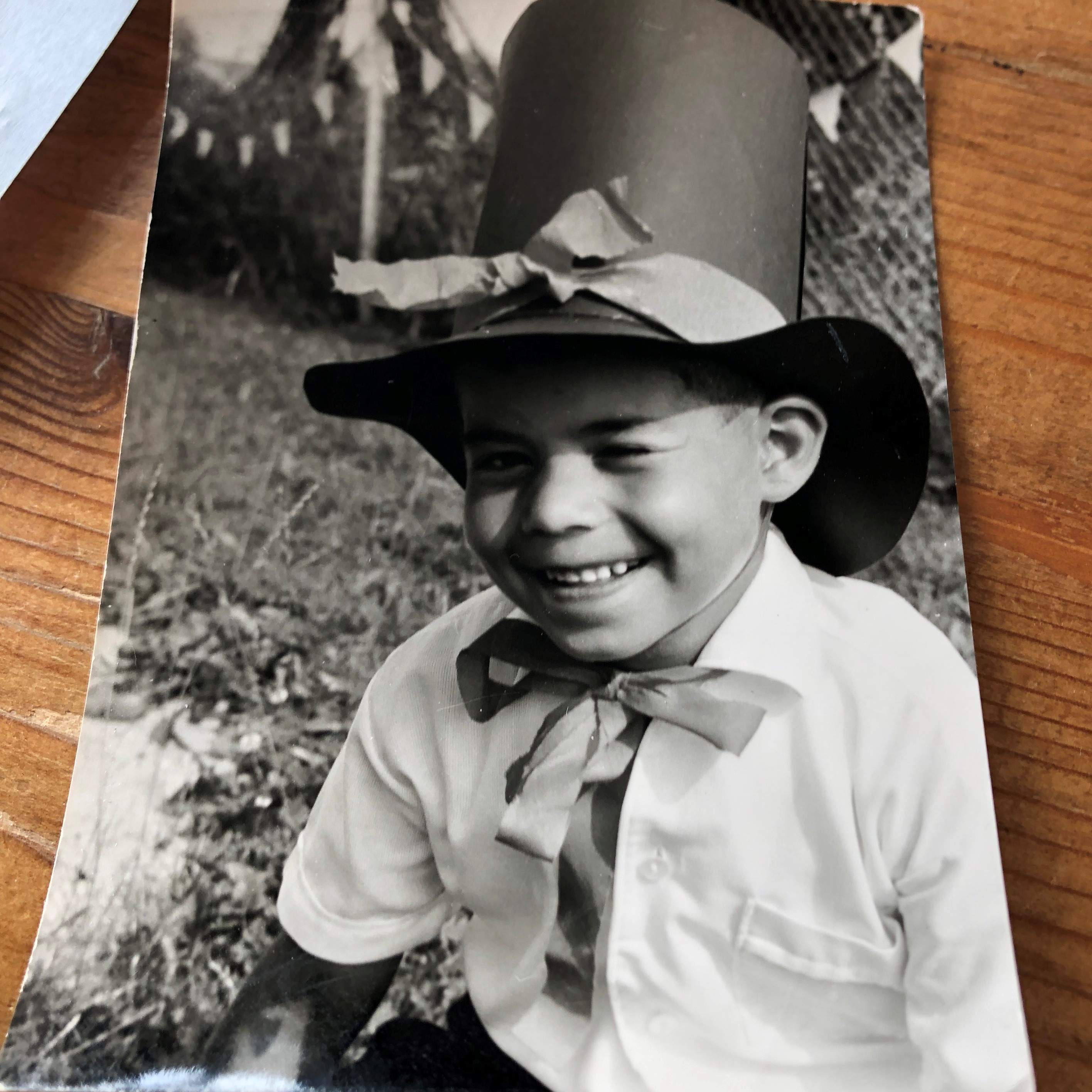
Anzu erweitert ihr Repertoire in Lehrgängen. Sie ist die Frau in der Highend Version eines Trainingsanzugs, mit dem skeptischen Blick, der gerümpften Nase und hochgezogenen Braue, der wahnsinnigen Umhängetasche und ewigen Wasserflasche, die ihre Wochenenden in der vollendeten Tristesse von Vorstadtturnhallen verbringt, um bei Welt- und Großmeistern oder israelischen Nahkampfexperten totsichere Messerabwehrtechniken zu lernen.
mehr
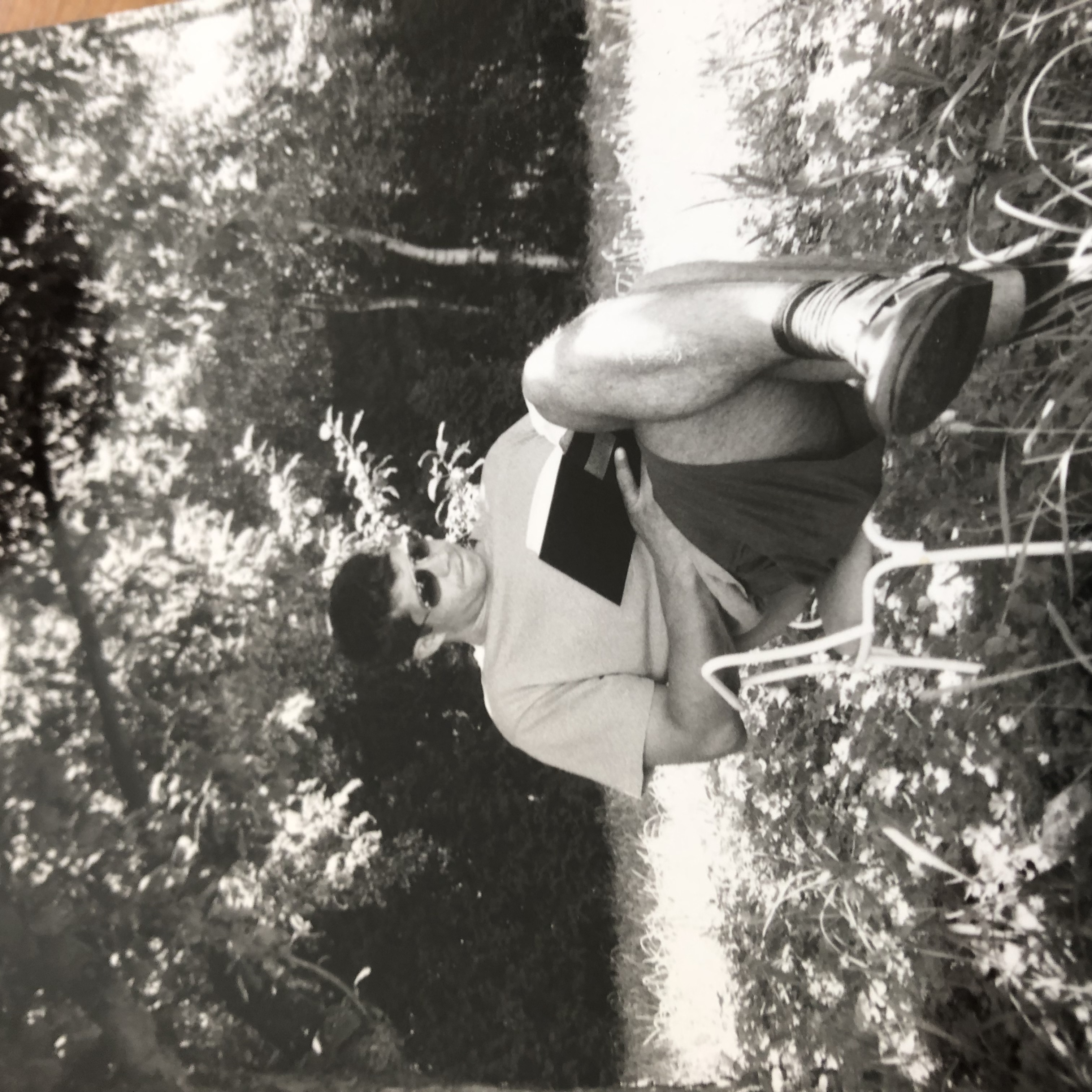
Ich nehme Nagai Shihan als Karate-Controller wahr. Nach Jahren des Trainings in einer städtischen Ebene ziehen Danträger:innen* zu ihm in ein Tal des Okuchichibu-Gebirges. Für die Dauer eines Jahres unterwerfen sie sich (in einem Sabbatical) seinem Regime. Die meisten nehmen in ihren Berufen Spitzenpositionen ein und werden von ihren Betrieben zu der Schulung angehalten. Der bedingungslose Einsatz ist für sie selbstverständlich.
mehr

Auf mich wirkt Nagai Shihan wie ein Karatebeamter. Wie eine einfallslose Vorstadtpersönlichkeit. Ich kann bei dem Mann keinen Funken Interesse an uns entdecken. Eine halbe Stunde später überrascht mich Nagai Shihan mit einem superlauschigen Zen-Setting und einem Shiatsu-Wunder. Er möbelt mich auf. Meine Wahrnehmung dreht sich total. Ich beglückwünsche mich zu meiner Meisterwahl.
mehr

Im Dschungel der Städte hat Karate seine große Zeit noch vor sich.
mehr
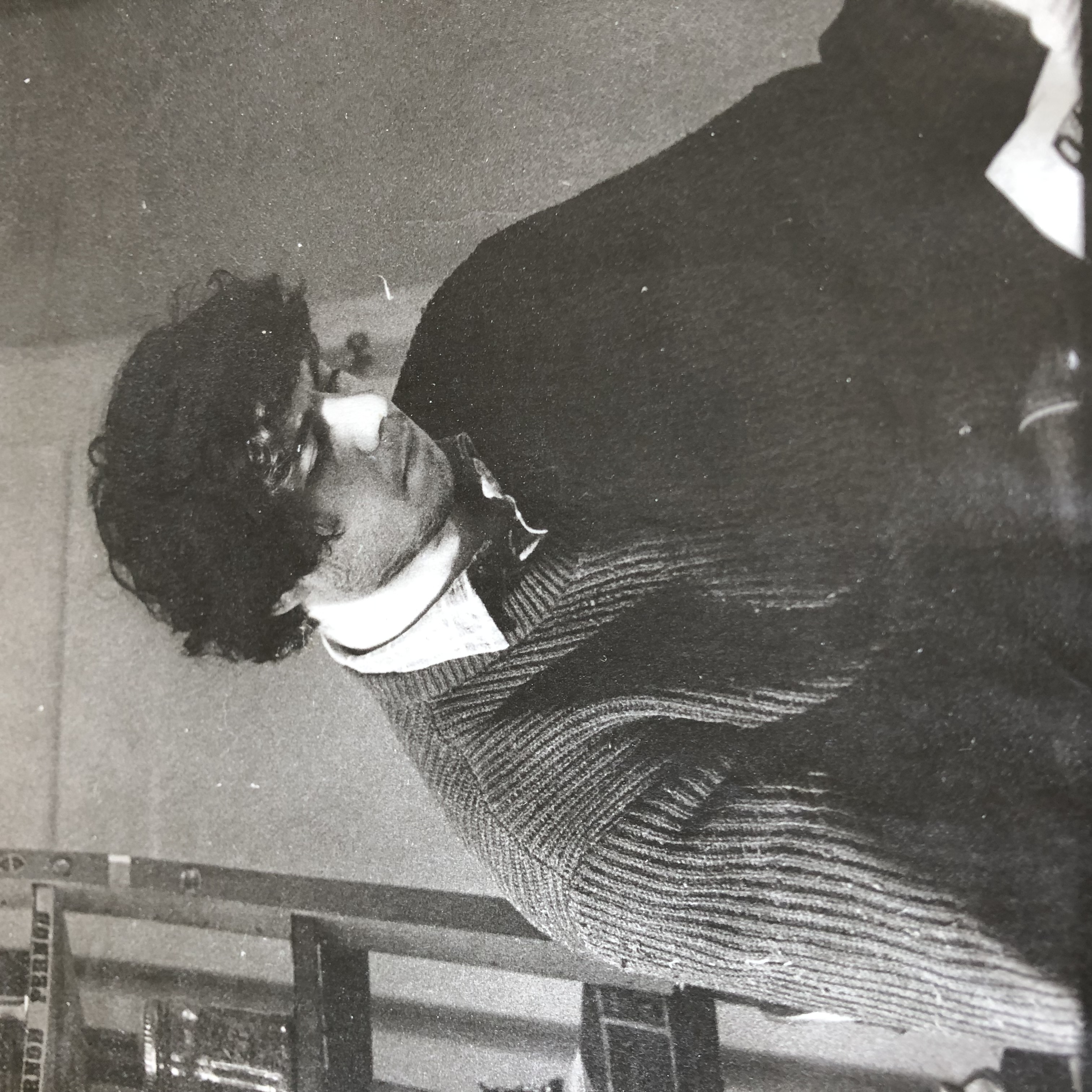
Für Lien existiert Schönheit nur in Landschaften, Körpern und Kampfkünsten. Literatur, Tanz, Theater, Musik und Malerei sagen ihr (noch) nichts. Das macht sie zum Lieblingssorgenkind der Dōjō-Chefin und Wilhelmshöher Mittelpunktpersönlichkeit Maeve von Pechstein. Maeve kommt dem Gründer des Augustiner-Chorherrenstift Weißenstein nach.
mehr
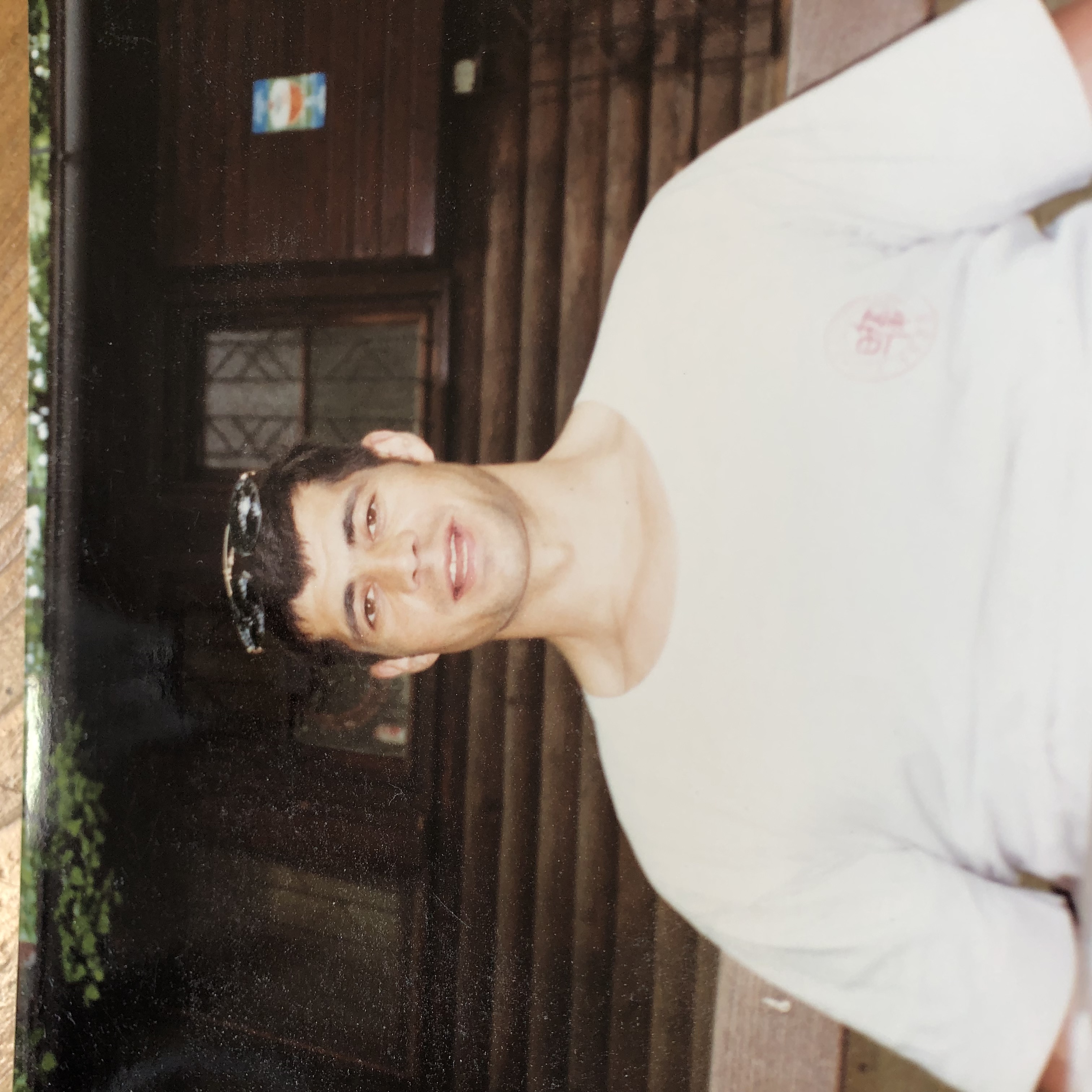
Leute, die sich in der Welt auskennen, bezeichnen Stadtläufe als Freerunning. Unter sich nennen Lien und Cole ihr Programm Geesink-Endurance-Runs. Sie ehren so Anton Geesink. Er war 1961 der erste nicht-japanische Judo-Weltmeister. Er verdankt seinen überwältigenden Erfolg die Ausweitung des traditionellen Judotrainings.
mehr

Adorno zieht ein demoliertes Weltvertrauen aus dem Klang. Sein Verhältnis zu Bloch bestimmt die Namensaura nicht zuletzt. „Dunkel wie ein Tor, gedämpft dröhnend wie ein Posaunenstoß“ - das gestattet sich Adorno, um eine Zuneigung deutlich zu machen. Er rückt „Das Prinzip Hoffnung“, das noch in meiner Generation wie ein Aphrodisiakum wirken sollte, in die Nähe jener Versprechen, die ihm „schweinsledern“ gebundene „mittelalterliche Bücher“ machten, solange er als Kind das magische Nostradamuswissen in verstaubten Wohnungswinkeln vermutete.
mehr

Luana sah Lien, ein als Hindernis von der gegen sie anrennenden Menge kaum wahrgenommener Körper; in einem Strom, der sich auf den letzten Metern vor dem Club verjüngte, bis er zwischen Autos und luftschöpfenden Gästen versickerte; dass jeder vor seinem Eintritt durch eine Bewertungsgasse defilierte.
mehr
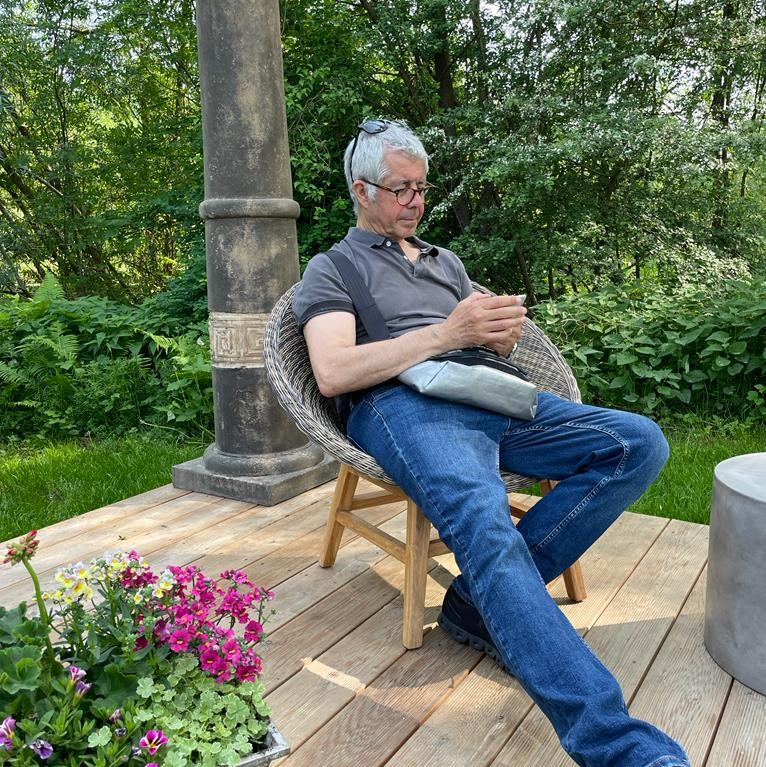
Am 6. August 1945 fällt Little Boy auf Hiroshima. Siebzigtausend Menschen sterben in der Unmittelbarkeit des Detonationsgeschehens. Der Atomblitz sorgt für bizarre Formate. Seine unfassbare Helligkeit, das apokalyptische Licht, die grausame Illumination stiftet einen neuen Begriff: Pikadon. Bald wird dem Wort für eine neue Erfahrung ein neues Wort für eine alte Erfahrung wie ein verspäteter Zwilling folgen: Kokura.
mehr
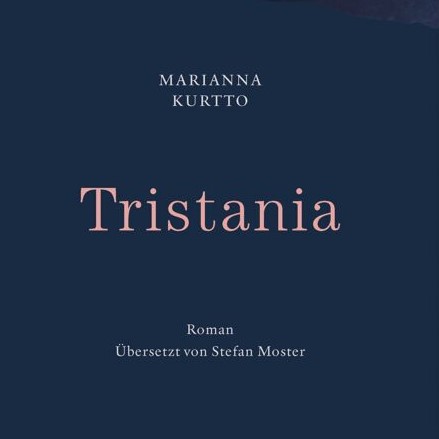
Die Geschichte beginnt mit idyllischen Alltagszenen auf dem entlegensten Flecken unseres Planeten. Marianna Kurtto erkor Tristan da Cunha zum Romanschauplatz. In der Handlungsgegenwart leben dreihundert Personen auf der südatlantischen Hauptinsel des gleichnamigen (von Tristão da Cunha entdeckten und benannten) Archipels. Sie verteilen sich auf dem Kegelkopf eines submarinen Vulkans ...
mehr

Willy findet Bud Spencer, diesen Pfundskerl mit dem Herzen am rechten Fleck, vorbildlich. Er schwankt zwischen Enttäuschung und Irritation, da seine Töchter Mira und Juli nicht mehr als Indifferenz für Papas Idol übrighaben. Sie sitzen im Kino nur ihre Zeit ab ...
mehr
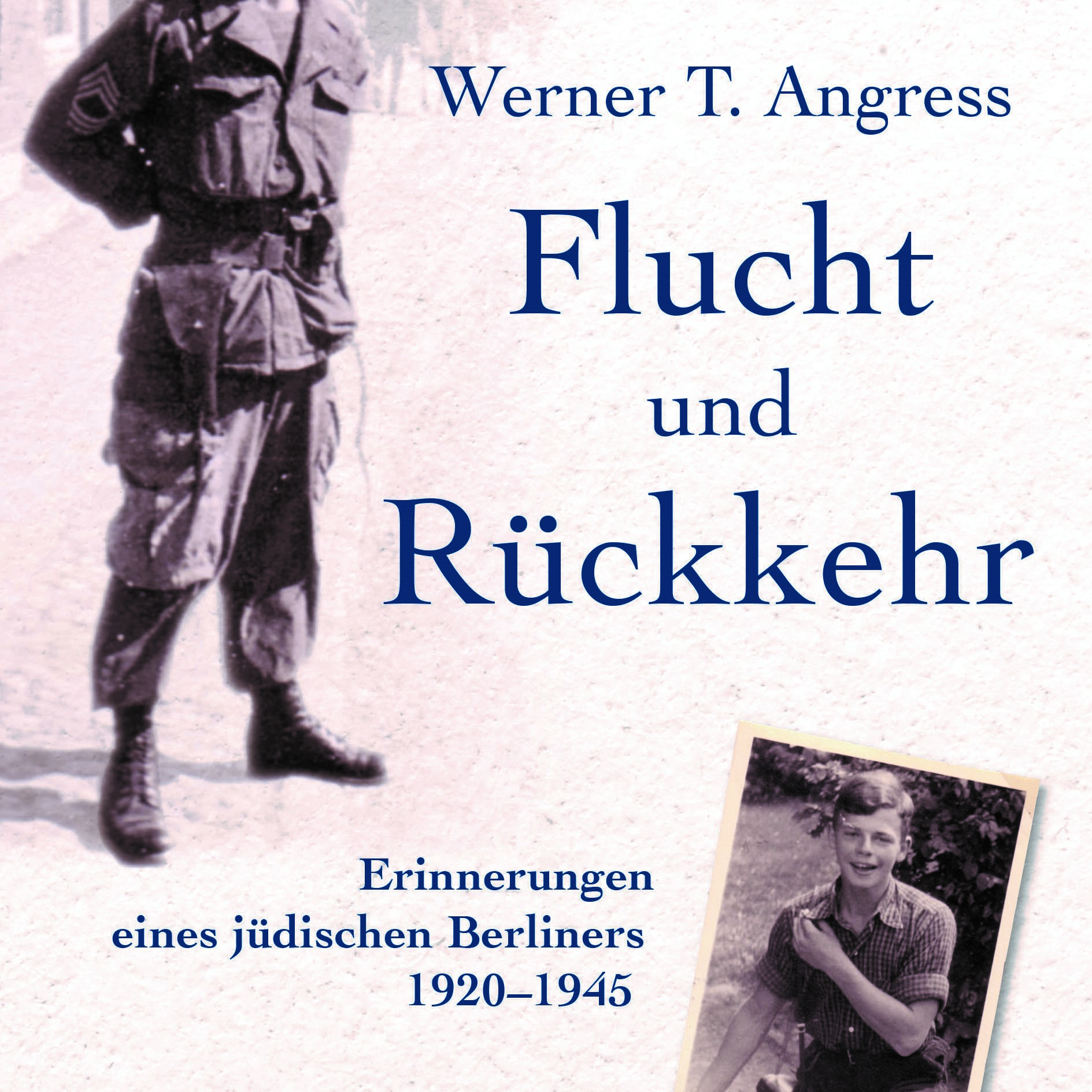
Werner ersetzt eigenmächtig seinen Karabiner. Er rüstet sich mit einer englischen Thompson Maschinenpistole und einer deutschen Luger aus. In einer Douglas C-47 (mit dem Namen Son of the Beach) startet er ins Ungewisse. Ohne Probesprung, unter Beschuss, und mit einer abstürzenden Begleitmaschine vor der Nase tritt Werner am 6. Juni 1944 um 2.15 h aus der Kabinentür ins Leere. „Irgendwie fühlte es sich wunderbar an.“
mehr

Als Kind im Dritten Reich verleugnete er seine Eltern. Willy Winkler, geboren und wohnhaft in Kaiserslautern, ist der Sohn von Kommunisten, die nie zum Hakenkreuz krochen. Die Mutter lebt noch in der 1970er-Romangegenwart.
mehr
Endlich geben die USA ihre Neutralität auf. Die amtliche amerikanische Eintrittsmarke konserviert jene Schmerzwut, die der japanische Angriff auf Pearl Harbor auslöst. Werner kämpft allein an zwei Fronten. Seine in Europa gebliebene Familie durchleidet die nationalsozialistische Verfolgung im Spektrum zwischen Internierung, Ermordung und Überleben im Untergrund. „Somit lebte ich für die Dauer des Krieges in zwei Welten.“
mehr
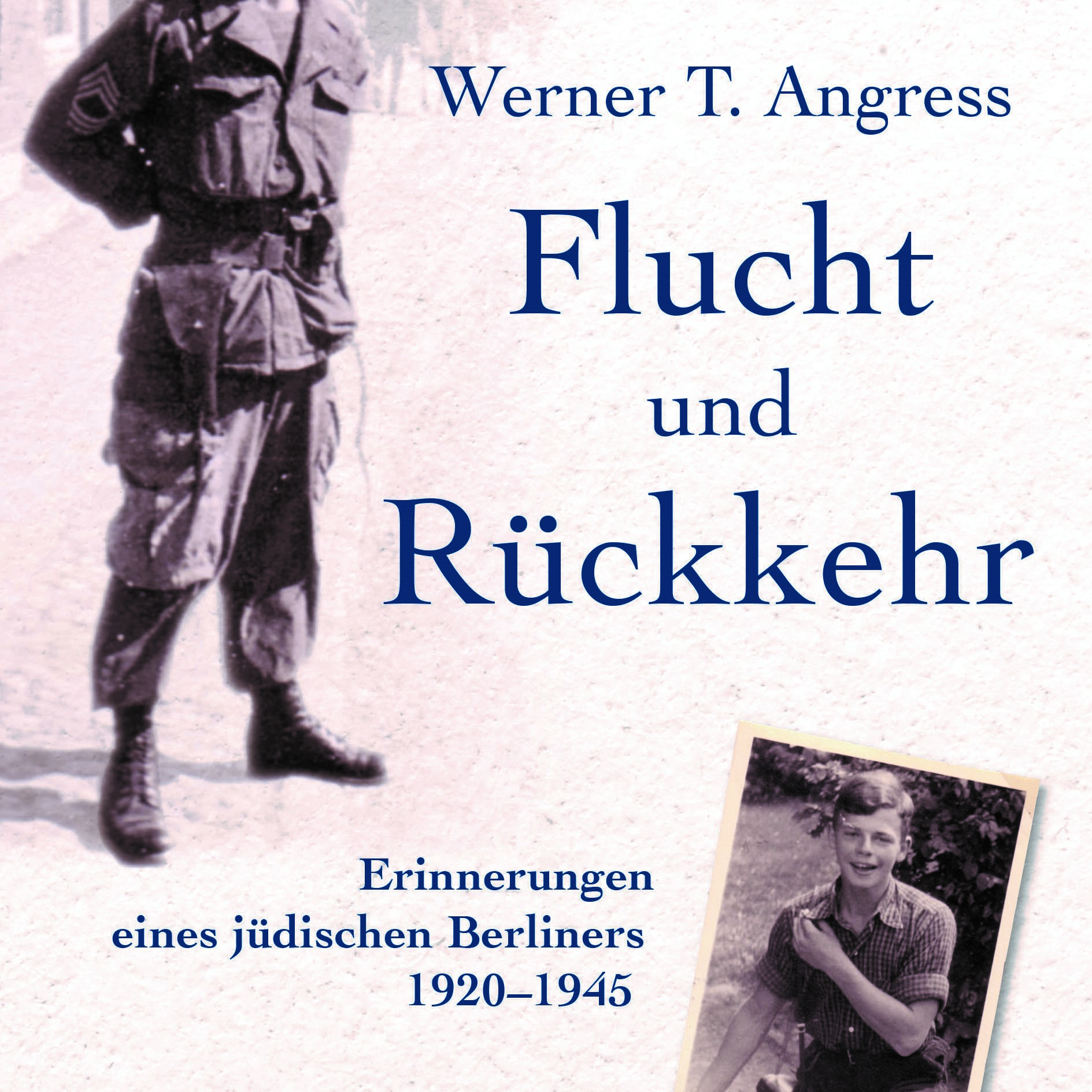
Die strenggläubige Großmutter Amalie Trepp stammt aus einer Familie, die seit dem 15. Jahrhundert in Fulda ansässig war. Folglich lebten ihre Vorfahren in Reichweite der Inquisition. Fulda ging den landgräflich-hessischen Weg der Reformation nicht mit. Die Stadt blieb eine katholische Bastion. Ich fand eben eine Zahl. 1567 gab es in Fulda achtzehn jüdische Hausgenossenschaften vulgo Familien (Quelle).
mehr
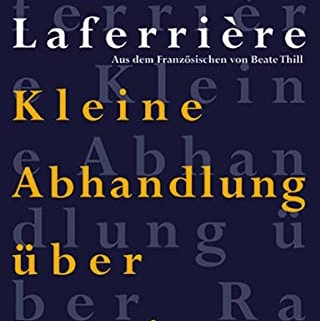
Der Autor destilliert ein Momentum der Lust.
In der lyrischen Skizze „Schau nicht hin“ beobachtet ein Schwarzer eine von Sommergefühlen hochgestimmte, förmlich aufrauschende „große blonde junge Frau/ in einem knappen gelben Seidenkleid“. Sein Blick bleibt an der erregenden Erscheinung hängen. Mit dem Begehren verbindet sich eine Marke des kollektiven Gedächtnisses. Zu anderen Zeiten wäre die Schaulust als Delikt bewertet worden. Man hätte den Delinquenten „ausgepeitscht … bis aufs Blut“. Die überpersönliche Erinnerung „erotisiert den Nachmittag“.
mehr
Die Geschichte beginnt mit einer lapidaren Feststellung, die bald genauso lapidar zurückgezogen wird. Beschränkt man sich auf die Behauptungen des ersten Durchgangs, ergibt sich folgendes Bild. Bei der vier Monate währenden, vom 17. Januar bis zum 18. Mai 1944 tobenden Schlacht um Monte Cassino kämpfte Helena Janeczeks Vater in den Reihen des 2. Polnischen Korps unter General Władysław Anders. Eine Verwundung in Recanati bewahrte ihn womöglich vor Schlimmerem. An den immensen Blutzoll des Korps erinnern ...
mehr
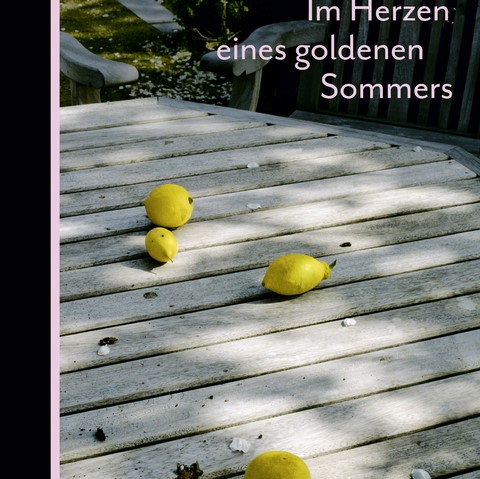
Seit Jahren bewirtet Charles Freunde in seinem Haus. Die Liebenswürdigkeit des Gastgebers wirkt ein bisschen wie aus der Luft gegriffen; als sei sie kein bilaterales Resultat, das in Abhängigkeit von Stimmungen und im Entgegenkommen Anderer entsteht. Charles bleibt ewig und drei Tage zuvorkommend. Der Erzählanlass erschöpft sich in einem Wort. Eines Tages ...
mehr
Das Defilee der Delegationen beobachten achtzigtausend Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen. Auf einer Anhöhe des Olympiaparks drängen sich noch einmal vierzigtausend Zaungäste. Zum ersten Mal spricht eine Frau den Olympischen Eid. Die zweiundzwanzigjährige Leichtathletin Heidi Schüller wird dann im Weitsprung unter anderem Heide Rosendahl unterliegen.
mehr
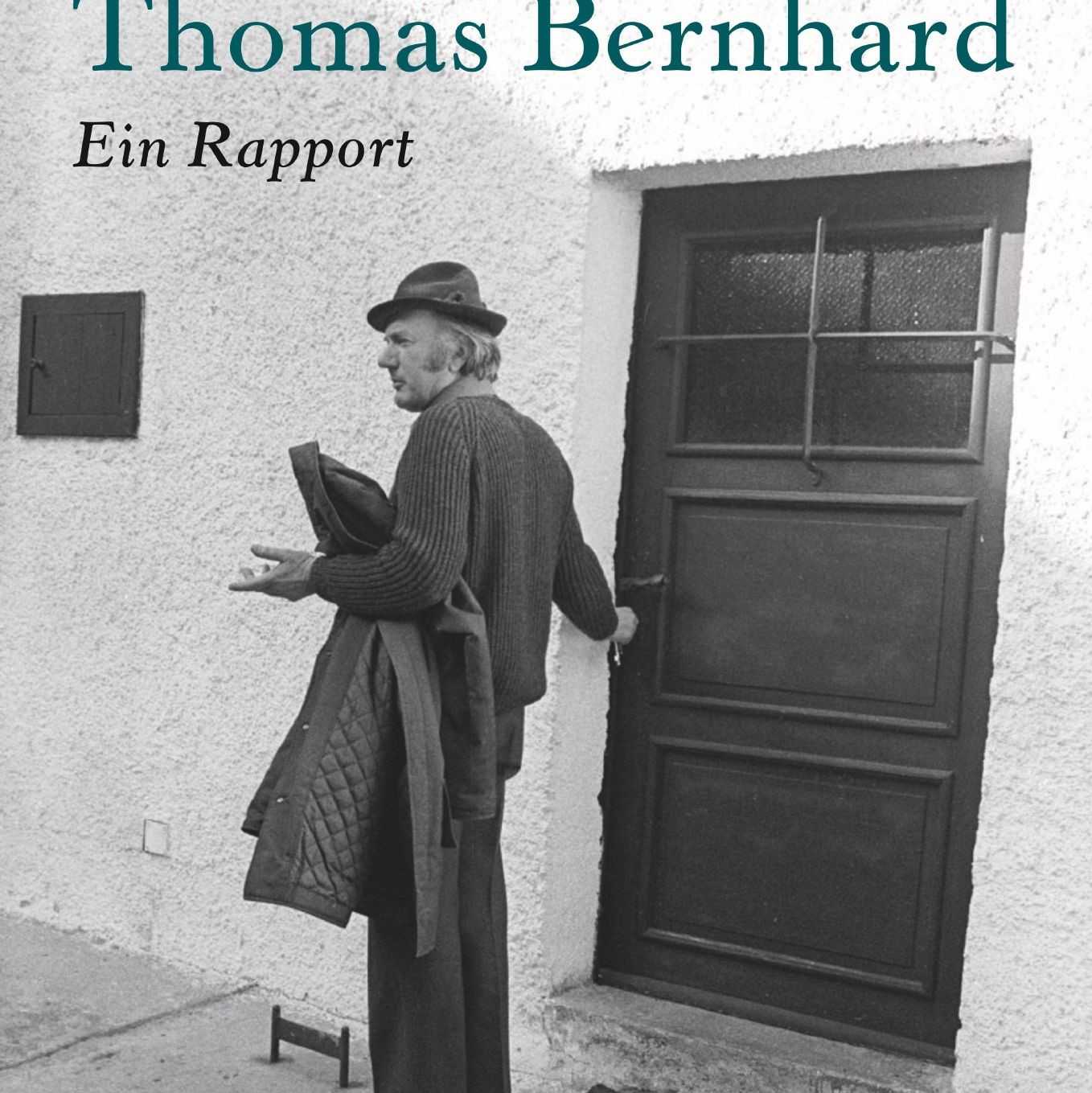
„Ausstrahlen! Und das nicht nur weltweit, sondern universell. Jedes Wort ein Treffer. Jedes Kapitel eine Weltanklage. Und alles zusammen eine totale Weltrevolution.“
mehr
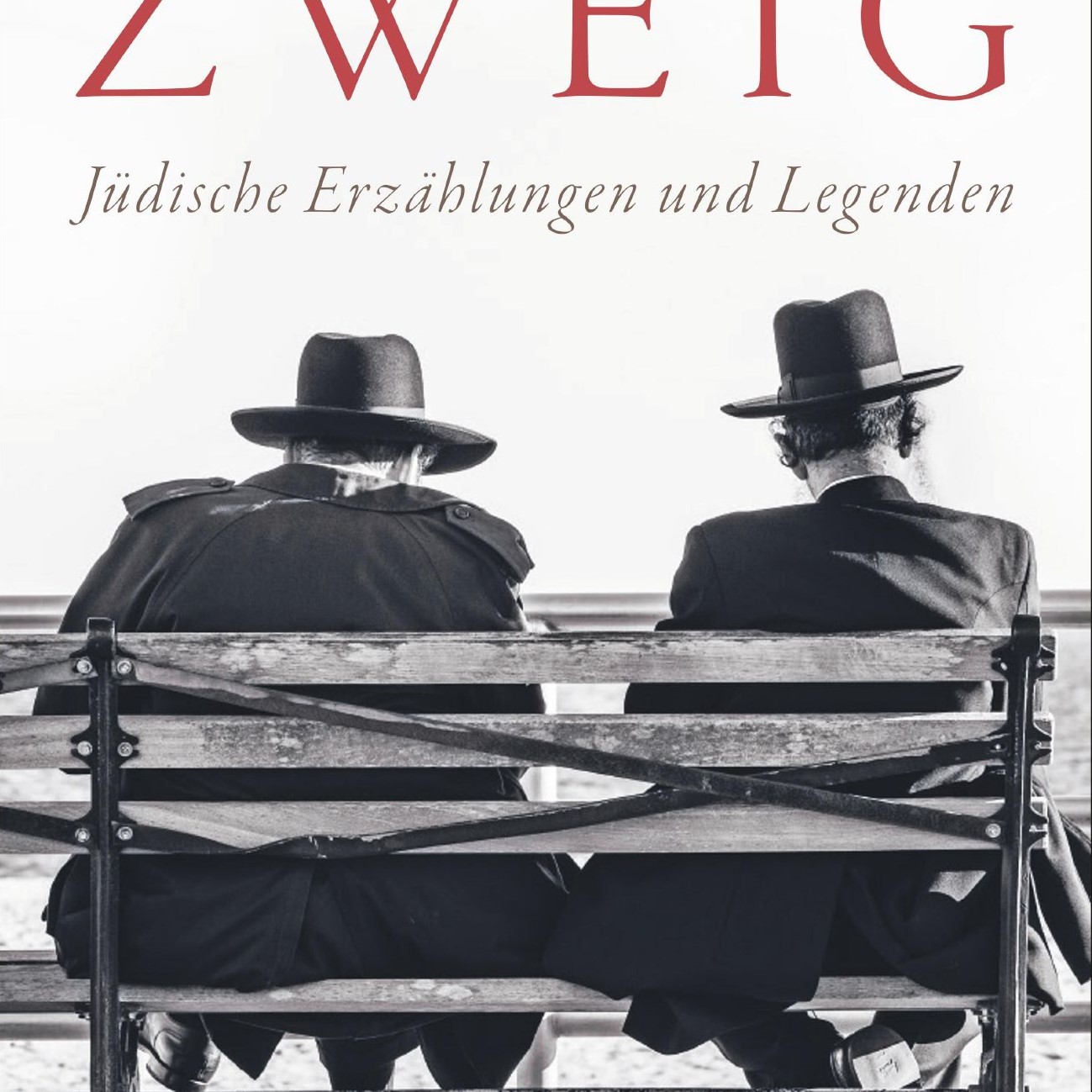
Diesmal wählt der Autor den Tonfall der Bibel. Er trägt dick auf, während Gott wieder einmal mit seinem Volk hadert. Zu lange waren die Punks von Jerusalem so abergläubisch, klein- und wankelmütig wie alle anderen. Rückschläge begleiten die Verankerung des Monotheismus. Die Ur-Palästinenser vergessen immer mal wieder ihren einen Gott. Dann kehren sie zurück zu Baal-Gesang und Babylon-Blues und „schwemmen die Tempelfliesen mit Schlachtwerk“.
mehr
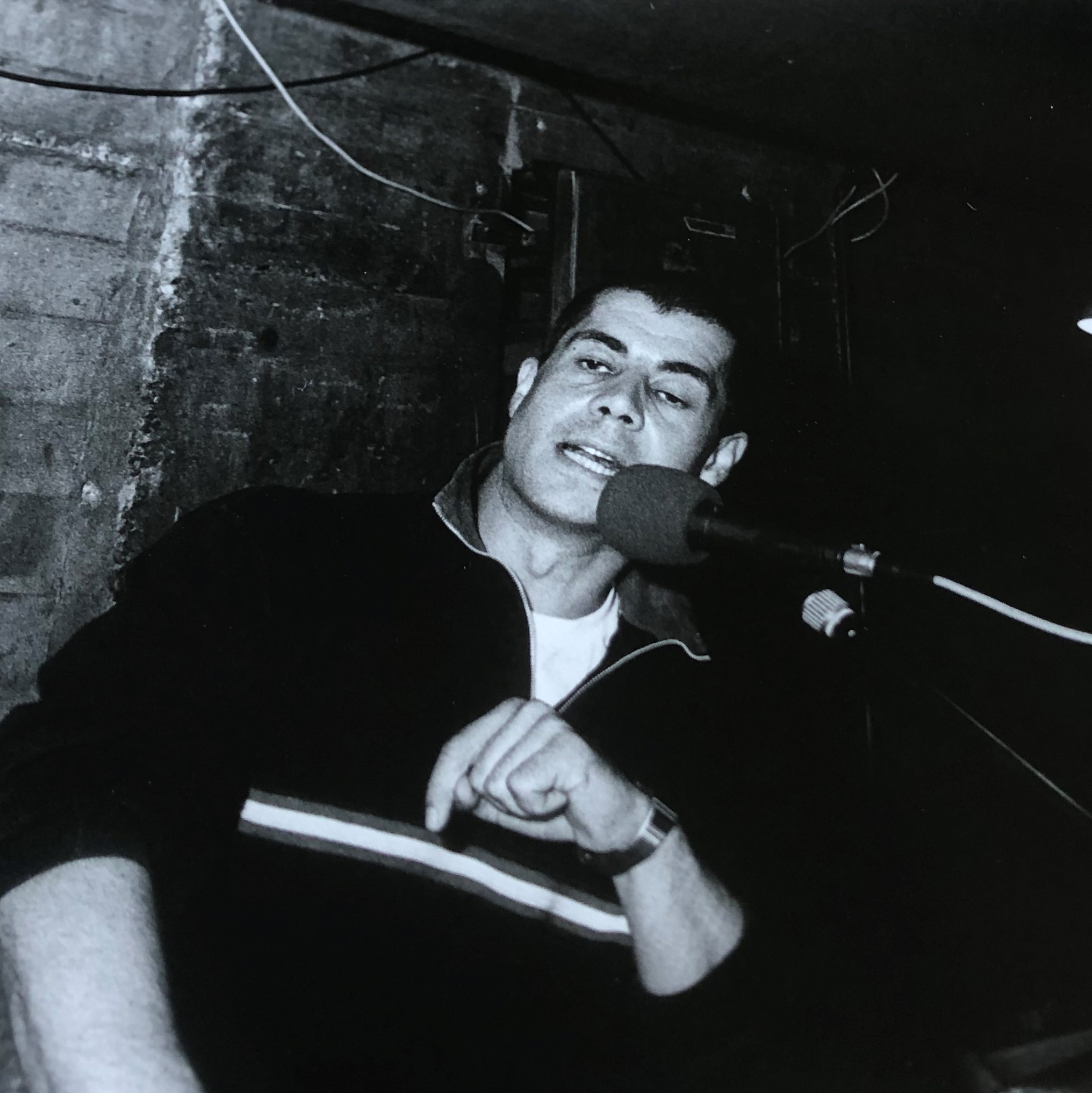
Das Wesen jeder feudalen und aller bürgerlichen Ordnung ist Repräsentation. Nach Stuart Hall ergibt sich im 20. Jahrhundert „eine kulturelle Revolution mit dem Einzug der Marginalisierten in die Repräsentation“. Brecht zeigt in die andere Richtung. In dem Fragment gebliebenen Roman „Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar“ analysiert er eine Karriere mit dem Besteck des historischen Materialismus’. Brecht nimmt Caesar sämtliche heroischen Attribute. Die Plünderung von Völkern, der Sklavenhandel und die Korruption konsolidieren die Macht des Tribuns.
mehr
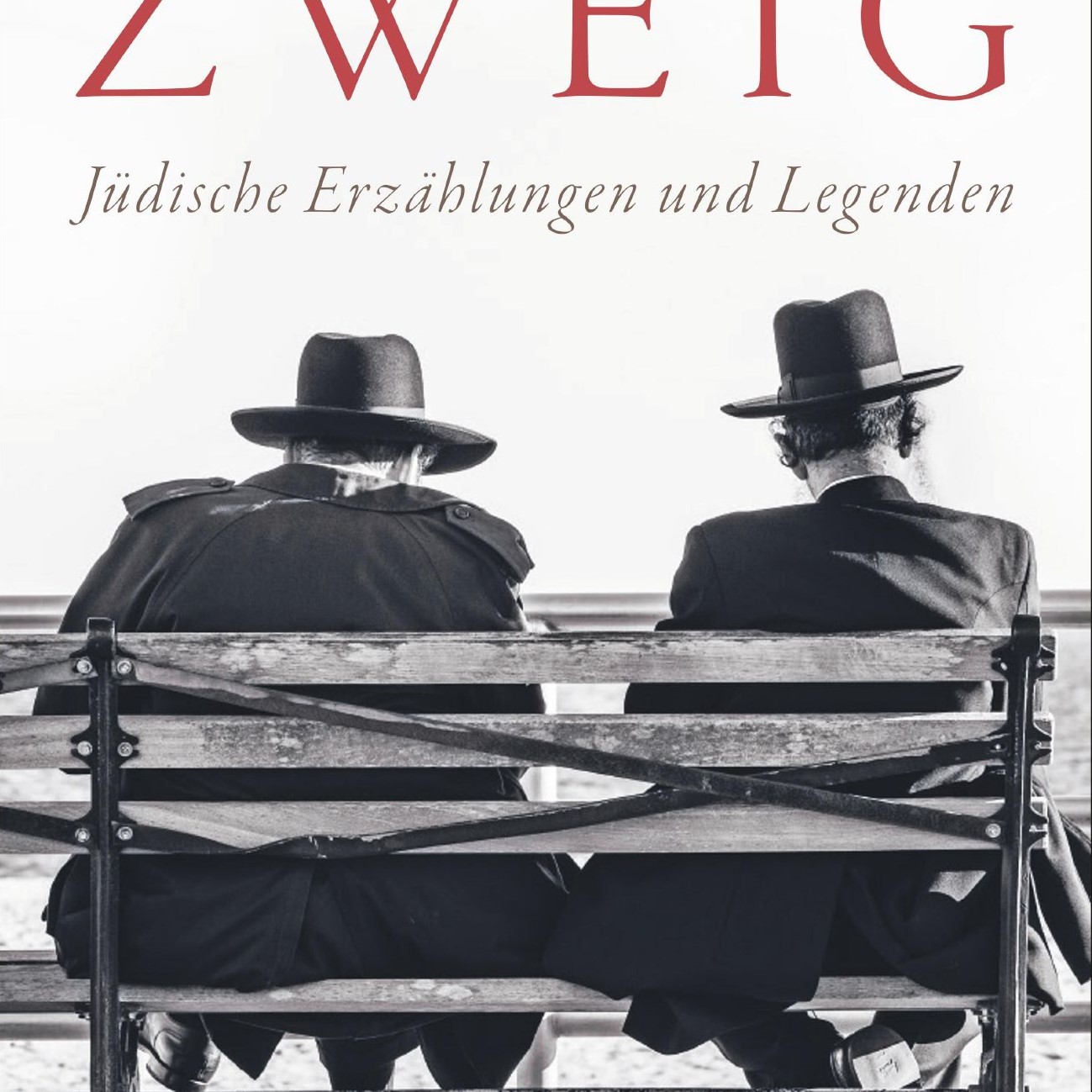
In „Untergang eines Herzens“ sehen wir den Helden morgens um vier, aufgeschreckt von einem Schmerz, „der Leib war ihm wie mit scharfen Dauben umschnürt“, Erholung in leichter Bewegung suchen. Salomonsohn schleicht sich aus dem Hotelzimmer, dass er mit seiner Frau teilt, „der Druck … hemmt den Atem“, die Kirchturmglocke meldet die Stunde. Der Honoratior erholt sich, nach dem Maßstab einer angeschlagenen Gesundheit. Er will wieder ins Bett, da nimmt er eine Bewegung auf dem Korridor wahr.
mehr
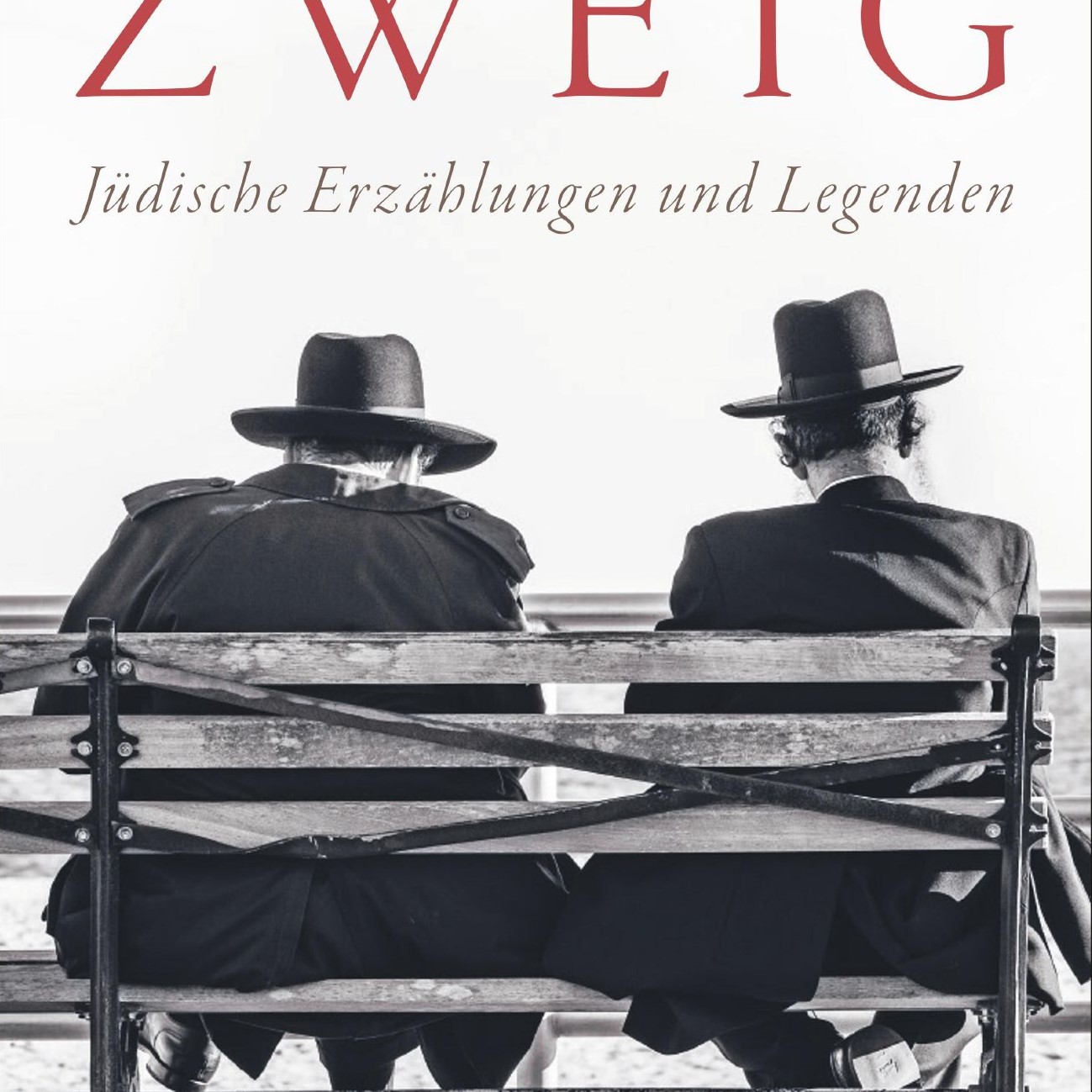
Antwerpen im August 1566 - Auf der verzweifelten Suche nach einem Modell für ein Madonnengemälde in Konkurrenz zu einem imponierenden Gegenstück irrt ein Maler durch Antwerpen. Eines Tages bemerkt er vor einer Schenke eine kaum adoleszente Schönheit. Vom Anblick der Jugendlichen berauscht, erkundet er sich beim Wirt, der es als Vormund nicht nötig fand, das - einem antisemitischen Pogrom entrissene - Mädchen mit dem katholischen Glauben als der spanisch-niederländischen Staatsreligion vertraut zu machen.
mehr
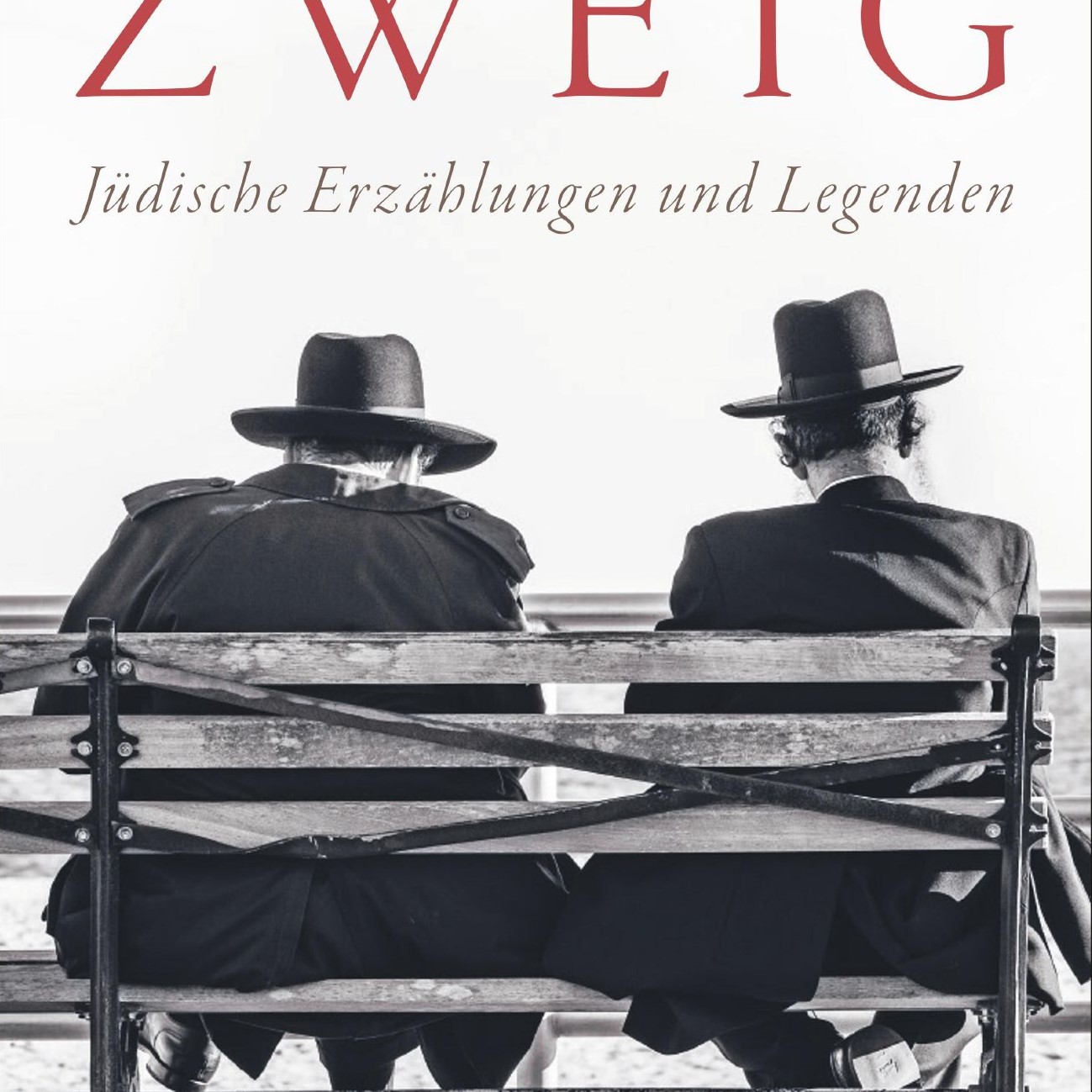
Noch ist Kunst Apologetik, Verehrung der Klassiker, Adoranten-Attitüde und Handwerk. Zwar schon ward das artistische Selbstbewusstsein wachgeküsst von den Musen vermutlich, doch geht man noch in den Geschirren der nicht allein göttlichen Fremdbestimmung.
mehr

„Im Vorfeld der documenta fifteen gab es bereits eine Debatte um Antisemitismus, unter anderem weil keine jüdischen Künstler*innen aus Israel eingeladen worden waren. Im deutschen Feuilleton wurde die documenta lange verteidigt, selbst noch, als wenige Tage nach der Eröffnung klar war, dass antisemitische Kunstwerke ausgestellt werden. Im Fokus stand besonders die antisemitische Ikonographie des Banners ‚People’s Justice‘.“
mehr
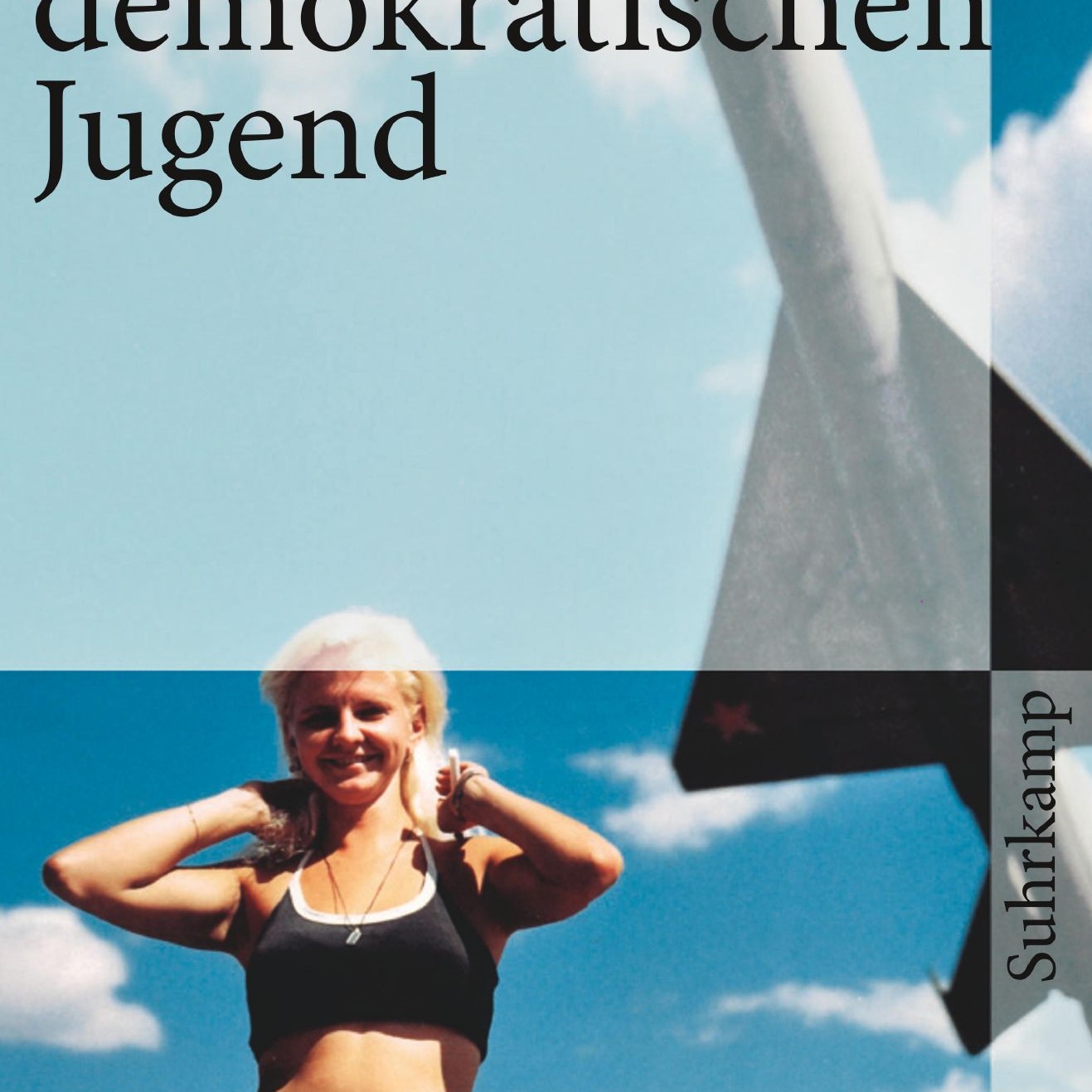
In „Hymne der demokratischen Jugend“ erzählt Serhij Zhadan Schoten aus der ukrainischen Gründerzeit in der postsowjetischen Aufbruchsära. Gangster üben freie Marktwirtschaft. Den Kapitalismus kriegen sie in den falschen Hals.
mehr
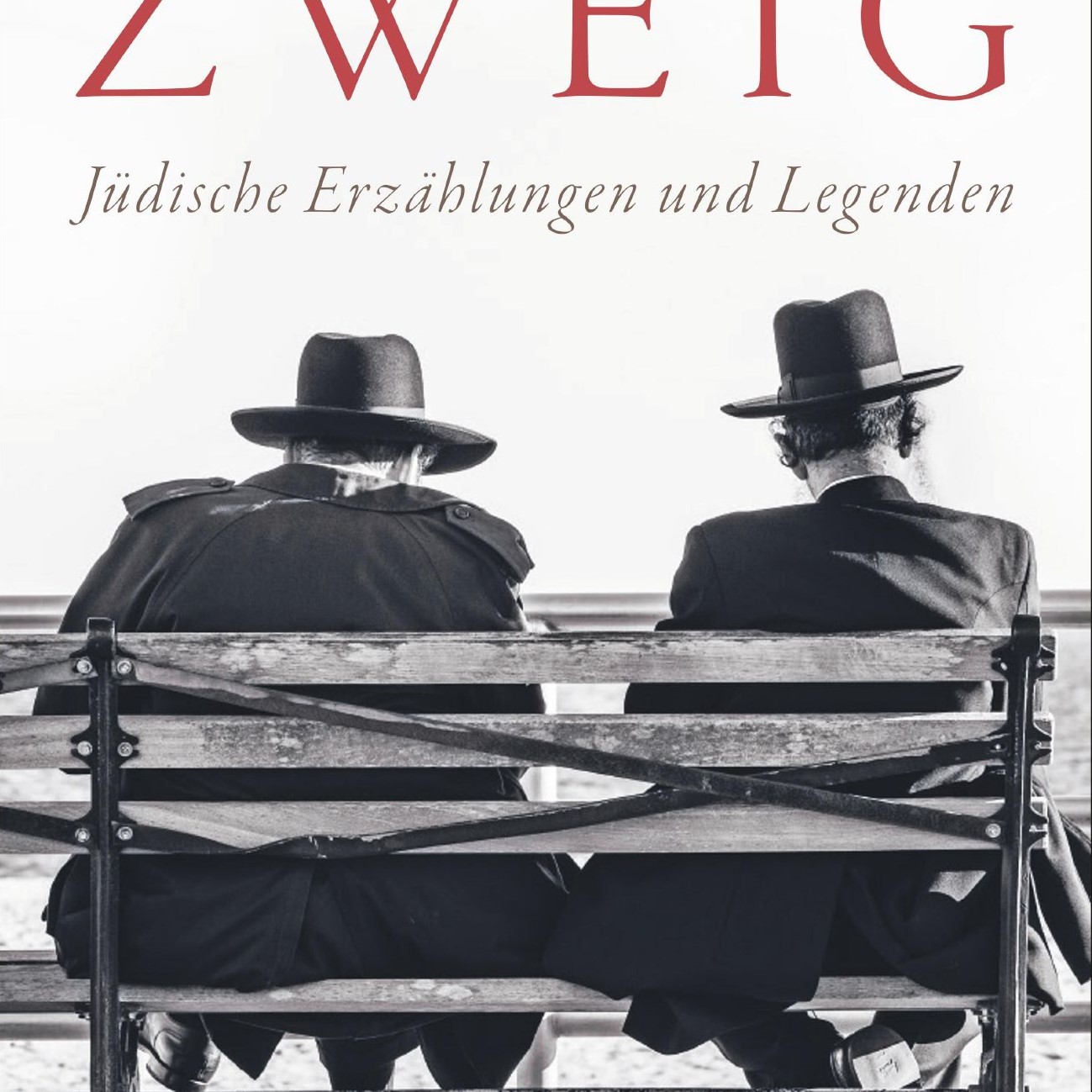
Den Eiligen zieht es in die Agonie einer Gegend, die wie abgetrennt scheint vom nächtlichen Heilschlaf und täglichem Trubel; „als hätte sie nie eine frohe, in Lust überschäumende Festlichkeit gekannt, als hätte nie eine jubelnde Freude diese erblindeten, versteckten Fenster erbeben gemacht, nie ein leuchtender Sonnenschein sein schimmerndes Gold in den Scheiben gespiegelt“.
mehr
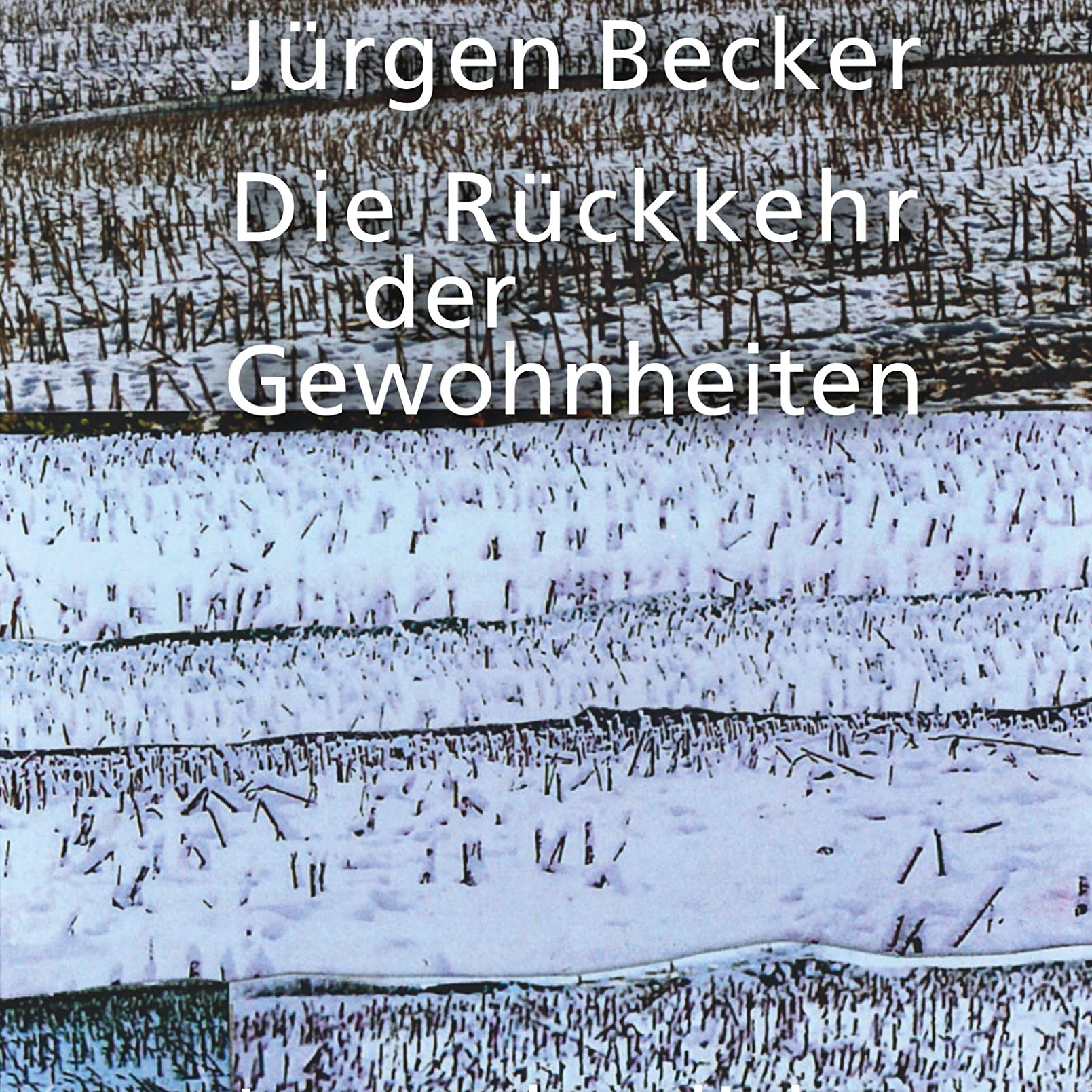
„Die halbe Kindheit fällt (Becker auf ein Radiowort hin) … ein, mit Sondermeldungen, Wunschkonzert, Feindsender.“ Gegen das Grauen kann er sich nicht mehr richtig abdichten. Er denkt an Adam Zagajewski.
mehr
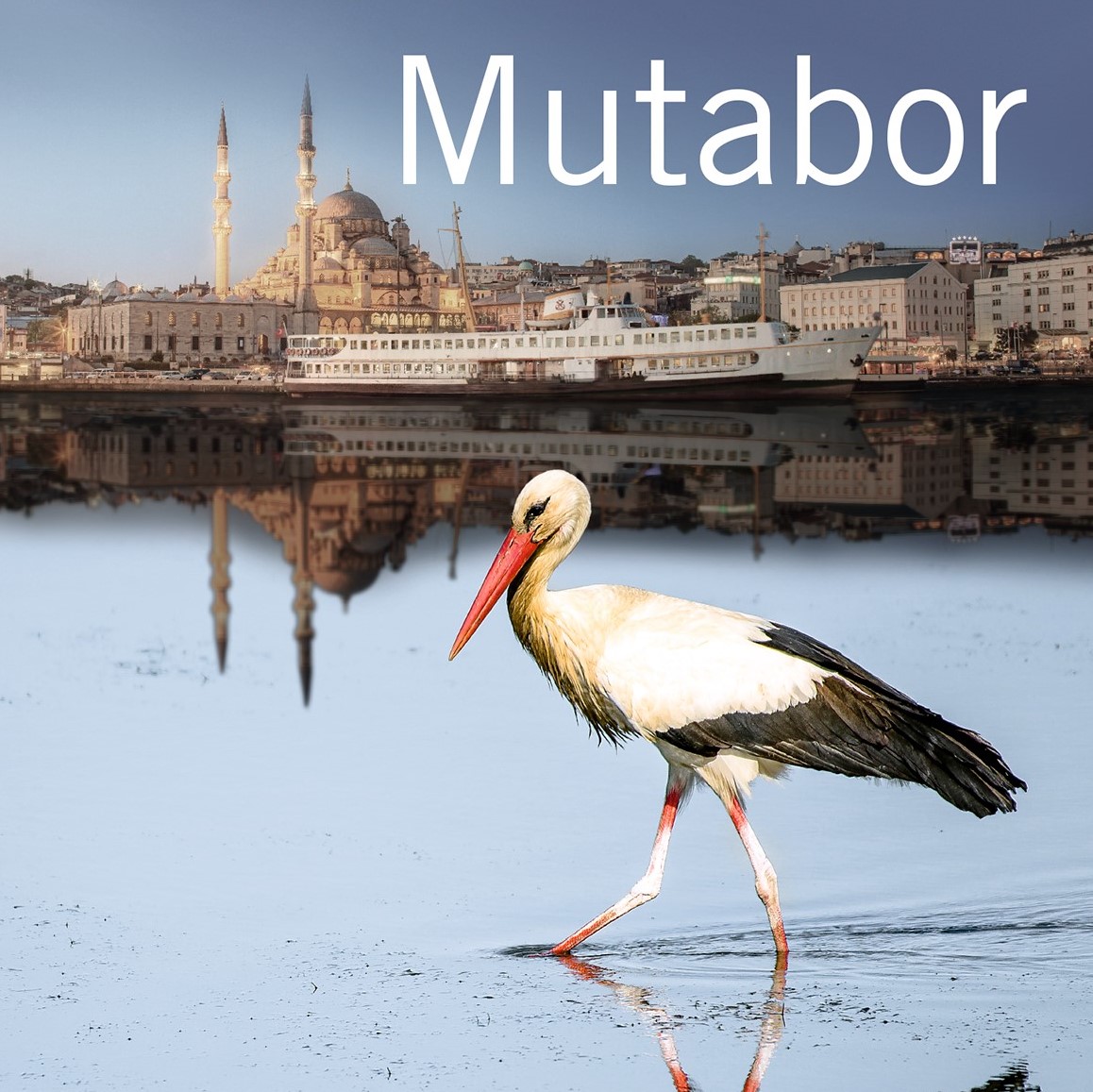
Beton und Zement bildeten das Existenzfundament jener „Grauköpfe“, die täglich in einer Cafeteria zusammenkommen und sich da - mit freiem Blick auf einen Parkplatz und auf ihre Autos, deren Navigationssysteme sie nicht verstehen - gegenseitig auf dem Laufenden halten. Nicht nur in ihren Erzählungen ertrank die Welt einst in einer Sintflut.
mehr
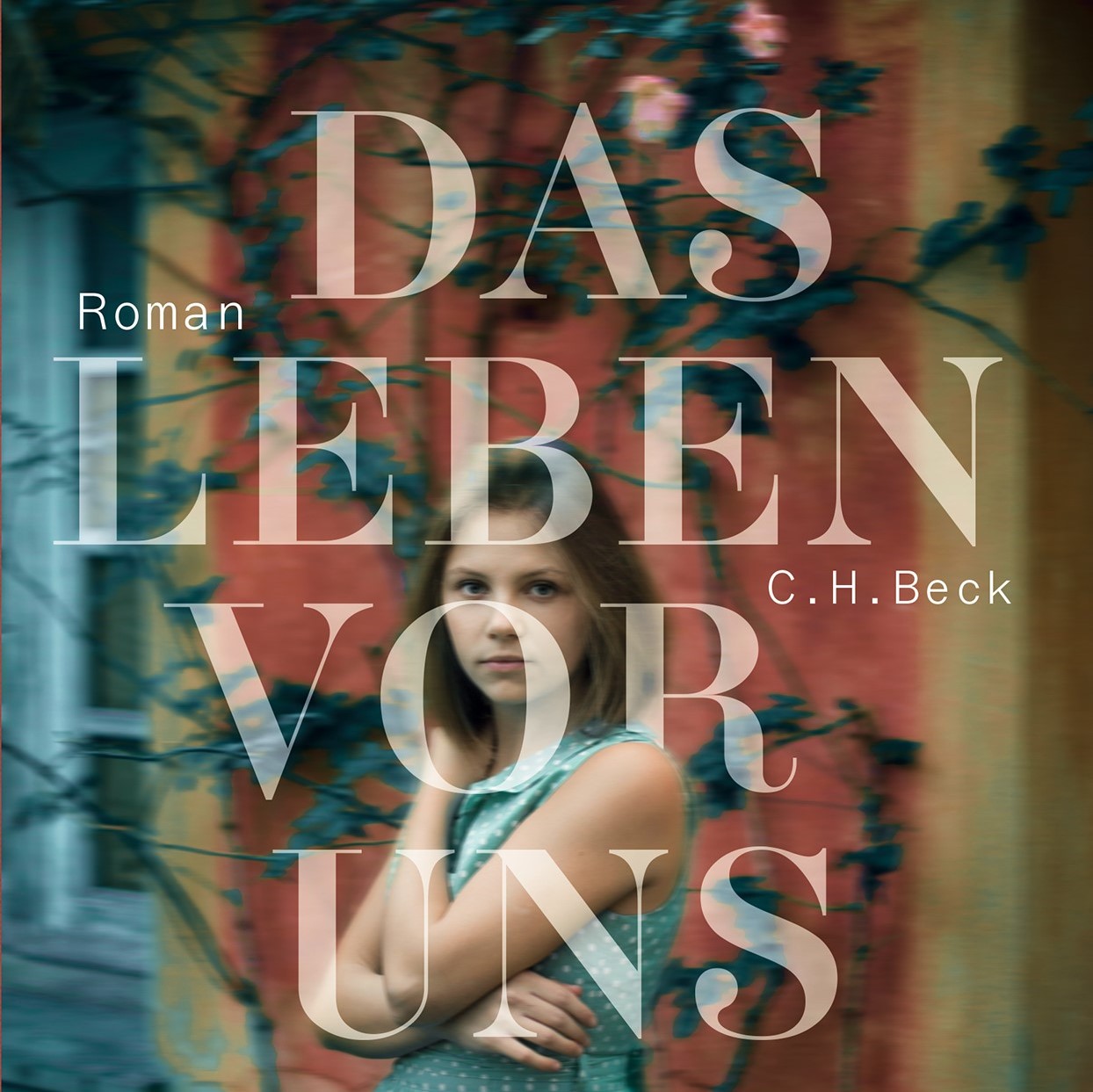
Anja und Milka schwärmen gemeinsam für den virilen Alexei. Er existiert als Mittelpunkt „verträumter Blicke und sehnsüchtiger Seufzer … naiv-pubertierender Mädchen“. Der Sohn bequemer Günstlinge schiebt eine ruhige Kugel. Er hält sich zwar an die Regeln, meidet aber die Karrieristinnen und Karrieristen unter den Nachkommen der Nomenklatura in seiner Reichweite.
mehr
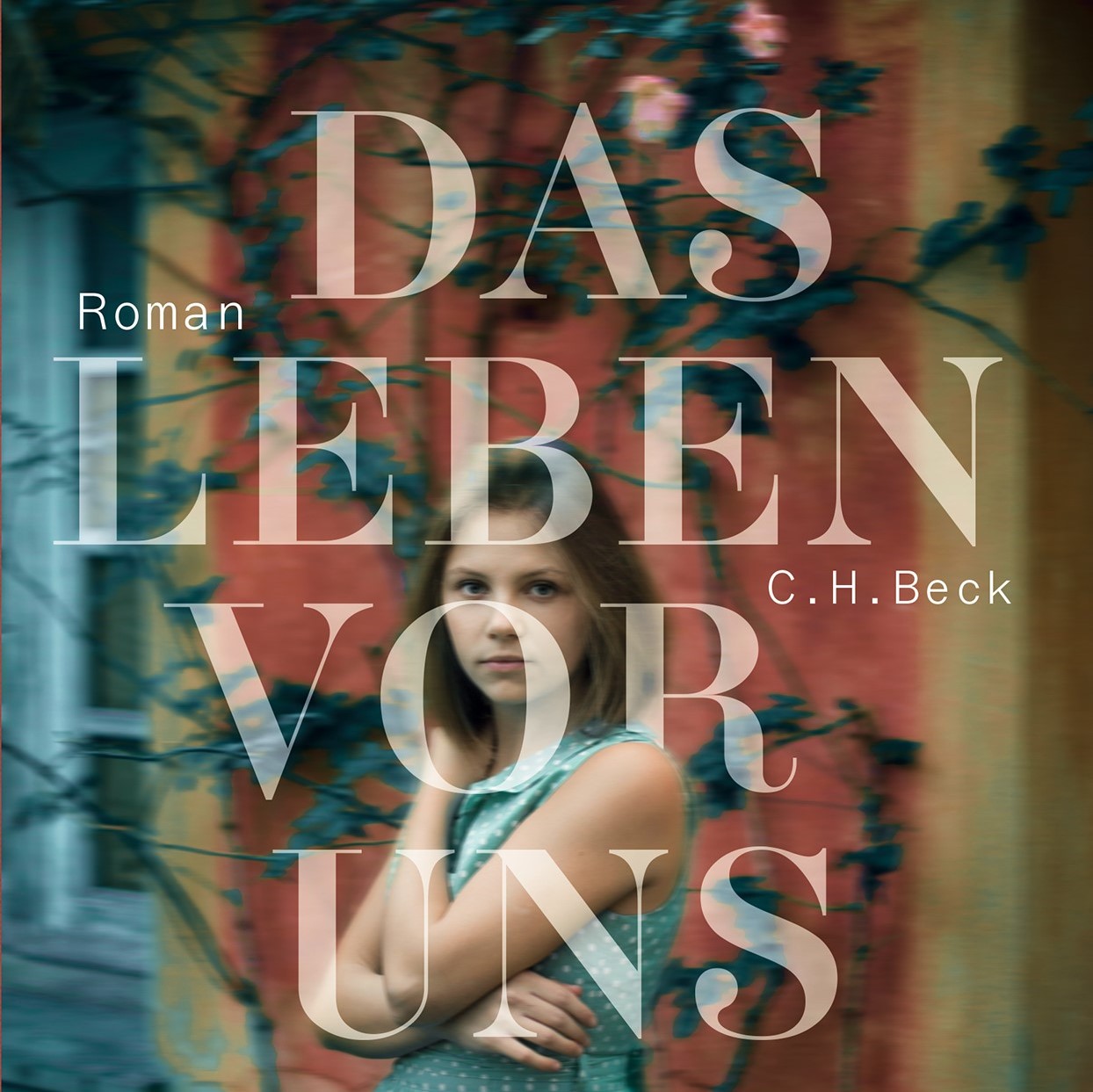
Die Eltern der Heranwachsenden repräsentieren auch noch als Ungläubige eine Ideologie, die ihre Argumente im II. Weltkrieg findet. Das Überleben selbst war eine solche Ungeheuerlichkeit, wir reden von siebenundzwanzig Millionen Toten, das sich aus dem gigantischen Blutzoll eine kommunistische Eschatologie ergibt, die in jeder Familie nach- und vorgebetet wird und sei es in der kompletten Abrede.
mehr

Am Rand zeichnet Petersdorff eine klandestine Frontlinie nach. Während die Hausherrin und der Hausherr unleugbar zugezogene Wessis sind, fühlen sich ihre Söhne den Einheimischen nah. Der ca. sechsjährige Paul sagt: „Ich habe … immer hier gewohnt, solange ich mich erinnern kann.“
mehr

Deutsch-deutsche Aushandlungsprozesse. Die Zivilgesellschaft auf hundertachtzig. Dirk von Petersdorff trifft jeden Dissens-Nagel auf den Kopf.
mehr
„Wie (die Flapper) zu Recht geltend machten, war das Anrecht auf bequeme Kleidung im Grunde ebenso bedeutsam wie das allgemeine Wahlrecht. Keine Frau war dem Mann faktisch gleichgestellt, solange ihre Organe langsam von Walbeinkorsetts zerquetscht wurden oder sechs Kilo schwere Turnüren und Petticoats ihre Bewegungsfreiheit einschränkten.“
mehr
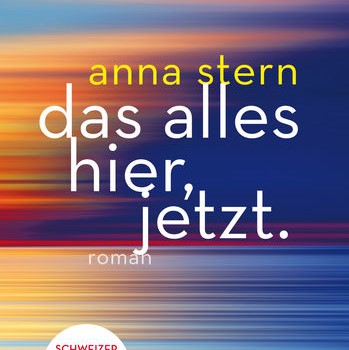
Zum Schluss brechen die Freundinnen und Freunde von einst im „Adenauer“, einem antiken Benz, zu einem Abenteuer auf, das sie neu verbindet. Sie bringen sich in den Besitz jener Urne, die Anankes Asche birgt. Das folgt magischen Vorgaben.
mehr
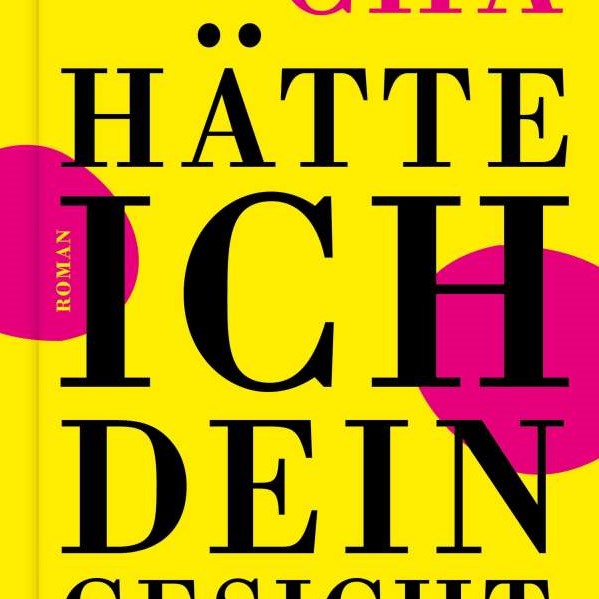
„Reiche Leute sind von Glück fasziniert … Es macht sie rasend.“ Das memoriert Miho, eine Künstlerin mit selbstbewusst präsentiertem Parvenu-Portfolio. Als Stipendiatin kommt sie aus der koreanischen Provinz nach New York und genießt da die Gunst einer superreichen, heimlich unglücklichen, Maserati fahrenden Mäzenatin und Dynastin.
mehr
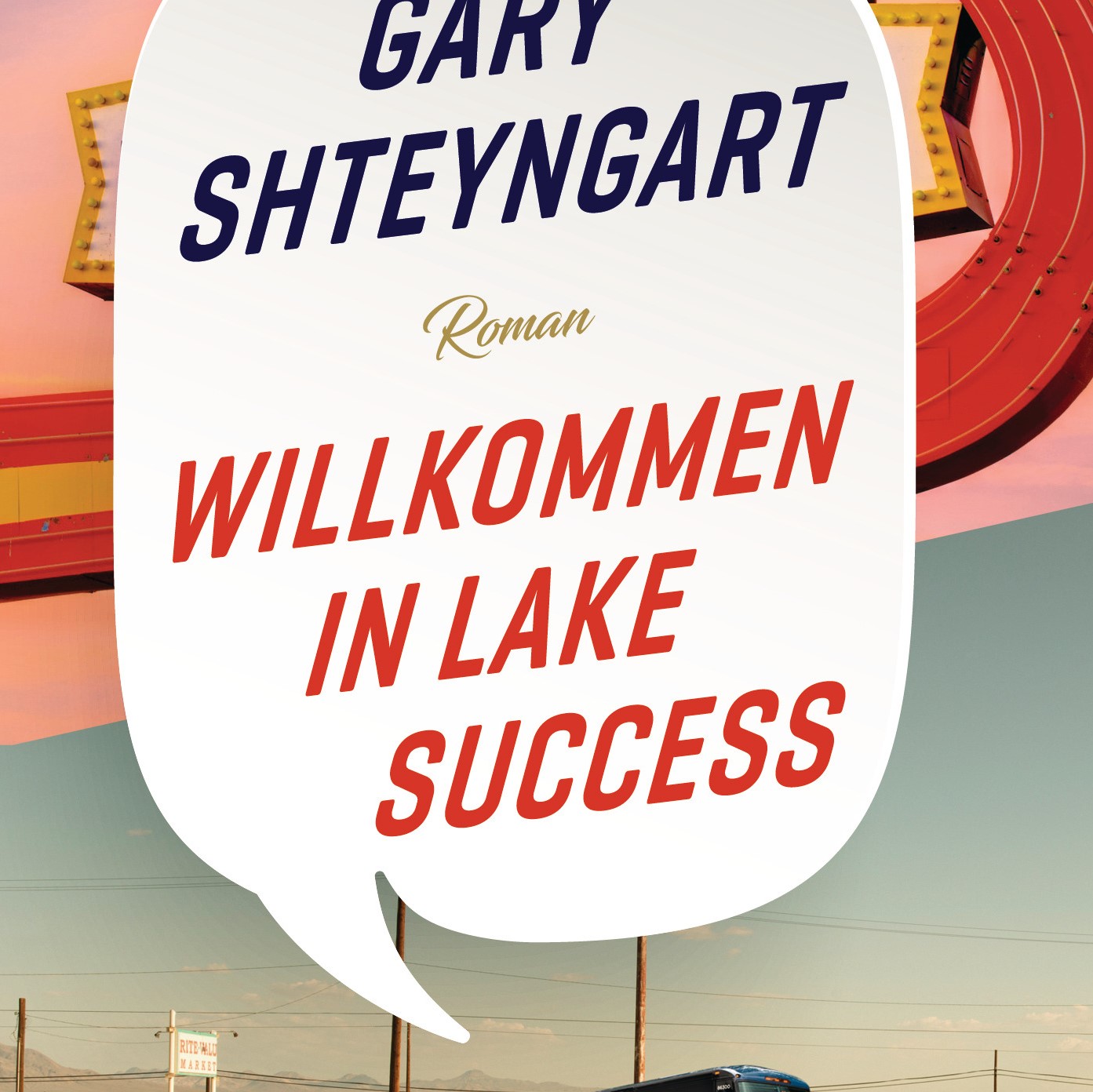
Nach einem Streit verlässt der New Yorker Finanzhai Barry Cohen seine Frau Seema und den autistischen Sohn Shiva. Der Hedgefonds-Tycoon lässt seine Familie in sagenhaft luxuriösen Verhältnissen zurück. In einem Greyhoundbus reist Barry - offenbar vorsätzlich prekär - gen Süden. Ihm schwebt die Wiederaufnahme der Beziehung mit einer vor Jahrzehnten verflossenen Liebe vor, die in El Paso als alleinerziehende Mutter und Professorin lebt.
mehr
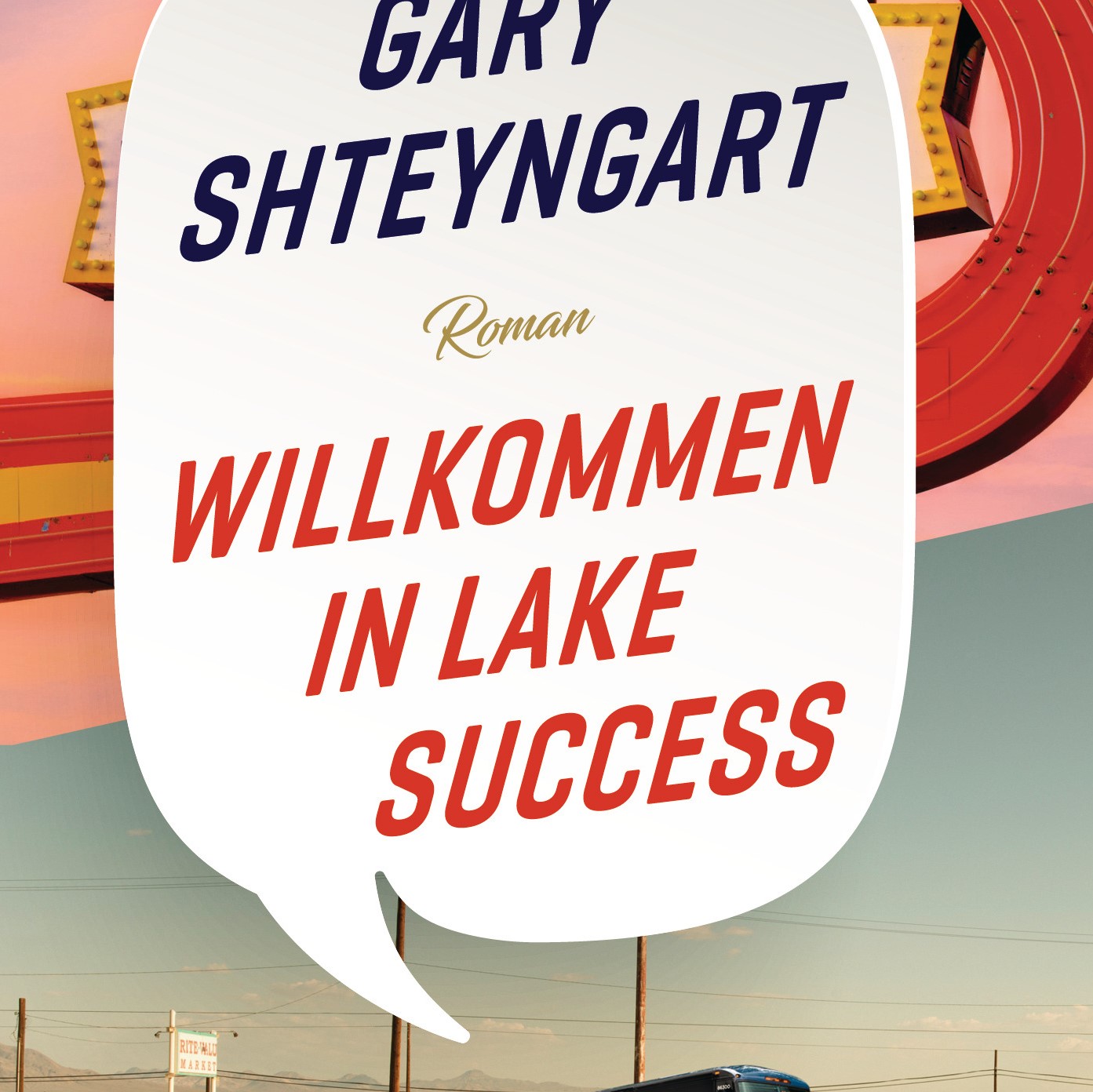
Ein Abend, der alles verändert. Die Ärztin Julianna und der Autor Luis Goodman gehören zu den „mittleren Millionären“ und damit zu den armen Reichen in einem New Yorker Prachtblock nahe dem 1847 eröffneten, in den 1990er Jahren berüchtigten und nun wieder dem bürgerlichen Wohlergehen dienenden Madison Square Park an der 5th Avenue.
mehr
„Ich war entschlossen, niemals meinen Frieden mit dem Ghetto zu machen, sondern lieber zur Hölle zu fahren, … als meinen Platz in diesem Staat zu akzeptieren.“ James Baldwin
mehr

Zwei Leute, die Gründe haben, aneinander festzuhalten, geraten in den Sog einer skrupellosen Spielerin. In undurchsichtigen Manövern werden sie zu animierten Opfern. Es kommt sogar zu einer Reanimation der Beziehung.
mehr
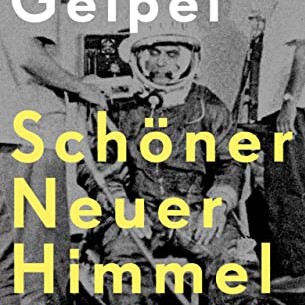
Der Körper als Kampfstätte und Exerzierplatz. Die jungen Pioniere des „Hoffnungsprojekts DDR (sind) Hitlers Kinder“. Zu der nationalsozialistischen Abrichtung und gruppenförmigen Ausrichtung kommt der Bankrott einer verworfenen, sozial gestorbenen Eltern- und Lehrergeneration. In den Trichter der ungeheuren Empfänglichkeit des jugendlichen Idealismus ergießen sich die Parolen des Neuen Deutschlands.
mehr
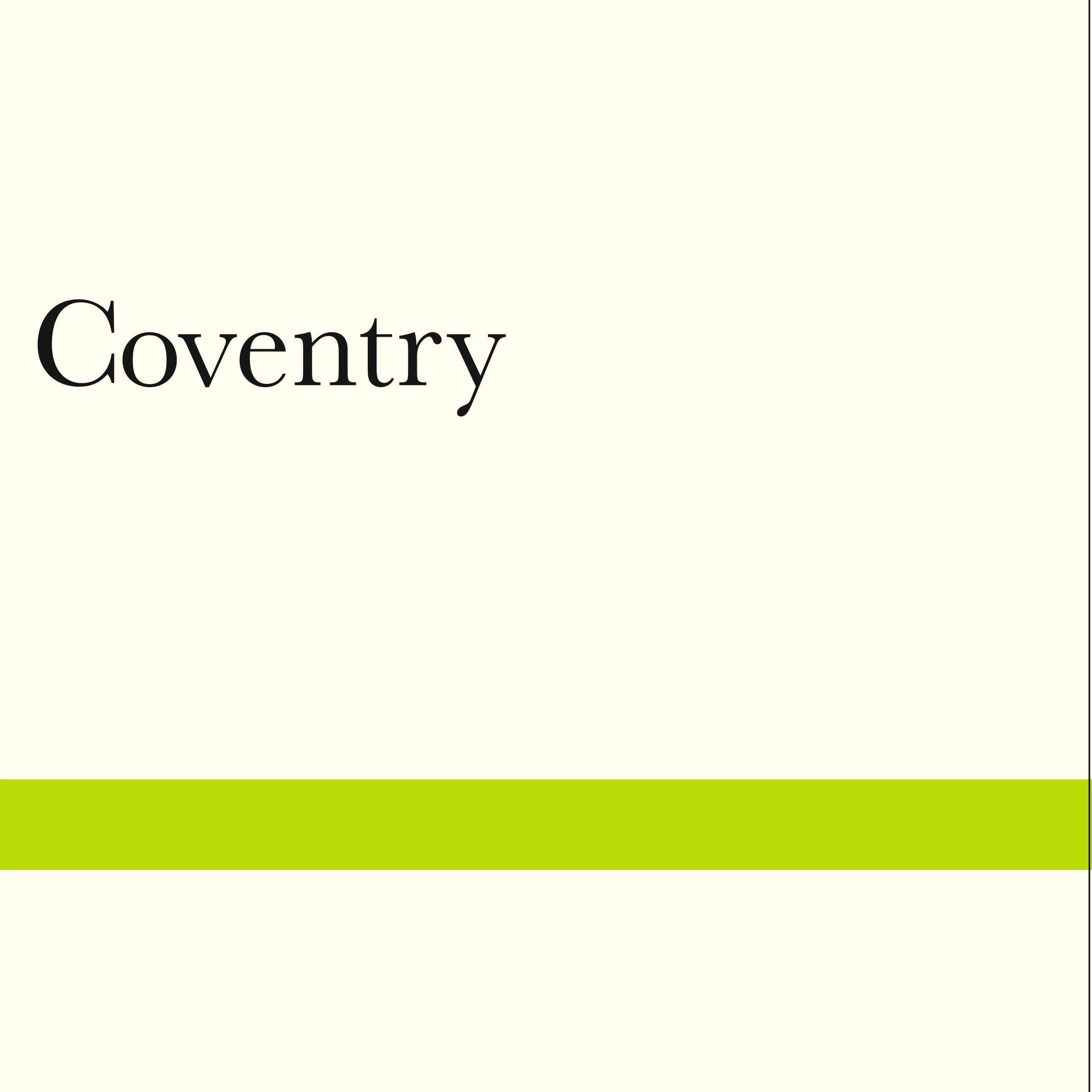
Im obligatorischen Scheidungskrampf beansprucht die Autorin ihre Töchter ohne Wenn und Aber. Sie gehören zu ihr, vermutlich seit „der Apotheose der Geburt“.
mehr
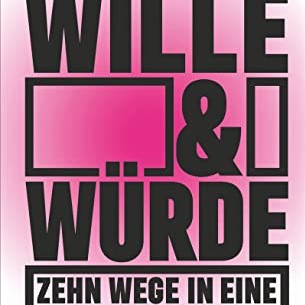
Wie Paul Mason, registriert und analysiert Temelkuran eine „neue Form des Faschismus“. Das Neo-Format führe „einen globalen Krieg gegen die Grundlagen der Vernunft“. Gleichzeitig alarmiert uns die Autorin: „Die Repräsentanten des radikal Männlichen sind … aktiviert worden … Gut möglich, dass es Krieg gibt. Wahrscheinlich werden wir lernen müssen, Kriegerköniginnen zu sein.“
mehr

Der „jüdische Zusammenhalt“ braucht(e) einen sakralen Raum. Die Bedrohungen, denen sich die Juden als religiös selbstbestimmte Minderheit in der polytheistisch-römischen Herrschaftssphäre ausgesetzt sahen, legten die Entwicklung mobiler Formate (für eine nomadische Praxis als Second Best Solution) nah. Wolffsohn beschreibt die Notwendigkeit einer „‚portativen‘, (sprich) tragbaren Heimat“.
mehr

Das religiöse Zentrum des eisenzeitlichen Königreichs Jehūdāh war der 965 v. u. Z. auf dem höchsten Punkt Jerusalems (auf der Spitze der Stadt) erbaute Salomonische Tempel. Mit seiner Zerstörung 587/586 v. u. Z. ging die Deportation eines Bevölkerungsgroßteils nach Babylon einher. Nach der Rückkehr aus dem Exil um 515 v. u. Z. entstand ...
mehr
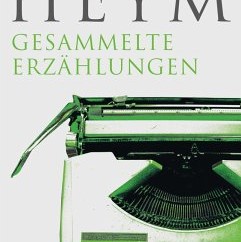
Mit Horst Brasch, der nach England exiliert war, teilte er das Schicksal der „falschen Emigration“. Stefan Heym kam aus dem großen Amerika in die kleine DDR. Da belebte er den sozialistischen Realismus mit Hollywood-Stilmitteln. Er spielte in der Brecht-Liga, geschützt von einem Idealismus, der ihm ständig Gründe gab, auf seiner unergründlichen Linie zu bleiben. Heym war weder Dissident noch SED-Sprachrohr. Was ihm die realsozialistische Ernüchterung nahm, holte er sich aus der Bibel zurück.
mehr

Amos Oz war ein typischer, zugleich überragender Vertreter der israelischen Aufbaugeneration. Versessen auf alles Neue sowie auf Stärke - in einer Gemeinschaft vom Grauen beflügelter, so leidensfähiger wie lebensfroher Frontiers. Aber natürlich überflügelte Oz seine Kohorte. Er wusste vom Lachen der Steine in der Negev und konnte sogar die Wüste lachen hören.
mehr

„Spätheimkehrer“ - das sind in der fabelhaft modernen Gegenwart von 1972 jene Sportler:innen, die im Morgengrauen über den Zaun klettern, der das Olympische Dorf schutzverweigernd säumt. Für Edgar Berewski ist Spätheimkehrer ein biografisches Reizwort. Es lässt den verwitweten Anwalt mit schlesischem Migrationshintergrund aufhorchen.
mehr

Bei meiner Zeugung sei eine kosmische Anziehungskraft im Spiel gewesen, die meine damals kaum drei Monate verheiratete Mutter vom Hocker riss und alles zum Erliegen brachte, was man ihr beigebracht hatte. Nach einem kurzen Sternenschauer wollte sie aber nur noch zurück in die Gediegenheit jener Verhältnisse, die sie geheiratet hatte.
mehr
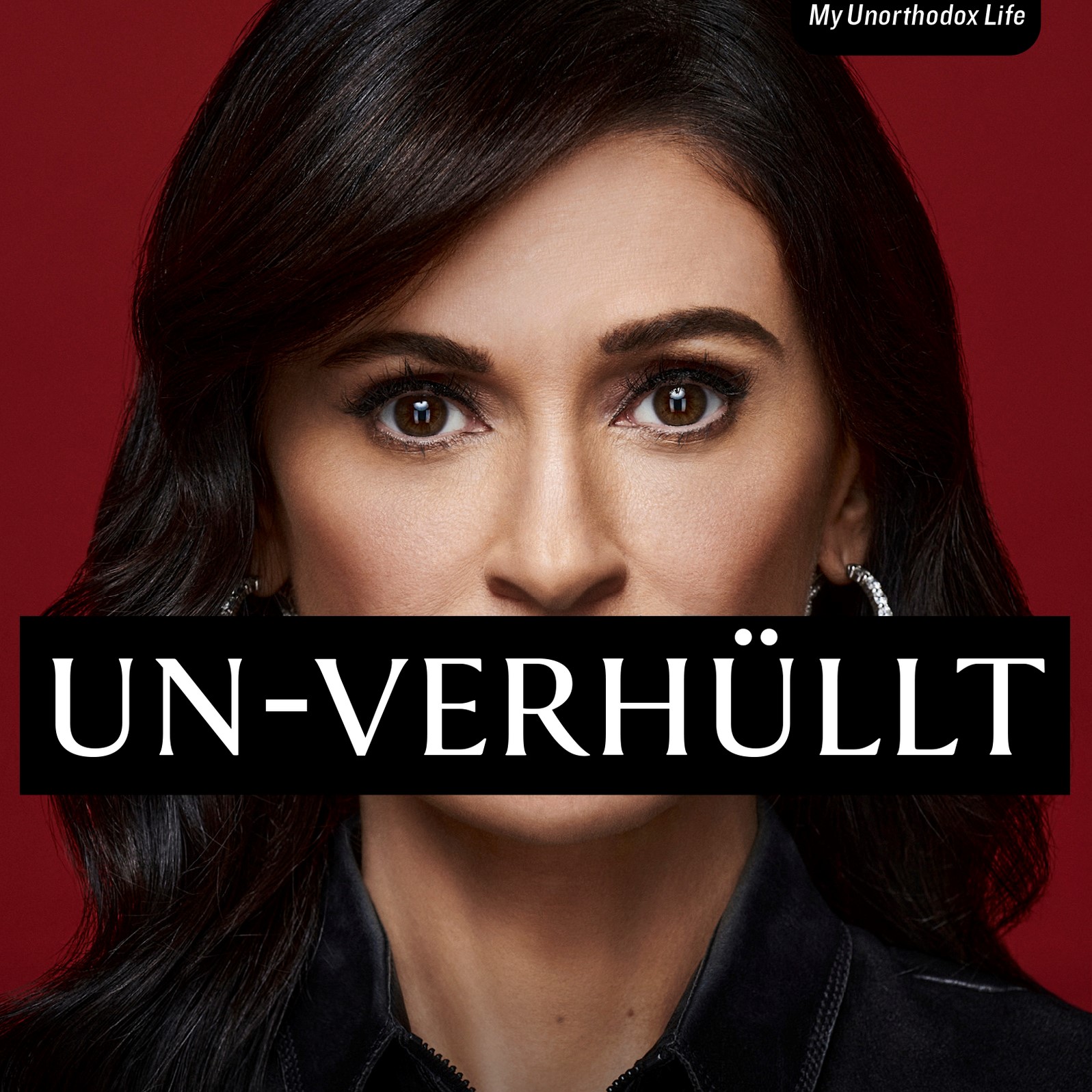
Sie muss um eine Putzhilfe betteln, obwohl sie das Geld für die Familie verdient; während der Gatte sich ganz dem Tora-Studium widmet. Seine Gelehrsamkeit rangiert turmhoch über allem. „Yosef kannte sich in unserer Küche gar nicht aus. Er musste mich sogar fragen, wo die Messer waren, wenn er einmal eines brauchte.“ Der Ehefrau obliegen alle häuslichen Arbeiten, ohne jeden Prestigegewinn.
mehr

Die Jagd war zu Ende, die Jägerin schnitt einen Laborbatzen Muskelfleisch aus. Zehn Jahre nach Tschernobyl strahlte das Wildbret in der Wetterau weit über dem zulässigen Wert. Vereinzelt wurden bis zu 1115 Becquerel pro Abschusskilo gemessen. Keine Eingeweihte verlor darüber ein Wort. Es herrschte die Omertà der Interessenverbände.
mehr
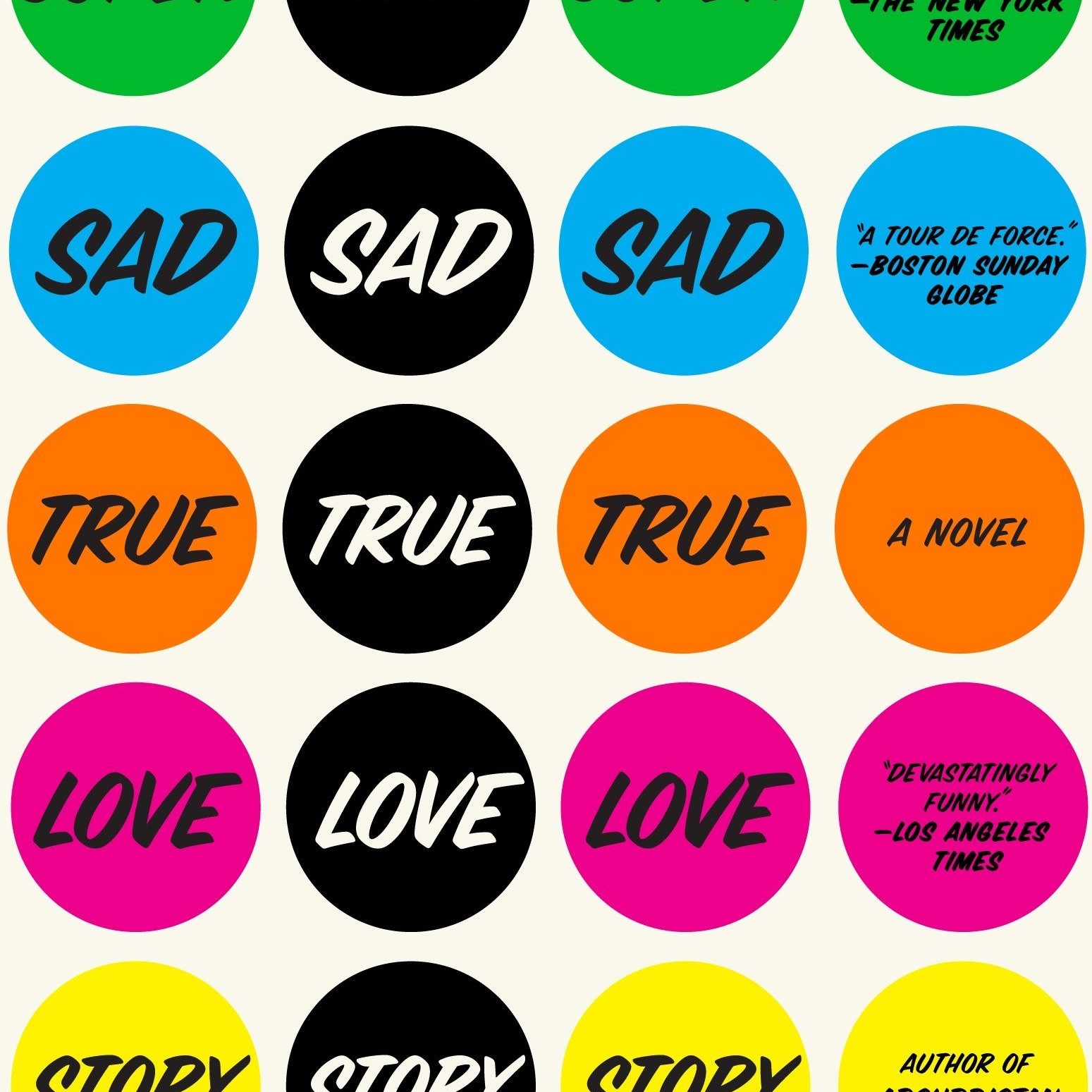
In Gary Shteyngarts ‚Brave New World‘ sind Flughäfen, „so schön wie Korallenriffe“, und die Fitnesswerte sämtlicher Verkehrsteilnehmerinnen eine öffentliche Angelegenheit. Via seines „Äppäräts“ erhält jeder Zugang zu verlässlichen Informationen über den sozialen Status von jedem. Die Gesundheits- und Attraktivitätsnormen deklassieren alle über Fünfundzwanzig. Im Gegenzug haben Fünfzigjährige einen ‚Global Teens Account‘.
mehr

Lale Jerome gefällt es, ihre Gäste zu verwirren. Sie kombiniert Erfolgreiche mit Unterversorgten. Es dauert eine Weile, bis die einen bemerken, dass die anderen als Terrordekoration gedacht sind, wie eine Ekelmenagerie im Schaufenster einer H-Society-Frisörin, die kognitive Dissonanzen erzeugen will. Spricht man sie darauf an, behauptet die Fachfrau plump: In Manila sei das gang und gäbe. Subtext: Der neue Schick ist schon auf dem Weg nach Europa. Ich bin bloß einmal wieder die Erste.
mehr
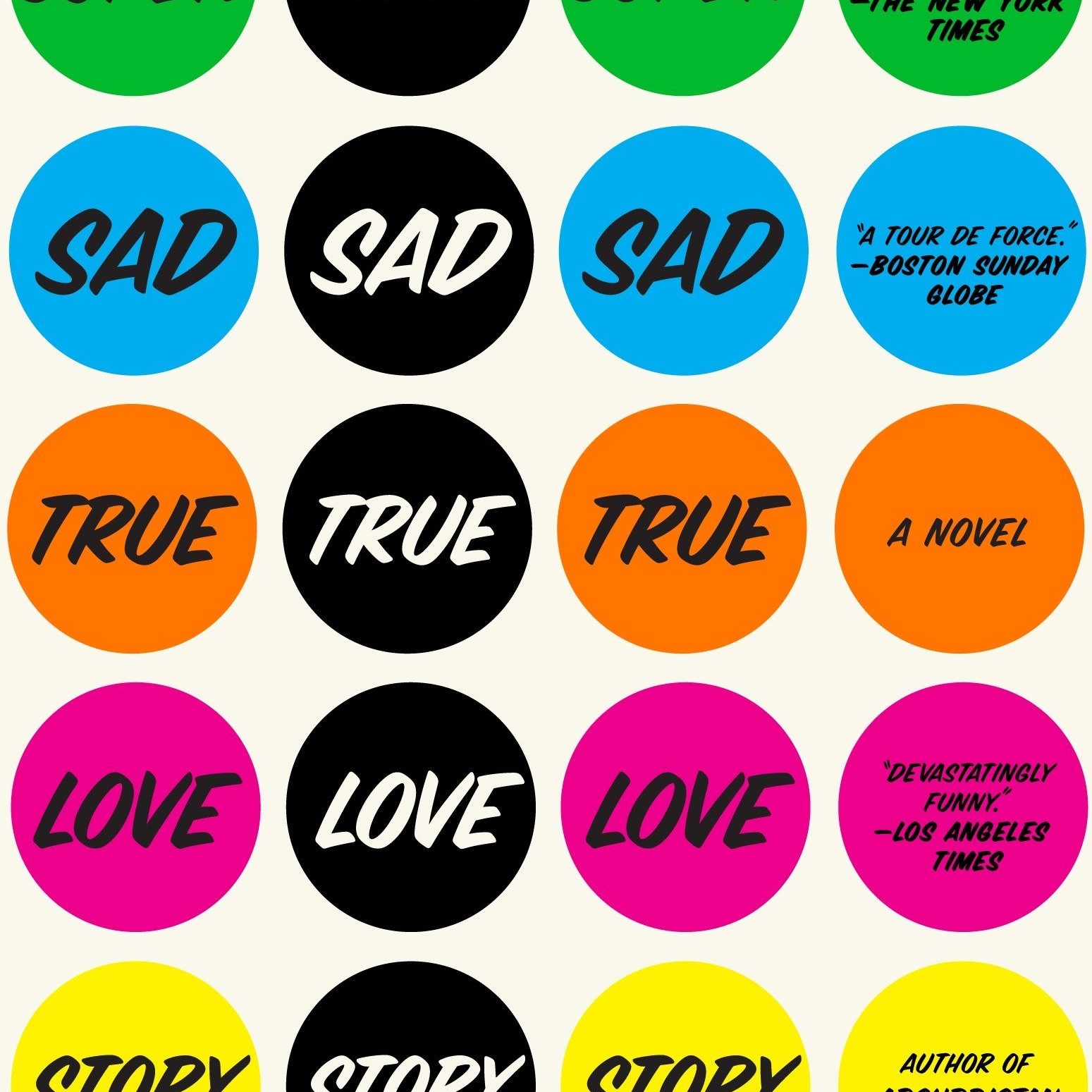
Die Dystopie ist perfekt. Das Repressionsregime einer „Restaurationsregierung“ setzt die Spielregeln der amerikanischen Freiheit mit einem Mix aus Emoji-Regression und Terror außer Kraft. Die Auflösung der US-Verfassung vollzieht sich in Prozessen, die als „Erneuerungen“ deklariert sind. Die Transparenz der Camouflage lässt nichts zu wünschen übrig. Jeder weiß Bescheid. Alle fügen sich. Die Gangster an der Staatsspitze spielen mit offenen Karten.
mehr

„Zu dem Geistigen: Ich denke mir dann immer: haben diese Großen dazu so unerhört viel gelitten, daß heute irgendein Arschgesicht kommt & seine Meinung über sie abgibt.“ Ludwig Wittgenstein, zitiert nach Peter Sloterdijk, „Wer noch kein Grau gedacht hat: Eine Farbenlehre“
mehr
Angeblich sagen uns chemosensorische Reize, die unbewusst wahrgenommen werden, wo es langgeht. Gestern fragte Annette, ob wir alles gemacht hätten. Alle Stellungspunkte abgehakt. Dass kein unerfüllter Rest da bleibt, wo Vollständigkeit einfach und preiswert herzustellen ist.
mehr
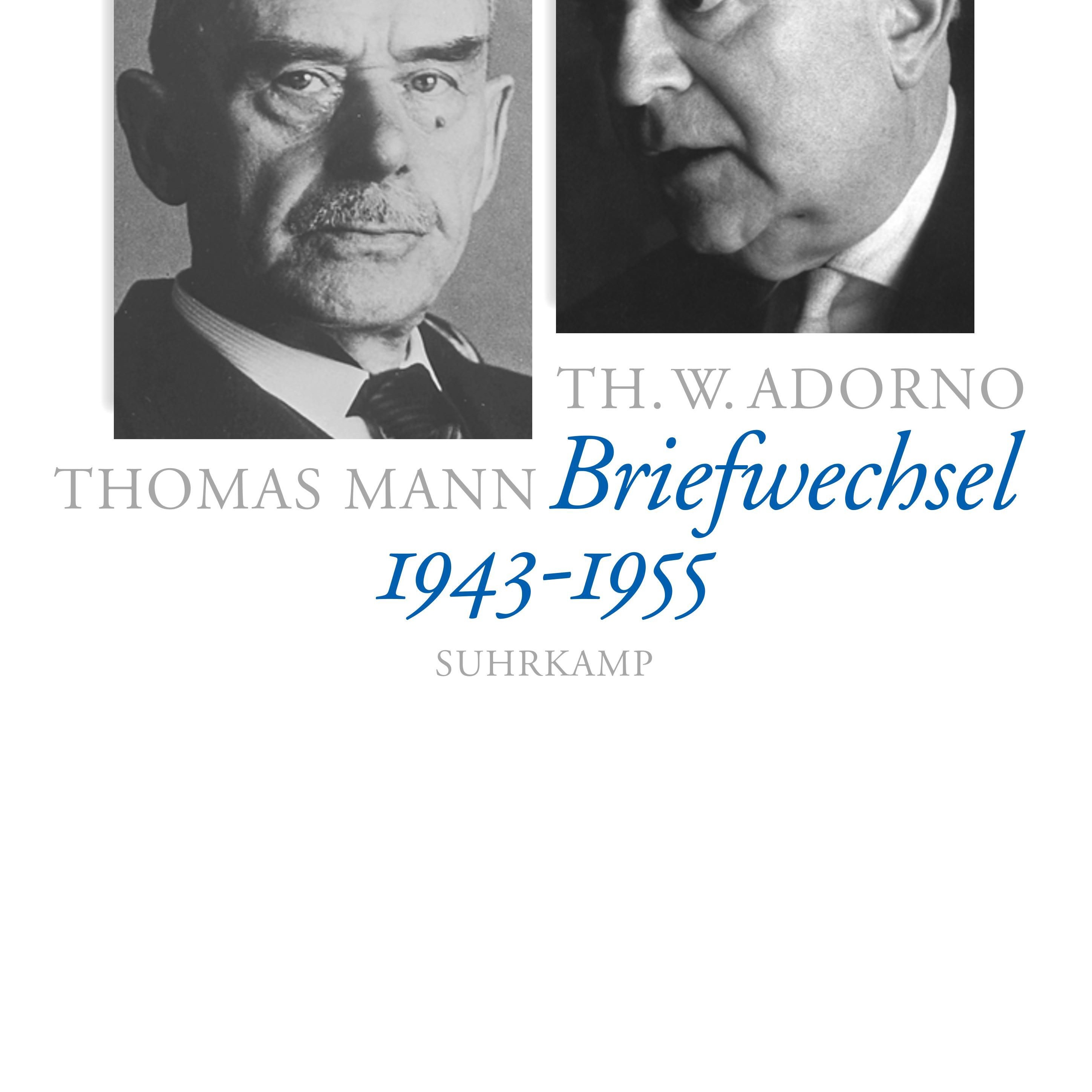
Bereits im Dezember 1949 beschreibt Adorno in einem Brief an Thomas Mann, was seither das ‚Gedächtnistheater‘ als einer deutschen Veranstaltung bestimmt. „Eigentümlich amorph“ seien die Darstellungen der in Nürnberg vor Gericht gestellten Täter:innen. Die Schuld rinne „ins Wesenlose“.
mehr
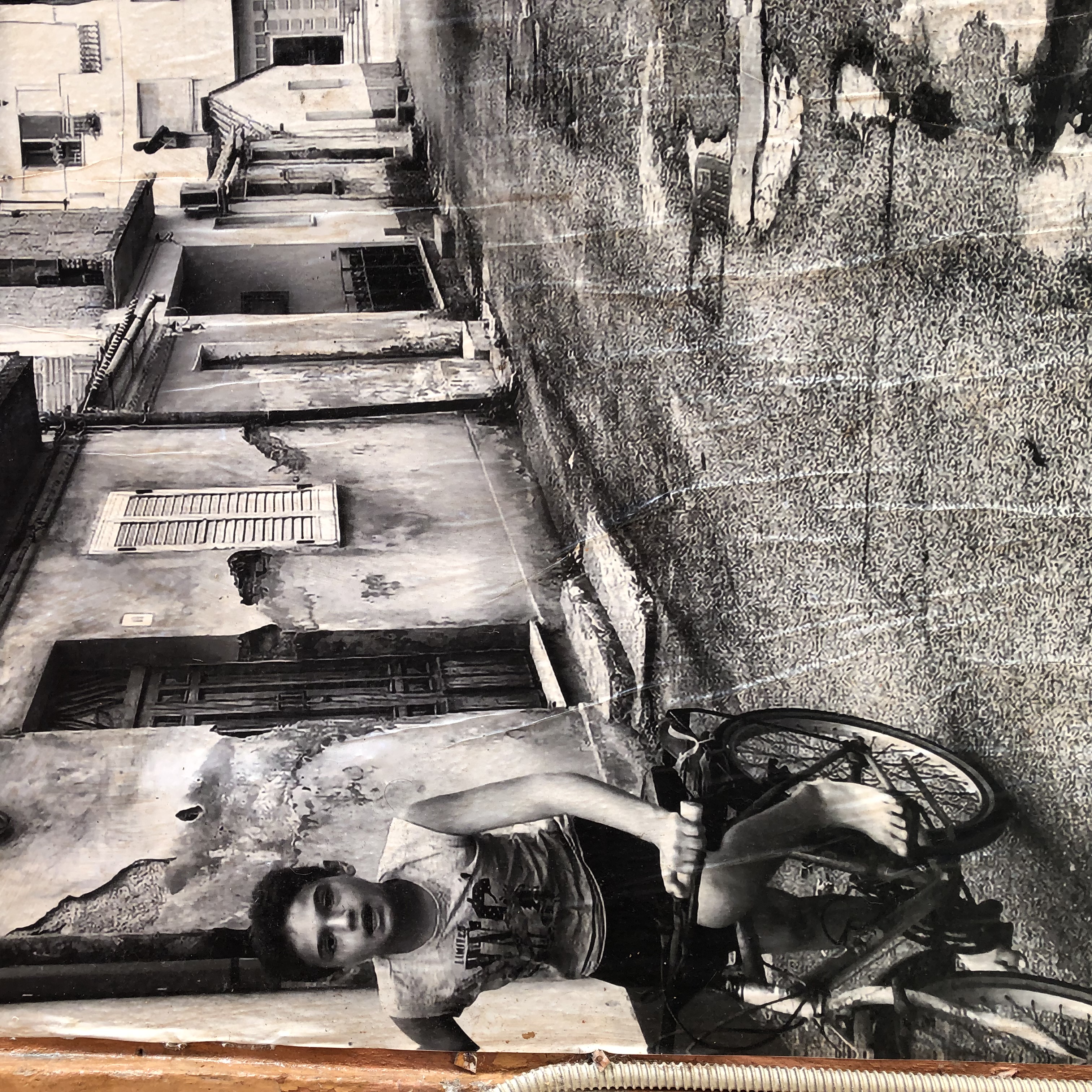
Auf der bolivianischen Altiplano-Hochebene drängt Wasser durch Gesteinsrisse, dessen chemische Signatur seine pazifische Herkunft verrät. Der stille Ozean unterspült die amerikanische Landmasse, steigt vierhundert Kilometer hinter der Küstenlinie auf und tritt in einer vom Bergbau versehrten Landschaft zu Tage. Der erdgeschichtliche Vorgang im Dunstkreis einer Subduktion bietet sich eskapistischen Analogien an.
mehr
Zwei Euro kostet der Wein in einer arabischen Bude. Schön ist die Bedienung mit dem braunen Gesicht. In ihren Bewegungen: bezwungene Trägheit. In ihren Wüstenaugen: vergatterte Melancholie. Der Grandseigneur am Katzentisch vor dem Klo, mit Einstecktuch, im Kreis gereifter Hippiedamen, hypostasiert einen obsoleten Kulturbegriff.
mehr

Auf einer Tiberbrücke spielte ein Straßenmusiker “Shine On You Crazy Diamond” so inbrünstig, dass sich Clarke in seine Jugend zurückversetzt fühlte. Mit Anfang zwanzig war er zum ersten Mal in Rom gewesen.
mehr
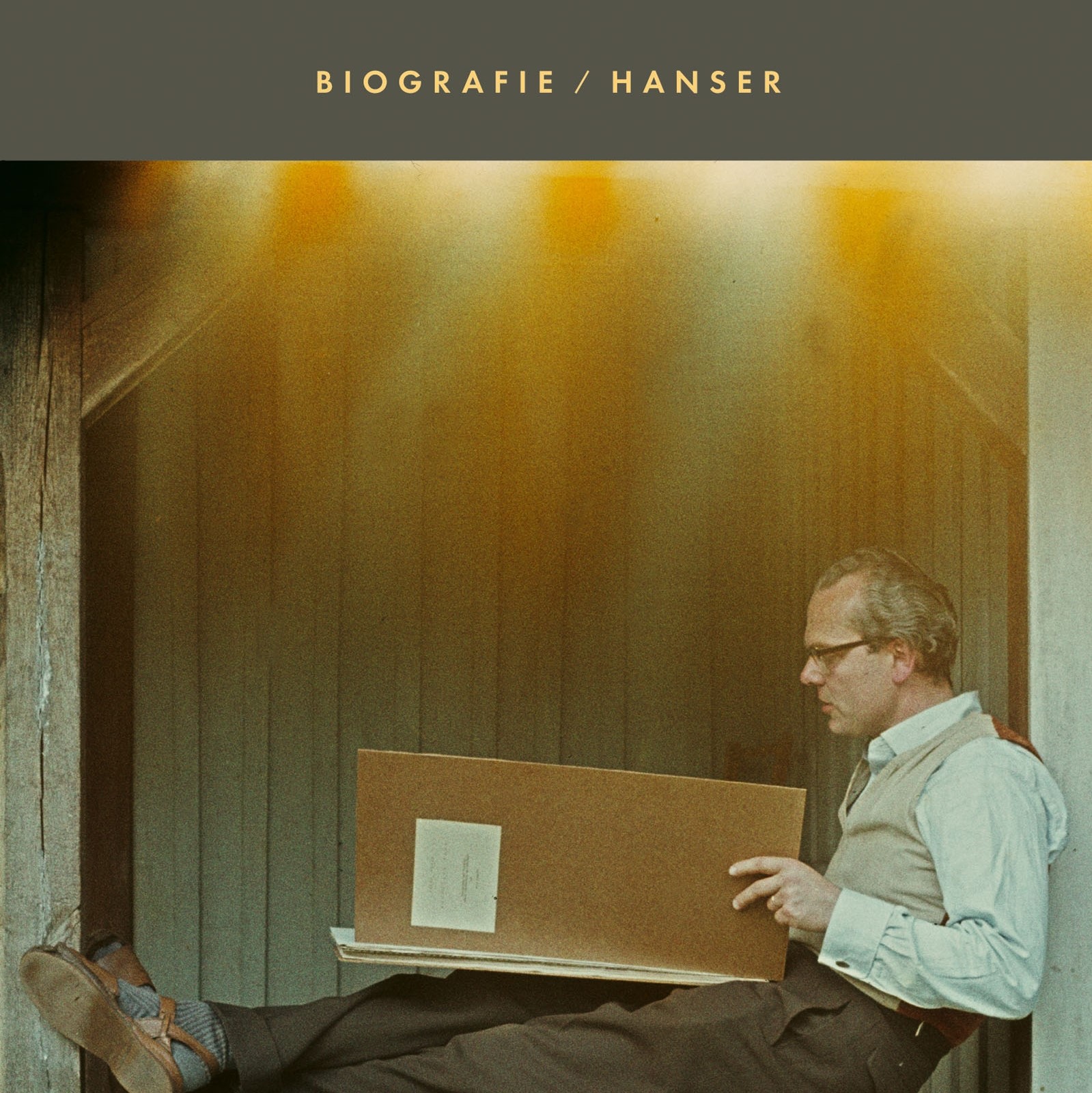
1959 widmet der SPIEGEL Arno Schmidt eine Titelgeschichte. Man zitiert den Autor mit den Worten „Goethes Prosa ist eine Rumpelkiste“. Da lebt Schmidt schon in Bargfeld; endlich angekommen im eigenen Haus mit Garten und einer, den Schriftsteller ansprechenden Umgebung, die er als „Parklandschaft“ charakterisiert. „Still und stilvoll“ finden die Schmidts ihre endgültige und endlich auch legendäre Bleibe.
mehr
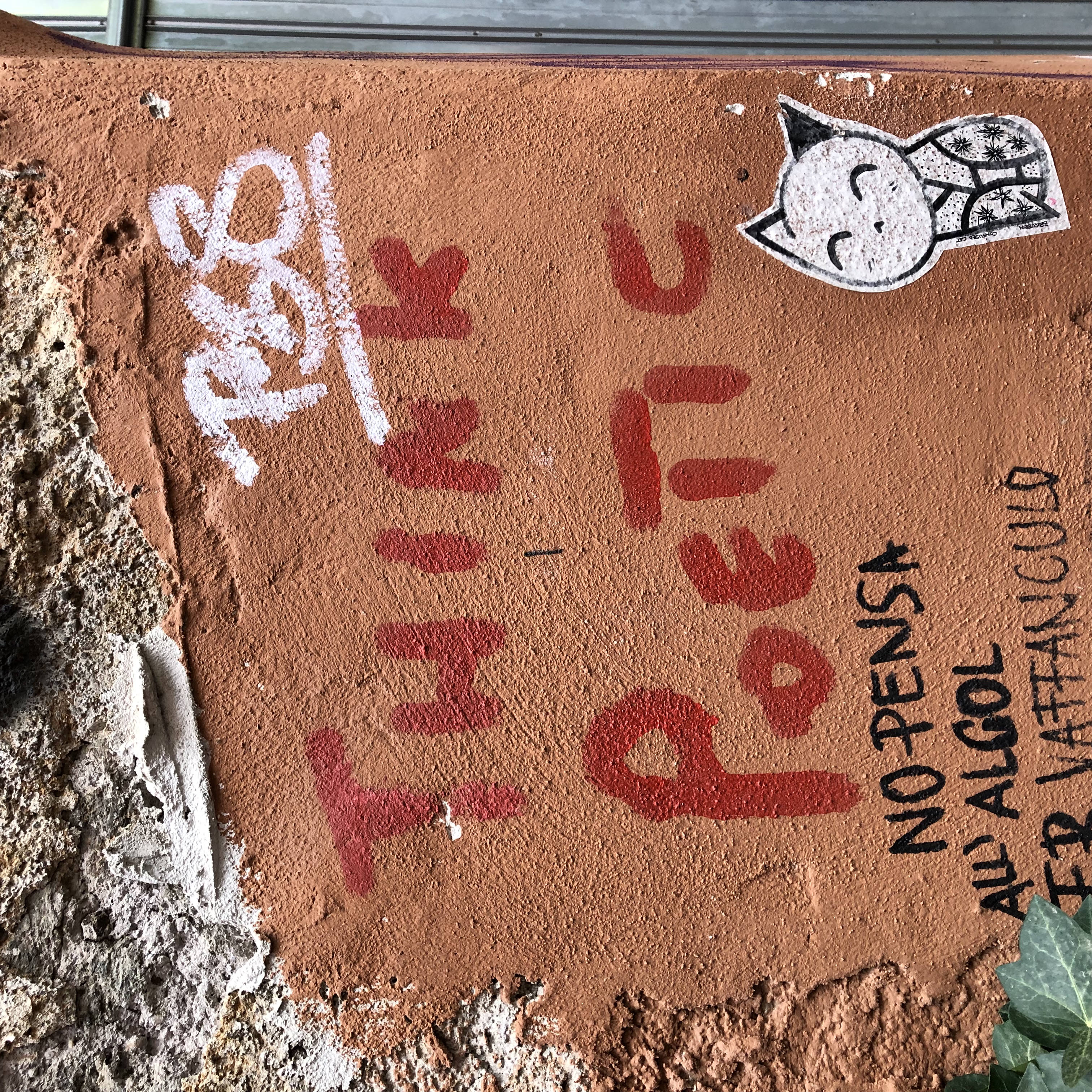
Die springenden Punkte der Stadt stellen Gegensätze aus. Aus der Energie konkurrierender Interessen entstehen Strukturen mit phantastischem Transformationspotential. Sie lassen sich wie Kunstwerke anschauen.
mehr
Der Priester bleibt aus. Der Fernseher lässt sich nicht einschalten. Nachts führt mich eine Wärterin zu einem Saal. Ein Abschlussball könnte darin stattfinden. In einem Alkoven bemerke ich drei Männer. Zwei liegen ramponiert auf den Knien. Ich ahne stumme Bewegungen an dunklen Rändern.
mehr
Die Ästhetik war „Außer Atem“. Thomas Brasch (1945 - 2001) trieb die Abgrenzung bis zur Pose und schrieb Gedichte für die Köchin im Ganymed bei Gelegenheit. Dann schrie er aus dem Fenster seinen Verdruss. Das hörte man nebenan, wo das Berliner Ensemble ist. Das Ende im Blick vor dem Anfang: Das ist das erste Gesicht der Gedichte von Thomas Brasch. Der Fatalismus der Geschichte summt darin sein Lied vom Sozialismus. Der Kampf geht immer nur „um eine Niederlage“.
mehr
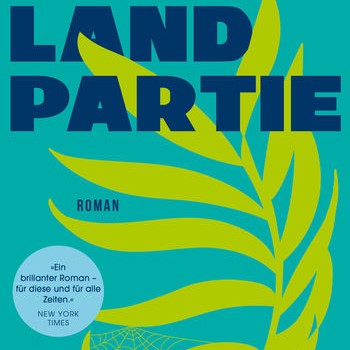
Dee Cameron erscheint, wie vom Zauberstab einer guten Fee berührt. Mit ihr endet eine transgenerationale Talfahrt. In einem Aufsatz, der das abgeflaute Interesse an ihrem hochgejazzten Romandebüt dosiert provokativ wieder anheizen sollte, zählte Dee jene aus North und South Carolina stammenden Versager auf, denen sie nachkommt. Stichworte des Desasters: White Trash. Trailer Park. Rednecks & Hillbillys.
mehr
„Lessing war der erste freie Schriftsteller … weil er Pech gehabt hat.“ Pech heißt: keine Anstellung. Heiner Müller fühlt mit Lessing, er nennt ihn ein „Vorbild“ und sich tapfer, indem er Lessing Mut zuspricht. Er hält die Zigarre zwischen sich und die Welt, er ist ein Echo der DDR. In einem futuristischen Einst wird das Beste an der DDR ein Heiner-Müller-Echo sein. Doch jetzt sind ihre Irrtümer seine Chancen.
mehr
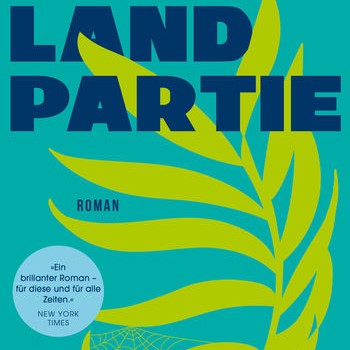
Der Autor variiert einen Höhepunkt der Renaissance. Gary Shteyngart bezieht sich auf die Novellensammlung „Decamerone“. Giovanni Boccaccio erklärte ein Landhaus (das noch steht) vor Florenz zum Schauplatz einer Begegnung Heimgesuchter anno 1348. Sieben Frauen und drei Männer sind vor der Pest in die toskanischen Highlands geflüchtet. Angehoben von Sommerfrische-Empfindungen und gedämpft von Angst stellen sie die Gegenwärtigkeit eines schrecklichen Todes in den Glanzschatten der Erzählkunst.
mehr

Heiner Müller erklärt Braschs „Land-Wechsel“ 1977: „Die Generation der heute Dreißigjährigen in der DDR hat den Sozialismus nicht als Hoffnung auf das Andere erfahren, sondern als deformierte Realität. Nicht das Drama des Zweiten Weltkriegs, sondern die Farce der Stellvertreterkriege (gegen Jazz und Ringelsocken). Nicht die wirklichen Klassenkämpfe, sondern ihr Pathos.“
mehr
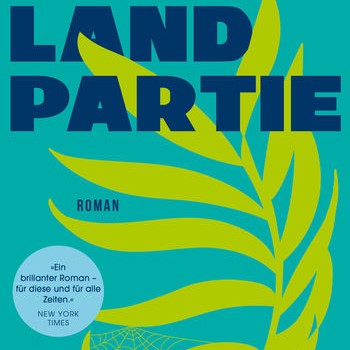
In seinem Garten gibt er der Natur Raum. Organisatorische Defizite und weitere menschliche Trägheitsmomente begünstigen pazifischen Wildwuchs. Der Hausherr süßt das Manko mit dem Zucker klimagerechter Floskeln. Das hält Alexander Borisovich Levin-Senderovsky, kurz Sasha, nicht davon ab, wie ein Henker Auto zu fahren.
mehr

In der Hochzeit der Barrikaden, Kaufhausbrände und Puddingattentate macht die schweigende Mehrheit Kulturrevolution. Im Oktober Neunundsechzig wählen Deutsche den ersten sozialdemokratischen Kanzler seit 1930. Die Zeit der parlamentarischen Langeweile ist vorbei, als sich dreißig Abgeordnete der „Pünktchenpartei“ FDP zur SPD schlagen. SDS-Vorsteher Hans-Jürgen Krahl kommentiert den Brandt im Kanzleramt.
mehr
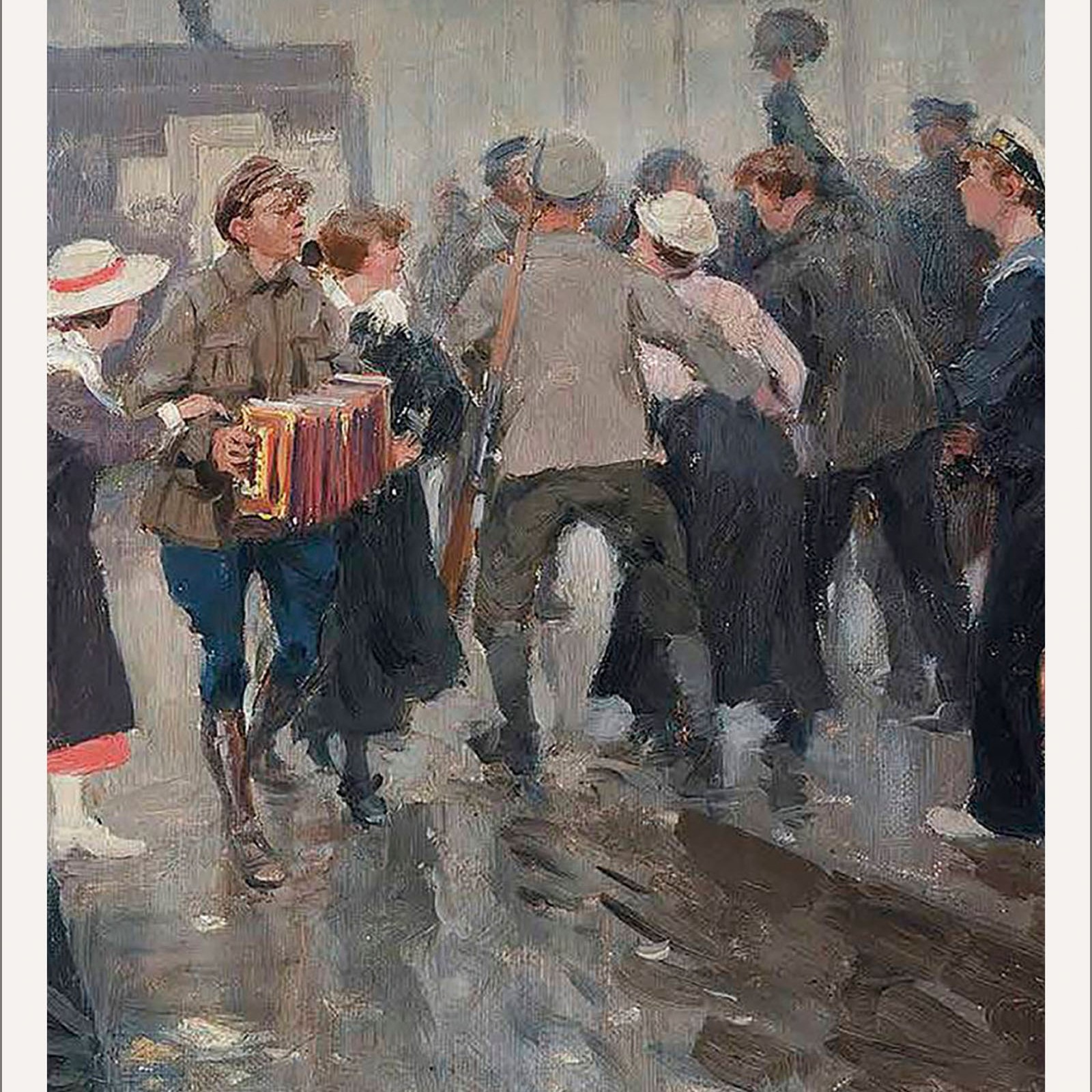
Wie ein Kriegsberichterstatter unserer Tage schildert der sowjetische Propagandist Isaak Babel die Pulverisierung der Ukraine vor 102 Jahren im Sommer 1920 im Polnisch-Sowjetischen Krieg (1919 - 1921). Seelisch erfroren durchstreift der Chronist das Grauen. Ein privilegiertes, seinem Auftrag vollkommen entfremdetes, das eigene Überleben beklagende Gespenst verlangt von sich, Zeugnis abzulegen. Mit James Joyce könnte es sagen: “Write it, damn you, write it! What else are you good for?”
mehr

Mit dem Verkauf von Haddekuche bestreiten sie ihren Lebensunterhalt. Sie bieten Gebäck in Gaststätten an. Ihre Auftritte suggerieren eine Tradition von hundert Jahren. In Wahrheit stammt die Figur der fliegenden Backwarenbornheimerin aus Daseinssümpfen der Siebzigerjahre. Von der Pleite bedrohte Musikerinnen und andere Kneipenexistenzen retteten sich zu einer erfundenen Folklore.
mehr
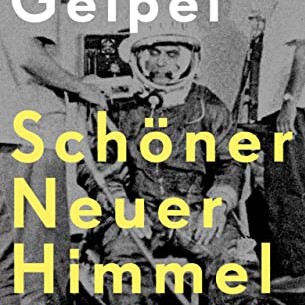
Der Vater war eine HVA-Leuchte, Kundschafter des Friedens, „Westagent mit acht verschiedenen Identitäten“; ein Mann des Militärisch-Industriellen Komplexes (MIK). Darin denkt die Autorin, während eine anonyme Drohung mit dem Absender unknownsoldier@ ihre Nervenstränge vibrieren lässt. Die Angst assoziiert sich mit den „Nebelbildern von Gerhard Richter“. Ines Geipel variiert und ergänzt Richters Nebelbilder mit „dunklen Nachbildern“.
mehr
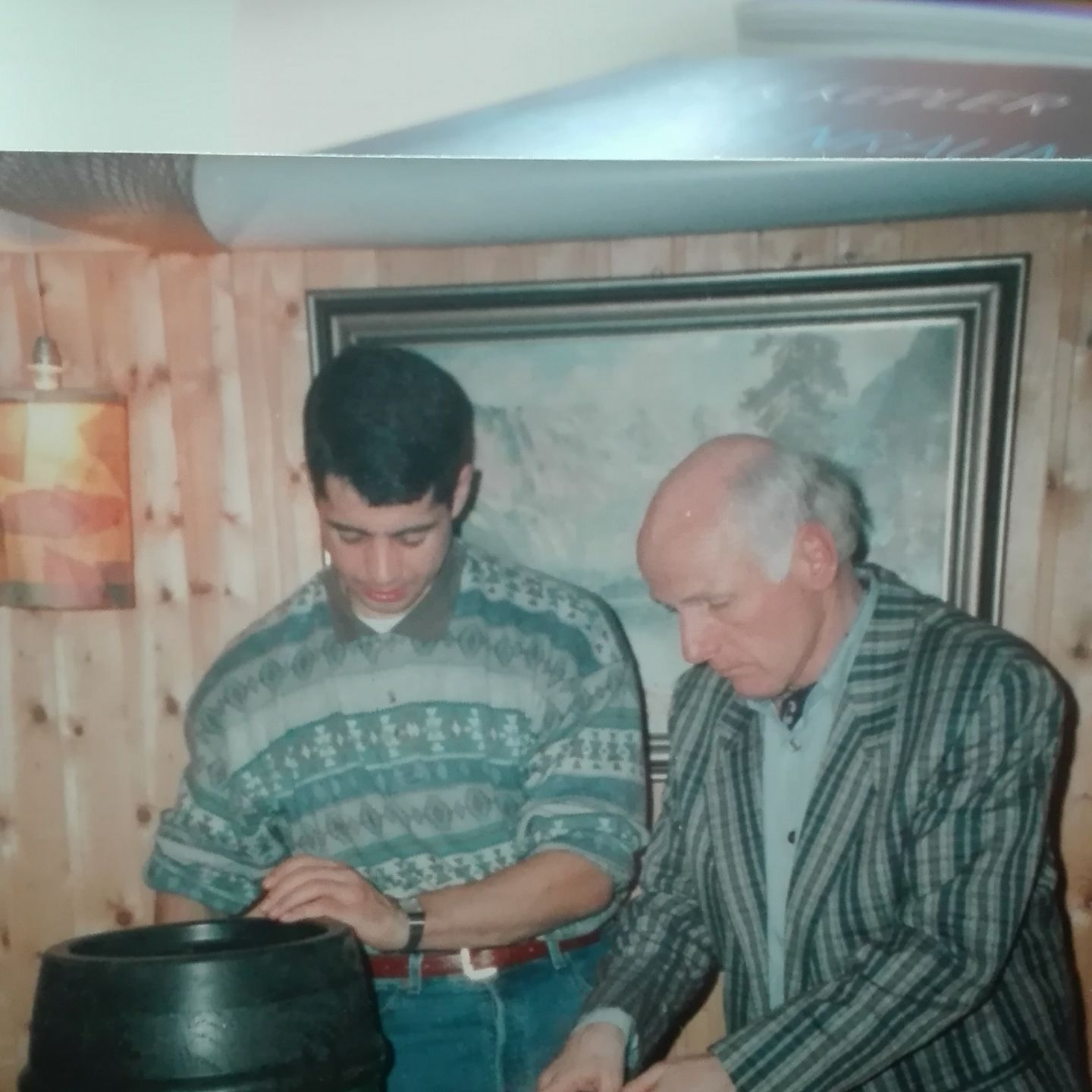
Es war wie heimkommen. Die Kneipe sah so aus wie Kneipen in meiner Kindheit ausgesehen hatten und die Gäste zeigten sich umgänglich und zufrieden. Die Wirtin war eine passionierte Kreuzworträtsellöserin mit Stricknadeln im Haar und Brillenkette. Ich kam ins Gespräch mit Marion und Achim, dem unproblematisch-postproletarischen Pärchen von nebenan. Ich schätzte Achim auf Ende vierzig. Er atmete angestrengt, bewegte sich schwerfällig und wirkte angeschlagen. Marion verkörperte die stille Unverwüstlichkeit ...
mehr
Jonna betrachtet ein Foto, das Thomas Brasch und Charles Bukowski zeigt. Braschs Mimik konserviert ein ungern preisgegebenes Erstaunen darüber, dass Bukowski sich offenbar ernst meint. Gemessen an den Ernsthaftigkeitsfestivals des Ostens kann Brasch Bukowski nur als Farce-Figur wahrnehmen. Das ist nun das, was er nach dem „Landwechsel“ zur Verfügung hat, während Heiner Müller (solange er kann) im Material bleibt.
mehr

Als 1833 in Großbritannien die Sklaverei abgeschafft wurde, fand es die Krone angebracht, die sechsundvierzigtausend Sklavenhalter auf den Inseln ihrer Besorgnis zu entschädigen. Die Kompensationen folgten einem Rechtlichkeitsbegriff, der sich bis heute aus unserem Verständnis nicht verabschiedet hat. Nach Hegel übersteigt das „Dasein des freien Willens“ juristisches Recht.
mehr
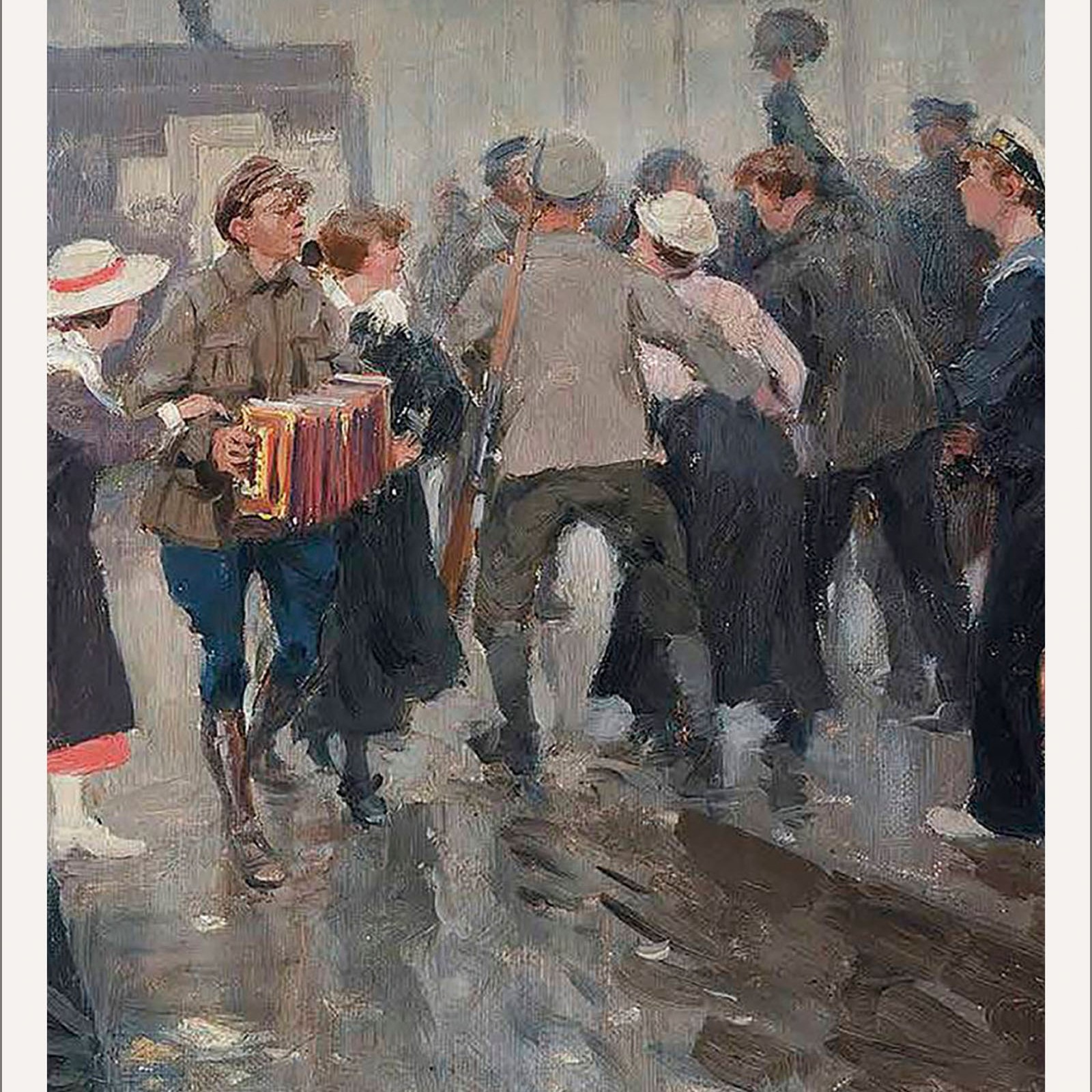
Auf dem Vorhof seines Weltruhms dient Isaak Babel (1894 - 1940) dem Propagandaapparat der blutjungen Sowjetunion. Der Aktivist aus Odessa hält sich für ideologisch feuerfest und wähnt sich zugleich auf einem betonharten Plateau des Zynismus. Babel will der Welt sein naives Gesicht nicht zeigen. Das abgedankte zaristische Personal präsentiert er als Panoptikum „gewesener Menschen (und) Aristokratenratten“.
mehr

Sie schreibt über die Unentbehrlichkeit der Kultur, über himmlische und irdische Liebe, über Interieurs, großen Stil und über die Kostbarkeiten des Lebens. Jonna von Stellberg ergründet die Kunst des Traums, dramatisches und episches Sterben, avantgardistische Lichtmalereien und die Psychologie des Komforts. Aus ihren Kunstkritiken, Feuilletons und Briefen spricht die Großartigkeit in Großbuchstaben.
mehr

Heute gibt es mehr Grenzen als zu den Zeiten der Deutschen Teilung. Der Optimismus des Westens lahmt. Das Vertrauen in die Demokratie sinkt. Der Liberalismus erscheint als kranker Mann am Potomac nicht anders als an der Themse oder Seine oder Spree. Keine Erwartung wurde gründlicher enttäuscht als die Vorstellung, der (ab Neunundachtzig) eingenommene ...
mehr
2002 erzwingt die Schröder-Regierung im Basta-Modus eine Energiekonzernkonzentration und ignoriert dabei Einwände des Bundeskartellamts. Drei Jahre später gründet sich ein russisch-deutsches Joint Venture zum Bau einer Pipeline durch die Ostsee: Nord Stream 1. Kritik der Anrainerstaaten weisen die Initiator:innen des Gazprom-Konsortiums zurück.
mehr
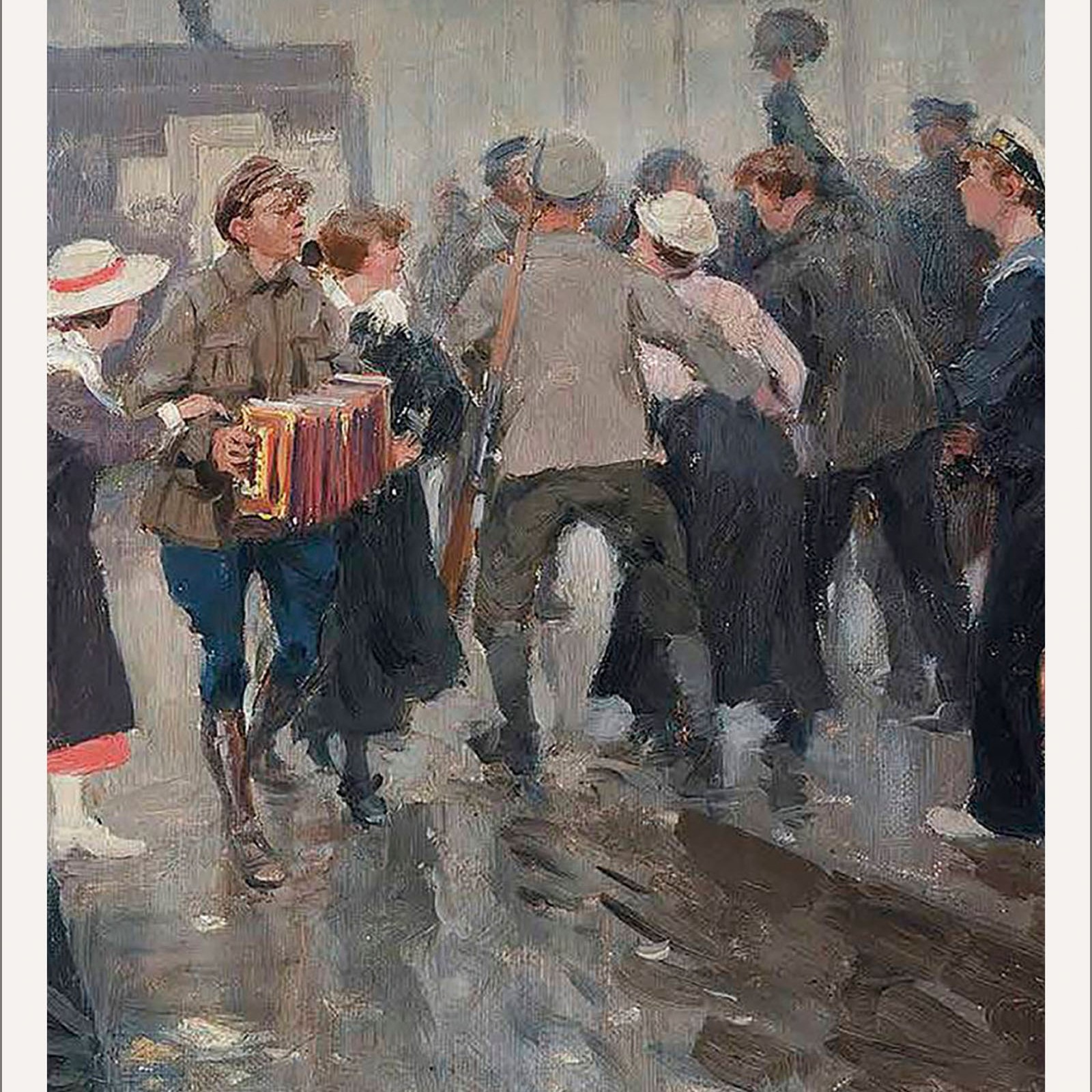
Die Ukraine als Hauptschauplatz eines weitgehend vergessenen Krieges. Als Diarist und sowjetisch-akkreditierter Berichterstatter schildert Isaak Babel 1920 eine geschundene und verschlissene Bevölkerung in einem zugrunde gerichteten Land. Das hätte ich im Januar 2022 noch anders gelesen. Der aktuelle Krieg illustriert ...
mehr

... wie Biermann über Ruth Berlau sprach, die er erst traf, als sie, so sagte er es, „schon ein alkoholisiertes Wrack“ war. „Die alte Frau“ (war) knapp über fünfzig.“ Vor ihrem Fenster stand auf dem Karlsplatz eine von Brecht in die Lyrik gebrachte Pappel. „Der große Lehrer“ hatte Berlau ausgemustert, als er zum Schreiben seiner Stücke keine Zuarbeiterin mehr brauchte, weil er keine Stücke mehr schrieb.
mehr
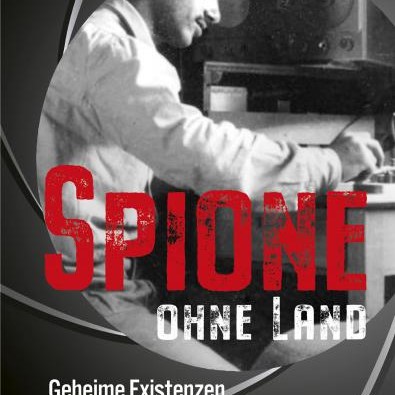
Sie sahen aus wie Araber und sie sprachen arabisch nicht anders als die Mehrheitsgesellschafter in ihren Geburtsorten. Als sich Mizrachim in den 1940er Jahren - im Zuge der israelischen Staatsgründung - für Spionageaufgaben rekrutieren ließen, fehlte ihnen zu einer perfekten Tarnung allein das, was in familiär-muslimischer Beiläufigkeit transferiert wird: religiöse Trivia vom Aberglauben über Verballhornungen ...
mehr

Heiner Müller wusste, dass viele Phänomene seiner Gesellschaft keine Chance hatten, historisch zu werden. Die DDR-Wahrnehmung der Siegerinnen begnügt sich; während wir die amerikanischen Schichten gründlich voneinander scheiden. Jedes Imperium fordert eine Maßstab-bildende Genauigkeit heraus.
mehr

Ich bin früher nicht gern allein aufgewacht. In einer vertrauten Beziehung erschien mir der Morgensex manchmal wie eine Gratismahlzeit, die man nicht ausschlägt, obwohl der Hunger noch gar nicht zurück ist. Heute arbeitet meine Phantasie auch mit post-koitalen Bademantelbilder, die Brigitte Maria Mayer gemacht hat. Man sieht den vom Alter verlangsamten Heiner Müller im Sog der Kraft einer potenten Frau.
mehr
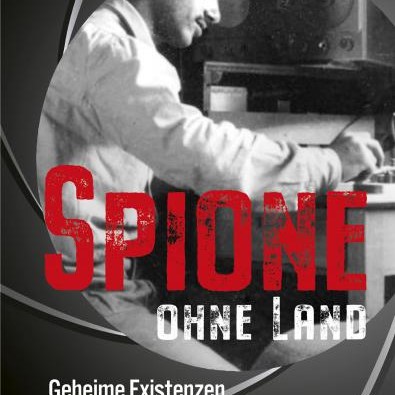
David Ben-Gurion dekretierte: “We must help the British in the war as if there was no White Paper, and we must stand against the ‘White Paper’ as if there was no war”. Seine Mahleket Hashshar-Agenten (ausnahmslos Männer) konspirierten mit einer nahezu perfekten Abdeckung. Die Mista‘aravim gaben sich - in einer abgewandelten Auslegung der ursprünglichen Begriffsbedeutung - als Araber aus. Die bloße Biografie jedes Einzelnen lieferte eine Legende frei Haus.
mehr

Da der Bundespräsident gerade von Putins „Epochenbruch“ sprach: Sich auf Norbert Elias‘ „Prozesse der Zivilisation“ beziehend, meldet Oliver Nachtwey erstaunliche Entzivilisierungsprozesse. Etablierte (Russland) reagieren auf aufsteigende Außenseiter (Ukraine) mit der Preisgabe der eigenen Moralstandards an gröbere Formate. Bei Restaurationsversuchen ihrer Ordnung werden sie zu jenen Barbaren, die sie vor sich zu haben glauben.
mehr
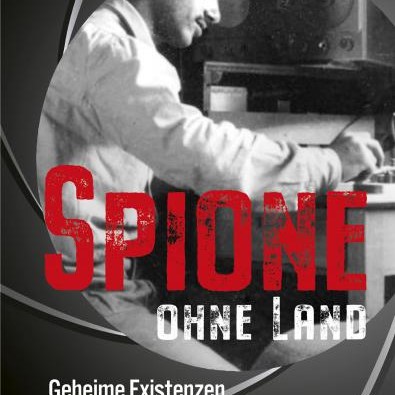
Steckte man jene arabischstämmigen Postmigrant:innen, die bei antisemitischen Umzügen ihren Judenhass herausposaunen, in israelische Uniformen, ergäbe sich kein Momentum der Irritation, solange Schweigen die Verkleideten zierte. In der Frühzeit des israelischen Nachrichtenwesens spielten Akteure der „arabischen Sektion“ auf diesem Klavier. Mizrachim nutzten Chancen doppelter kultureller Auswahl. Mimikry setzten sie als Waffe ein. Sozialisiert in Exklaven arabischer ...
mehr

Seit ein paar Jahre tragen ich gern Nachthemden meiner Stralsunder Großmutter. Die Leinenstücke gehörten zur Aussteuer und stammen aus der Hand einer Greifswalder Weißnäherin. Biesen, Spitzen, Nadelfilets und seidene Einfassungen zieren sie. In der Hochzeitskollektion war auch ein Totenhemd. So praktisch war der Begriff vom Leben.
mehr
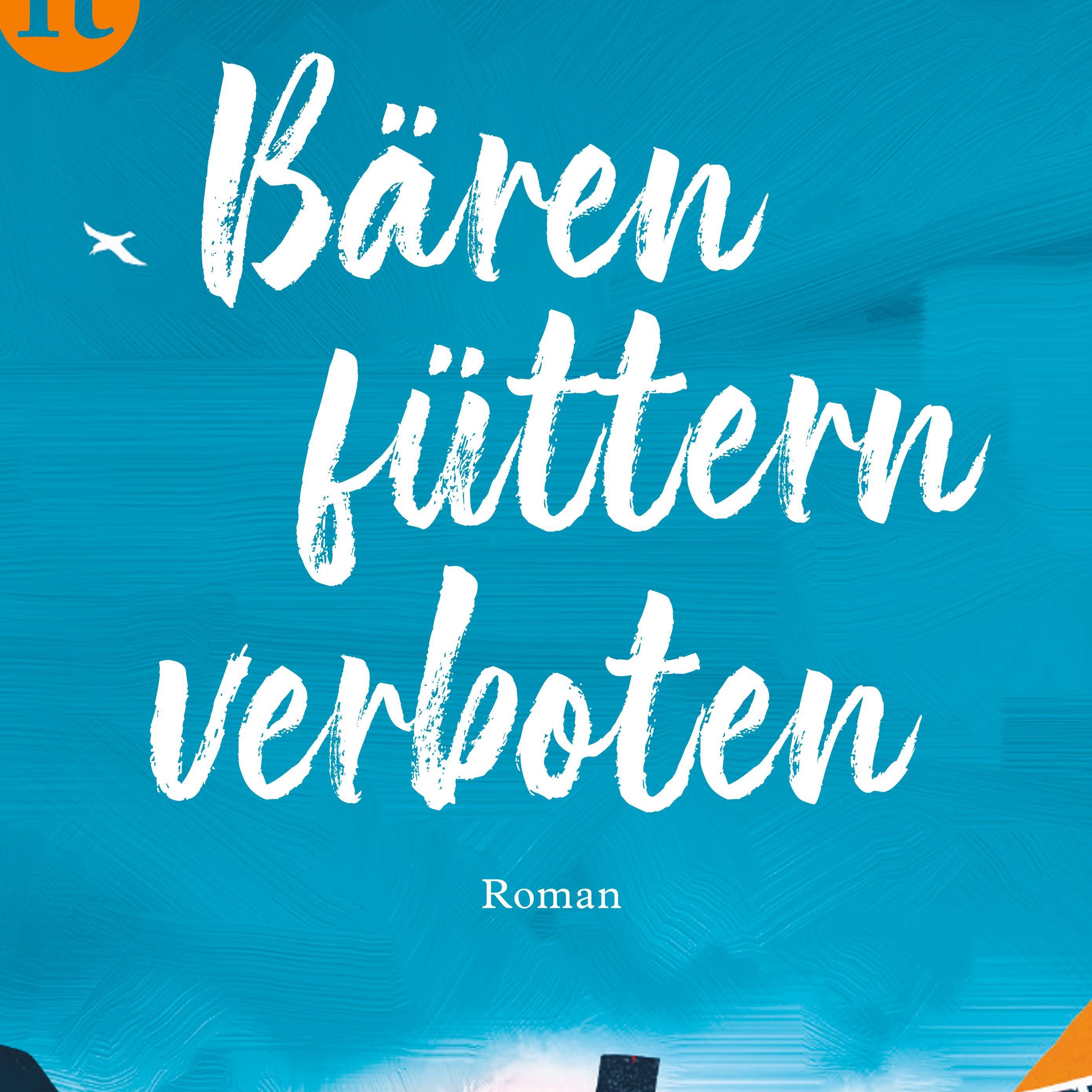
Rachel Elliotts Little Town Blues ist hinreißend koloriert. St Ives liegt in der Grafschaft Cornwall. Die Verhältnisse schillern beschaulich. Das Skurrile dominiert. Belles Trinkkumpane im Black Hole sind alle Mann über sechzig. Dazu passt, dass man sie für eine „alte Seele“ hält.
mehr
Einmal will Brecht die Arbeiterklasse in echt auf die Bühne bringen. Wie geht das? Das geht einfach so, sagt Brecht, dass man der Gewerkschaft Bescheid sagt. So geschieht es. Die Gewerkschaft schickt Arbeiter, mit denen Brecht arbeitet. Um anderen Arbeitern die Arbeiterschauspieler nicht vorzuenthalten, kauft die Gewerkschaft das Premierenkontingent auf und verteilt die Karten. Die Kollegen stecken die Karten ein und verziehen sich in ihre Kneipen. Die Arbeiter auf der Bühne spielen vor einem leeren Saal.
mehr
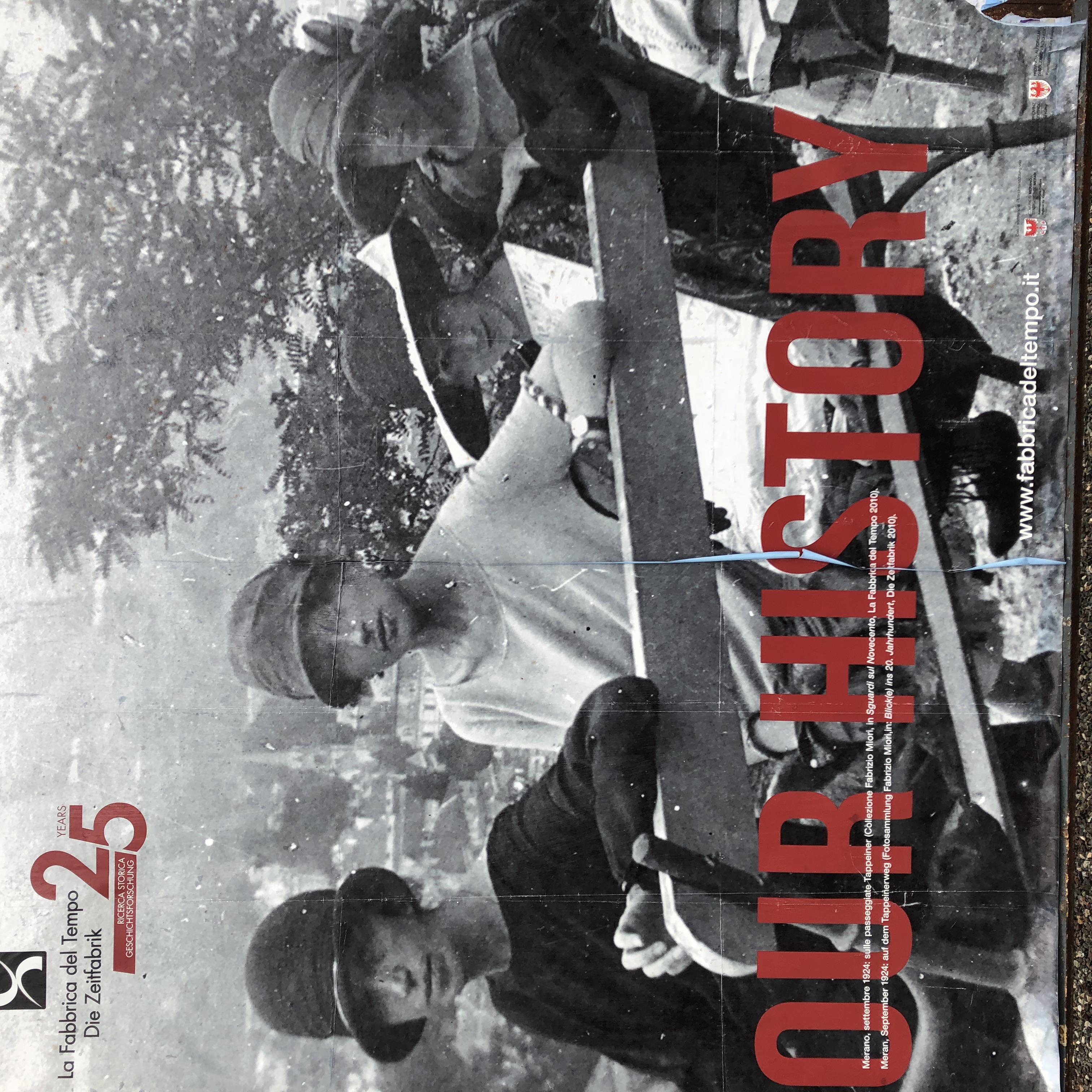
Ivy von Höckelheim ist ein Kind der Nelkenrevolution. Ihre 1979 tödlich verunglückte Mutter entstammte dem zweiten Kreis der alten Macht in Portugal. Sie zählte zum Caetano-Klan, der Salazar beerbte. Lourdes‘ Sympathien gehörten aber der Umsturzgarde. Sie begeisterte jene „fast beunruhigende Leichtigkeit“ (Arnold Hottinger), die den Putsch zu einer europäischen Party machte.
mehr
Hanne Marlow, geborene Schleim, wringt ihr trockenes Haar. Eine Geste der Verzweiflung auf dem Vorfeld von Erosion, Korrosion und Schimmel. Die übelsten Sachen sieht man gar nicht. Man kann sie auch nicht riechen. Aber sie sind da als Lauerjäger in den Größenordnungen der Mikroorganismen. Die chemische Zusammensetzung des Lebens schleift einen Rattenschwanz an Problemen ...
mehr
Mühelos gewann Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj den Kampf um die Köpfe Europas. Ihm gelang es, die Frage ‚Wie hältst du es mit der Ukraine‘ zur Gretchenfrage in jedem Wohnzimmer zu machen. Dies gewiss in der Konsequenz schrecklicher Erfahrungen. 2014 fehlte die Anteilnahme. Die Amputationsschmerzen der ihrer Krim beraubten Ukraine ...
mehr
Über der Wasserlinie verliert der Himmel sein brennendes Morgenrot. Das Formenspiel der Wolken spiegelt sich. Das ist eine Urszene meines Lebens. Solange ich zurückdenken kann, nimmt mein Tag an einem Fenster mit freiem Blick auf den Bodden Gestalt an.
mehr
Er übermalte Postkarten mit Motiven des „Reichsschamhaarmalers“ Adolf Ziegler. Dessen Triptychon „Die vier Elemente“ nahm einen herausragenden Platz in der faschistischen Ikonografie ein, während Willi Baumeister (1889 -1955) im Dritten Reich als „entarteter“ Künstler kursierte. Der Geächtete überzog den Nobilitierten mit Hohn ...
mehr
Der Bodden liegt hinter einem Grauschleier. Ich sehe aus meinem Schlafzimmerfenster, das in grauer Vorzeit der Witwenkammerausguck meiner Großmutter war. Manchmal bilde ich mir ein, Niststellen eines alten Geruchs wahrzunehmen; eine Ahnengrindanhaftung in Gebälkschrunden.
mehr
Der kaum zwanzigjährige Malte Herzog erscheint Jonna von Stellberg auf halber Höhe des Tillwitzer Hausbergs wie in einer Vision. In Jonna geht sofort etwas los. Sie lädt Malte in ihr Skipperhus ein und bewirtet ihn ausführlich. Doch nichts von dem, was Malte seiner Gastgeberin zeigt, erklärt Jonnas eruptive Reaktionen auf den Fremden.
mehr

Ich beende das Schauspiel der vollendeten Gastgeberin. Wenn hier jemand nichts nötig hat, dann bin ich das. Malte schaltet sofort um. So beflissen wie ein Gymnasiast stellt er eine Frage zur Geschichte des Hauses. Bisher war noch jeder Gast bei seinem Antrittsbesuch vom Skipperhus bis zur Betäubung eingenommen. Ich lebe in einem Museum.
mehr
Von Brombeerranken durchzogenes Unterholz schließt den Garten zum Bodden ab. Das Gelände ließ Jonna auf pflegeleicht trimmen. Der Längssaum besteht aus Weiß- und Schlehdorn, Kartoffelrose und Berberitze. Ein paar Beete und Sträucher unterbrechen die Wiesenmonotonie. Dann gibt es noch eine Grill-Sitzecke ...
mehr

Noch in der Nacht der Premiere werden Schauspieler verhört. Man legt ihnen nah, sich mit „der verbrecherischen Regie“ herauszureden. Heiner Müller wirft man „Nihilismus“ und „Schwarzfärberei“ vor, sein Spezi BK Tragelehn fährt zur Bewährung in den Braunkohletagebau ein. „Die Umsiedlerin“ verschwindet in einem Futteral des Schweigens. Erst 1976 inszeniert Fritz Marquardt das Stück als Mumien-Schanz unter dem Titel „Die Bauern“ an der Berliner Volksbühne.
mehr

Jonna hatte von jeher alles. Eine große Familie, ein großes Haus, einen großen Garten, eine praktische Liebe zu Hund und Katze. Ein Händchen für gute Geschäfte und einen Instinkt für das Geistige. In der neuen Zeit zog sie Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen. Selbstverständlich begab sie sich in die Obhut alter HVA-Kämpen. Ostmänner, die ein großes Rad drehen konnten, fanden es angenehm, Jonna behilflich zu sein.
mehr

Flache Wellen treiben gegen das Reet. Der Bodden schimmert smaragdgrün unter seinen Schaumkämmen. Nilgänse weiden einen Anger von Joachim Havemann ab. Die Ägypter kamen im 18. Jahrhundert als Ziergeflügel nach Europa. Vereinzelt fanden sie Zugang zur Freiheit, ohne da große Populationen zu bilden. Erst seit fünfzig Jahren vermehren sie sich wie nach einem Startschuss.
mehr

Bei Arno Schmidt tauchen „begatten“ und „koten“ in einem Satz auf. Da schwingt sich ein Literatur-Tarzan von Ast zu Ast, wenn auch in einem längst vergangenen Präsens. Jonna überlegt, welcher ostdeutsche Schriftsteller der DDR-Schmidt war. Sie verliert den Faden, wie so oft in letzter Zeit. Sie taumelt und trudelt in die Gedankenlosigkeit. Das ist ein gefährlich leerer Raum.
mehr

Die aus Tillwitz an der Ostsee gebürtige, in ihrem Geburtshaus verschwiegen-munter verbliebene Jonna von Stellberg war bis 1990 Kostümbildnerin an einem Rostocker Theater. Sie machte sich dann zweigleisig als Unternehmerin und als DDR-Dramatik-Expertin flott. Ihren Lebensunterhalt bestreitet Jonna mit Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen ...
mehr

Ich mag keinen 60plus-Galgenhumor. Ich will keine feuerfeste Nussknackerin im Rosenzuchtrausch sein. Mir graut vor dem Typus der unverwüstlichen Provinzpatrona in der Spielart einer vorpommerischen Best-Ager-Pomeranze.
mehr

Was gab es noch? Regina Halmich, das Ozonloch, im Kinderkrankenhaus von Saporischschja fehlte es von Einweghandschuhen über Zahnbürsten bis zu Desinfektionsmitteln an allem. Chefärztin Daryna Witalijiwna Poroschenko wandte sich an Karl May, der hatte schon mal geholfen.
mehr
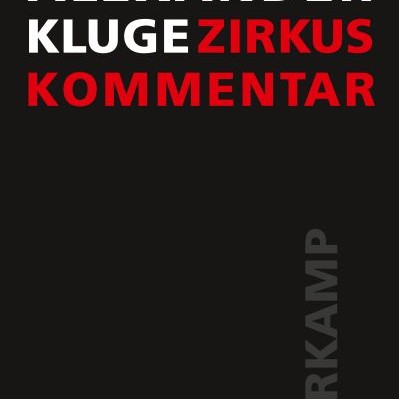
Das Ende naht in jedem Augenblick. Ein „wütendes Stück Natur (in der Preisklasse) eines Wolfsrudels (oder eines) Schneesturms“ kann den Steinzeitjäger aus dem Rennen nehmen. Dessen Kompetenz kulminiert in zwei Fähigkeiten: der Vorausschau und der Ausdauer. Alexander Kluge unterstellt dem Versprengten eine stumme Grammatik.
mehr
„Aus dem Ruf nach mehr Freiheit wird der Schrei nach dem Sturz der Regierung“, heißt es nach ein paar Stunden „Hamlet“. Im Erfahrungsdruck kondensiert der Text. Müller arbeitet mit seiner eigenen Übersetzung. Geprobt wurde „Hamlet“ noch unter Honecker, gespielt wird nach dem Abgang der Gerusia. Die politischen Ereignisse erreichen Höhen des elisabethanischen Theaters. Müller: „Solange Shakespeare unsere Stücke schreibt.“
mehr
Auch Heiner Müller hatte einen sozialdemokratischen Vater, dem Schwerstes zugemutet wurde; so dass er dem Sohn schwach erschien. Der schwache Vater ist eine Erfahrung, die zur Chiffre wird. Heiner Müller verkennt vorsätzlich Machtverhältnisse ...
mehr

Ständig zündete sich jemand eine Zigarette an. Müller rauchte Zigarre. Er inszenierte am Schauspiel und lud mich in den Frankfurter Hof ein.
„Allein gelassen schien er schmal wie ein Kind in der Fremde“, sagt Strittmatter über Brecht. Ich sah so Müller in Frankfurt. Er schenkte mir den „Fremden Freund“ („Drachenblut“).
mehr
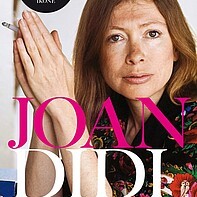
Die Frage nach der „richtigen“ Universität stellt sich nicht. Die „soziale Stellung“ der Familie ist „stabil“. Die Tochter muss zum Gedeihen ihrer Herkunftszelle nicht mehr beitragen als die Früchte eines unbeschwerten Gemüts. Der Aufstieg war das Werk vorangegangener Generationen. In der Gegenwart warnt kein Zeichen vor dem Abstieg.
mehr
Brecht verstand Baal als einen, der besingt den Sommer im Herbst und nimmt sein Publikum wie es kommt. Seine Abrichtung war ein Schlag ins Wasser. Ungebrochen wird er zur Zumutung für die Gemäßigten in ihren Käfigen der Zivilisation. Baal schlägt seinen Freund Ekart tot. Räudig schleicht er um die Ecken.
mehr

Vespucci und Caminha sahen Brasilien, das damals Vera Cruz hieß, bevor der Rummel los ging. Caminha beobachtete „die reichste Stromentwicklung der Welt“. Prächtige Wasserläufe erinnerten ihn an biblische Paradiesschilderungen. Zugleich erkannte er die Bedeutung dieser Straßen für den Welthandel.
mehr

Inge und Klaus Schneider unterhielten im Auftrag der Staatssicherheit einen literarischen Salon im Bezirk Prenzlauer Berg. Inge umgarnte Intellektuelle und Künstler mit entgegenkommendem Betragen, obwohl sie in ihrem Herzen einen gewaltigen Groll gegen Häretiker hegte. Jede Abweichung von der reinen Lehre war für sie Verrat.
mehr

Auch in Brechts „Trommeln in der Nacht“ kehrt einer heim, sein Trauma, der Maschinenkrieg, spielt keine Rolle in der maroden Herkunftswelt. Das muss für Soldaten Science-Fiction gewesen sein: die Materialschlachten und Gasmasken und neuen Geistesstörungen. Sie kamen aus einer Welt kaiserlicher Kavallerie und fußkranker Infanterie in ein technisches, wie von Ufo-Besatzungen angerichtetes Inferno ...
mehr

Beaumarchais´ „Figaro“ hatte seine Uraufführung 1783 als Privatveranstaltung mit dreihundert Gästen. Nach Sainte-Beuve „klatschten sie dem Beifall, was sie zugrunde richtete“. Wir, die wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, erkennen darin das Schicksal des Kapitalismus.
mehr
Marie will die Vorhänge nicht zugezogen, sie findet es schön, sich vorzustellen, dass einer zuguckt. Egal wer. In ihrer Phantasie läuft immer eine Kamera und begleitet sie sogar aufs Klo. Ist das schon Exhibitionismus oder nicht noch gesunde Eigenliebe? Tillmann vertieft lieber nichts. Nichts wissen will er vom Kniest, der sich überall einlagert und festsetzt.
mehr
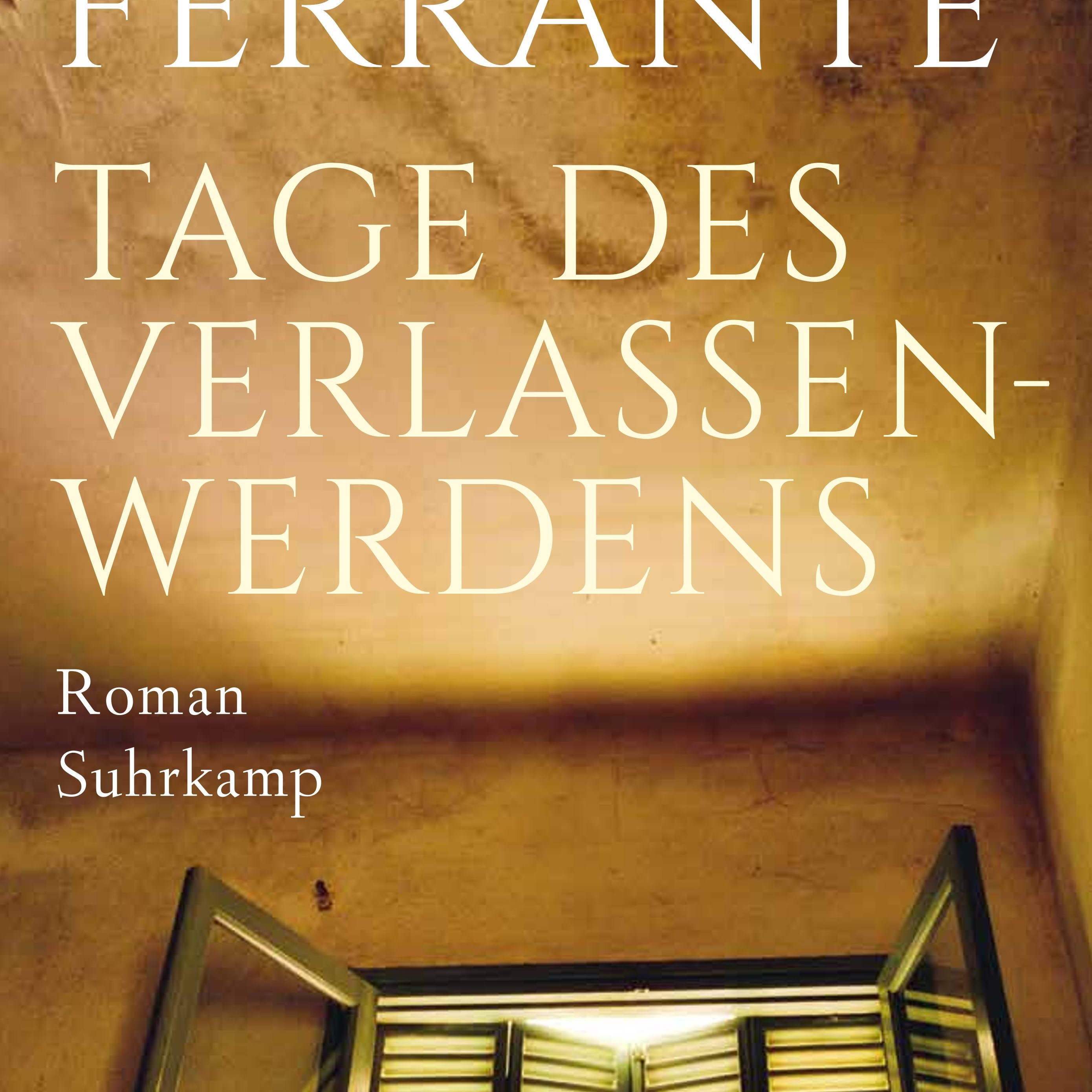
In der frühen Handlungsgegenwart lebt Olga in Turin. Sie verzichtet darauf, ihrem literarischen Ehrgeiz zu genügen. Das Regime der schwindenden Kräfte hat sie schon am Haken. Wahrnehmen lässt sie sich als Ehefrau und Mutter. Zum Haushalt gehört ein läppischer Schäferhund namens Otto.
mehr

Es gibt die Feststellung: „Bis ‘61 waren die Konflikte unmittelbarer.“ Die Gedichte aus dem Nachlass, die bis einundsechzig entstehen, soweit Müllers eigenwillige Datierungspolitik korrekte Zeitangaben zulässt, stehen im Zeichen des sozialistischen Realismus.
mehr
Das Dorf war fast ausgestorben. Ein paar Uralte saßen vor einer neorealistisch-tristen Bushaltestelle, aber in den zwei Wochen meines Aufenthalts sah ich nie ein öffentliches Verkehrsfahrzeug. Ab und zu bretterte ein Pritschenwagen durch, und einmal am Tag hielt ein Tankzug, der die Letzten mit Wasser versorgte.
mehr
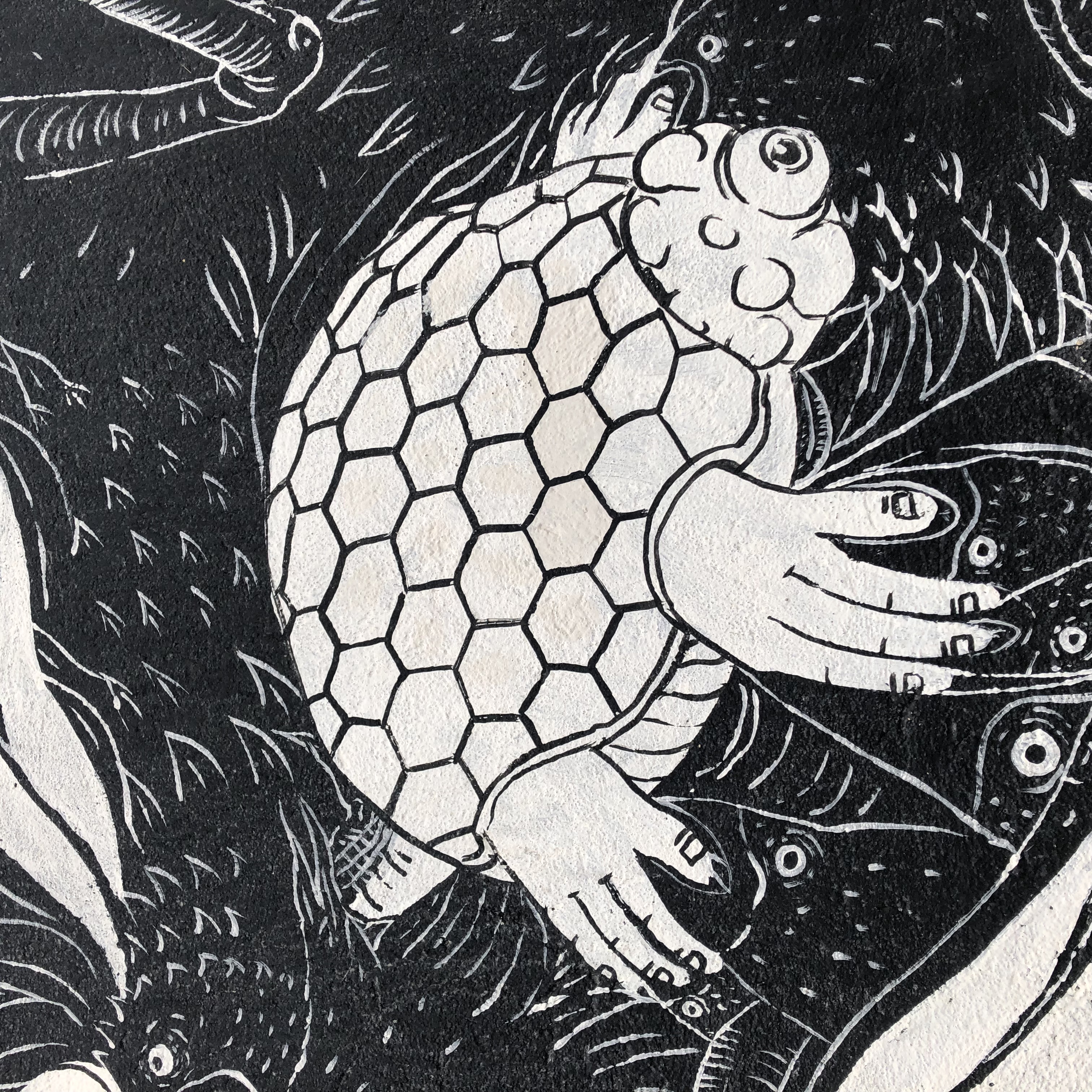
Wem was gehört: das war die entscheidende Frage im alten Nordend. Das entschied, wer wen heiratete. Ja, es ging bei uns zu wie im Orient. Wir waren Protestanten und diskriminierten die Katholiken, die aber über eigene Bastionen verfügten.
mehr
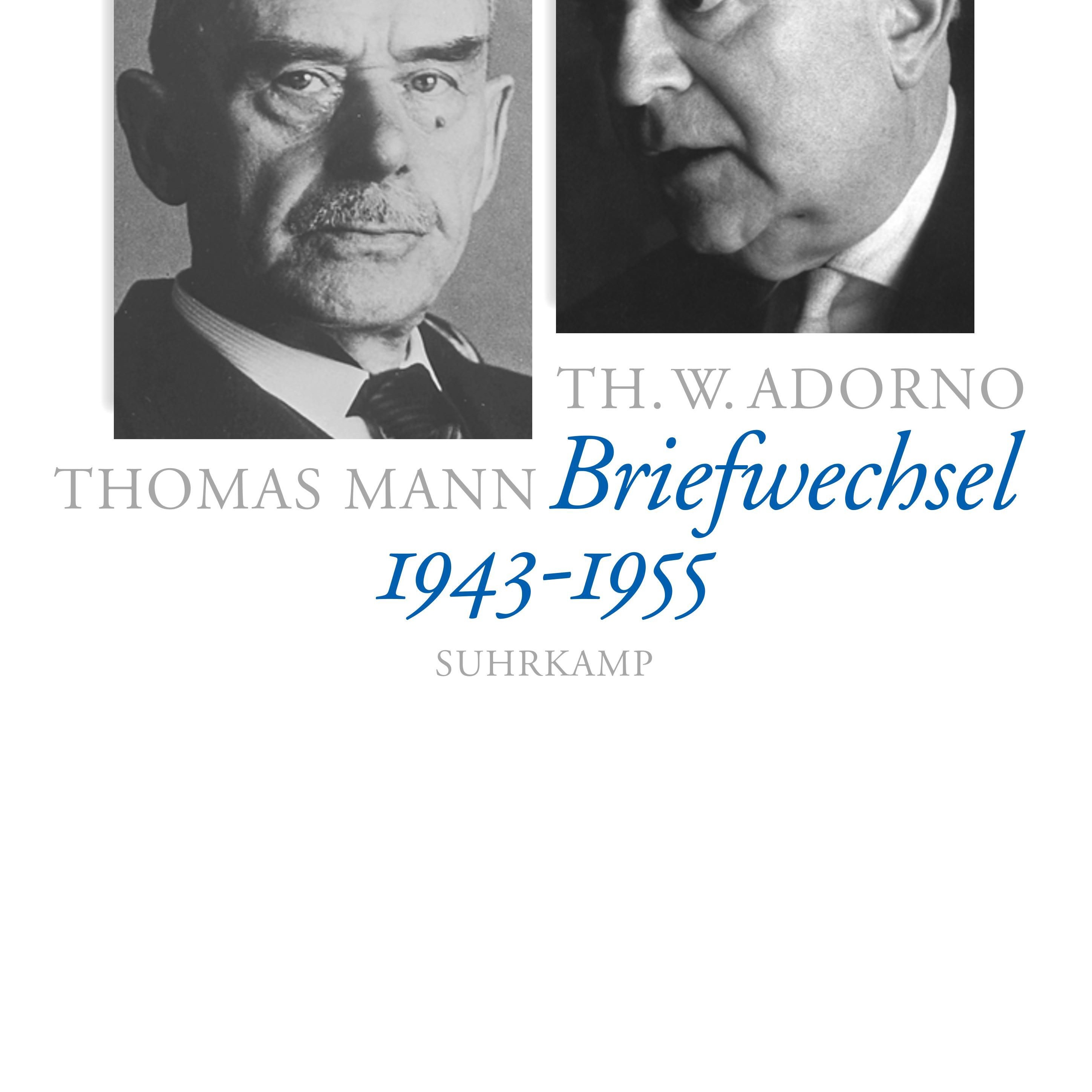
Er weiß sich so selten nicht „bei bestem Wohlsein“. Der Schriftsteller hebt sich als ein „von Gott langatmig geschaffener“ apollinischer Akteur hervor. Thomas Mann steht mit siebzig fest im Fleisch. In Kalifornien feiert er, nach lauter Bestätigungen seiner Ausnahmestellung, nicht bloß die Magie des Erzählens, sondern überdies sich als Magier.
mehr

Während lange die Vorstellung vorherrschte, der Westen habe Neunundachtzig gesiegt und nötige seither die Welt mit ihm Schritt zu halten (Francis Fukuyama), gibt sich nicht erst seit gestern das Gegenteil zu erkennen. Unter Druck geratene Demokratien experimentieren mit den Möglichkeiten der Einschränkung von Freiheitsrechten und ernten für Repressionen und Regressionen ausreichend Zustimmung.
mehr
Dass sich Mary Ruefles auf Clarice Lispector bezieht, passt zu den säkularen Epiphanien der Altmeisterin. Das Episodische, Flüchtige und Vergebliche dominiert in jedem Fall. Ruefles Miniaturen erfüllen nicht unbedingt die Funktionen poetischer Kleinode. Sie sind vielmehr Kassiber befremdlicher Botschaften, die wiederum als Echo eines Befremdens ankommen.
mehr
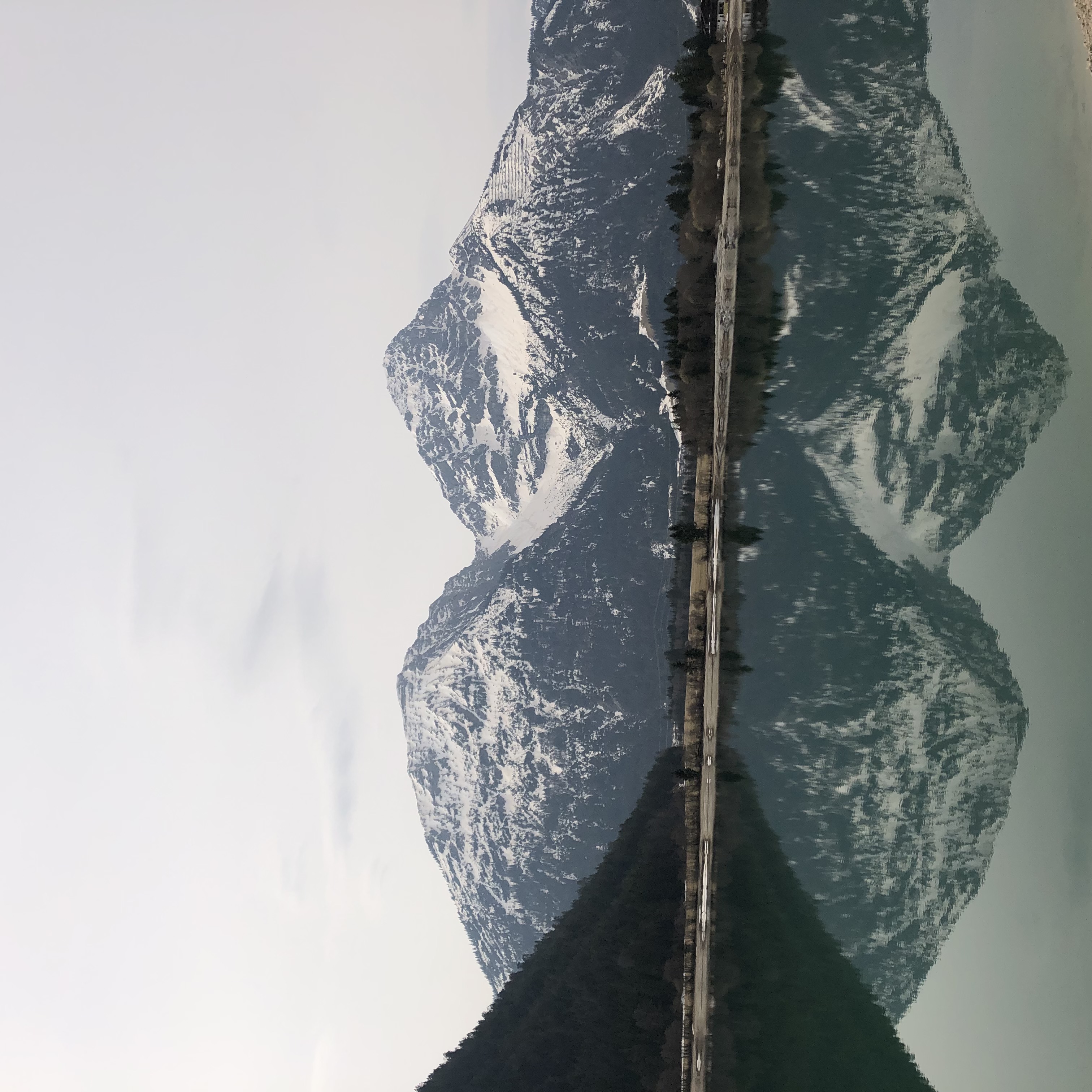
Eine Großproduktion könnte so losgehen: vor einem Nachthimmel, den ein Lichtfries begrenzt. Der Fries verliert sein Geheimnis als Scheinwerferfräse. Karolin kommt in der funkelnagelneuen Outdoor-Multifunktionskluft mit Pilzen vom Fuchstanz.
mehr
Hans Magnus Enzensberger kennt seinen Rang, lange vor dessen Bestätigung. ... Das unterscheidet ihn von Ingeborg Bachmann, der er 1955 ... zum ersten Mal begegnet. Zwei Jahr später fangen Bachmann und Enzensberger einen Briefwechsel an, in dem er sie zunächst hofiert und sie ihn zulässt.
mehr

Der Nachmittag geht in die Verlängerung, kein Abend in Sicht. Karolins Erwartungen nahmen ab. Männer, die gar nicht mehr damit rechnen konnten, für eine Frau in Frage zu kommen, hatten plötzlich eine Freundin namens Karolin. Karolin versprach sich unverdrossen alles. Von Wundern verlangte sie, das sie geschahen. Mit der Wirklichkeit ließ sich immer weniger anfangen.
mehr
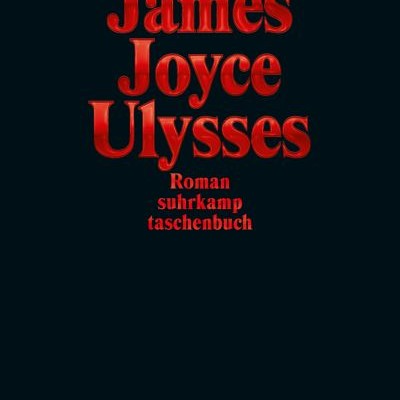
„Der Tag war bezaubernd“, heißt es lapidar am Morgen des 16. Junis 1904. Leopold Bloom erforscht sein Revier und denkt sich seinen Teil zu jedem Detail des Alltagsparcours. Er bemerkt die dünnen Socken und schiefen Knöchel eines Geistlichen, von dem ihn das Glaubensbekenntnis vor allem trennt. Trotzdem kennt Bloom die Formeln, die im katholischen Irland so beiläufig aufgeblasen werden wie Kaugummis. Die Liturgie als Litanei.
mehr

Tillmann öffnet die Schlafzimmerfenster, zieht Gardinen vor und geht zu Bett. Karolin veröffentlicht ihr Behagen im Bad. Ein Streit auf der Straße erweitert das Programm zum Sendeschluss. In diesem Moment wünscht sich Tillmann eine Ewigkeit zum Leben.
mehr
Sie ist Küchenhelferin mit Abitur, er räumt Tische ab. So geht das los im Sommer Neunundsechzig. Das betont Margret Franzlik: wie unvorbereitet sie die Begegnung mit dem angehenden Schriftsteller Wolfgang Hilbig traf. Eine Liebe am Arbeitsplatz ...
mehr

„Es gibt eine (vom saudischen Innenministerium entwickelte, im Google Play Store oder im Apple App Store verfügbare) App, mit der Männer in Saudi-Arabien ihre Frauen überwachen.“
mehr
Für uns war Gelnhausen, was Offenbach für den Rodgau ist – die Stadt, in der die Dinge passieren. Der höchste Punkt von Linsengericht drückt auf den Franzosenkopf. Die hessisch-bayrische Grenze zieht dem Hügel einen blanken Scheitel.
mehr
Vor dem Hintergrund der aktuellen russischen Aggression und Putins postsowjetischem Hegemonialpostulat versteht man noch einmal anders und besser hoffentlich, was die Balt:innen seit Jahrzehnten umtreibt in jenem Herzen von Mitteleuropa, dass für Ignorant:innen viel zu lange bloß osteuropäische Peripherie im Hinterhof einer regressiven Weltmacht war.
mehr
Fünfhundert Fliegenforscher:innen auf Kongresstournee steigen, stürzen, fallen aus Busen. Lauter Begabungen auf einer Domäne des Lebens, die mit „Leichenerstbesiedler:innen“ aufwartet. Die Erde wird von sechs- bis achtbeinigem Kleinwuchs dominiert. Die Betrachtung der Arten lehrt, wo unsere Albträume herkommen. Der Kongress kreist einen skelettierten Brachiosaurus brancai ein ...
mehr

Heiner Müller sagt: „Die einzige Legitimation der DDR kam aus dem Antifaschismus, aus den Toten, aus den Opfern. (..) Ab einem gewissen Punkt fing es an, zu Lasten der Lebenden zu gehen. Es kam zu einer Diktatur der Toten über die Lebenden - mit allen ökonomischen Konsequenzen. Denn die Toten brauchen keine Jeans, keine Kiwis, keinen Walkman.“
mehr

In meiner Kindheit waren alte Leute Überlebende des 19. Jahrhunderts gewesen. Sie hatten den Steckrübenwinter von Neunzehnfünfzehn mitgemacht und das Inflationsgeld von Dreiundzwanzig in Weidenkörben davongetragen. Im Dritten Reich waren sie dann schon zu alt für alles außer Leid gewesen. Nun ragte das Greisenalter kaum noch in die Vergangenheit.
mehr
Ihre aktuelle Reichweite verdankt Ratajkowski gewiss nicht der selbstherrlichen Begierde mächtiger Männer. Doch verbindet sich ihr Erfolg mit Erfahrungen im Spektrum patriarchaler Anmaßung. Die Übergriffe in der Vergangenheit wirken toxisch in der Gegenwart.
mehr

Apathie setzte eine Flagge in den Acker ihrer Existenz. Das wollte sie nicht, so was will kein Mensch, aber Paula konnte nicht anders, als allen Einflüssen des Niedergangs freien Lauf zu garantieren. Mit nichts kam sie weiter und voran.
mehr
Ulli Popp fasziniert seine Feind:innen. Popps Legende geht so: Man mag seinen Populismus ... so medioker wie gefährlich finden, die innere Statur stünde auf einem anderen Sockel. Der Menschenfischer, Massenhypnotiseur, Rattenfänger und Volkstribun Popp sei zwar eine triviale Spielfigur des politischen Theaters, aber ...
mehr
„Meine Eltern erzählten gern, dass sie nicht nur ehelich, sondern auch leiblich verwandt waren. Sie stammten von Deutschen aus dem Siegerland ab, die mit Schuldknechtschaftskontrakten im frühen 18. Jahrhundert zunächst nach Fredericksburg, Virginia, gekommen waren.
mehr

Matthias Belz bezeichnete sich als „vorwärtsgewandten Historiker“. Er kombinierte Handkäs mit Straßenkampf. Er blieb bis zu seinem Lebensende beleidigt, weil ich in die Zeitung gesetzt hatte, was Baader von Beltz gehalten hat. Er rezensierte das Geschwätz vor Wasserhäuschen. Frankfurt war der Ort seiner Erfahrungen - das Labor, in dem die Bilder entwickelt wurden, auf die er reagierte.
mehr
Auf den ersten Blick erscheinen Mely Kiyaks Kolumnen so reißerisch wie antike Kinoplakate. Sie haben Standpauken- und Brandreden-Signaturen, die Impulskontrollverluste suggerieren, als gingen mit der Autorin stundenlang die Pferde durch; als ließe sich eine besonders Temperamentvolle dafür feiern, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das ist Camouflage. Kiyaks Stärke ist die Analyse von hinten durch die Faust ins Auge.
mehr

Tillmann kommt mit Fleischwurst und Sauerkraut vom Metzger Klaus. Karolin trägt einen Ehering, das Gegenstück liegt auf dem Küchentisch, Karolin möchte für den Rest des Tages eine verheiratete Frau sein. Die Gravur nennt einen Namen, der Tillmann nichts sagt. „Immer ich“, sagt Tillmann. „Ich muss für jeden Quatsch herhalten.“
mehr
In den Aufstiegsagenturen des 19. Jahrhunderts wurden Diskriminierungskonzepte obsolet, die lange aufhaltend gewirkt hatten. Ressentiments bedurften neuer toxischer Ladungen. Die Entzauberung der Welt als Fortschrittsmaschine formte auch den Antisemitismus um. Marx und Rothschild mussten auf einen Nenner gebracht werden.
mehr

Manche täuschen mit Wespenwarntrachtfarben eine Gefährlichkeit vor, die sie nicht haben. Andere erscheinen so vegetarisch wie Ringelblumen, sind aber Fleischfresser. Skyliner vergrößern ihre Silhouette, um besonders ungebremst und zwanglos zu wirken. In der Regel simulieren sie einen Kunstwahn. Die Täuschung erlaubt es ihnen, als Kulturschaffende durchzugehen und nachts in Kneipen zu versacken.
mehr
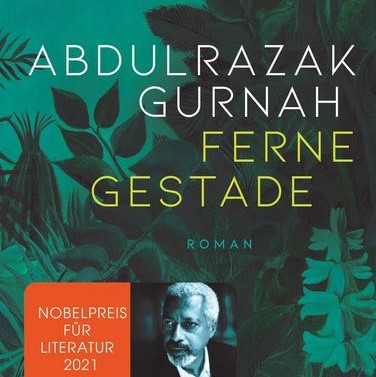
„Fluidität von Herkunft und Kultur“ und eine „Diversität jenseits von Herkunft“ (Naika Foroutan) ergeben neue Koordinaten in allen möglichen Fluchtlegenden. Ganz am Anfang der Geschichte, die Abdulrazak Gurnah in seinem, im Original erstmals 2002 erschienenen Roman erzählt, erfüllt Saleh Omar aka Rajab Shaaban Mahmud die Bedingungen einer Asylmission nach den Regeln der prekären Migration.
mehr
Gemütlich ist gut. Gemütlich sind Pfannkuchen, schön mit Puderzucker, und Karolin erzählt dazu, wie der Puderzucker mit einem kleinen Löffel durch das Sieb gerührt wurde, im Damals einer gemeinsamen Nordendkindheit. Und wo das Sieb gekauft worden war. Ob es das ...
mehr

Der Glauburg Park am Abend. Im ewigen Sommer Neunundneunzig erreicht Paula im Abendkleid Khans persönlichen Campingtisch. Sie verneigt sich vor der Extravaganz eines Kühlers und verlangt eine Zigarette.
mehr
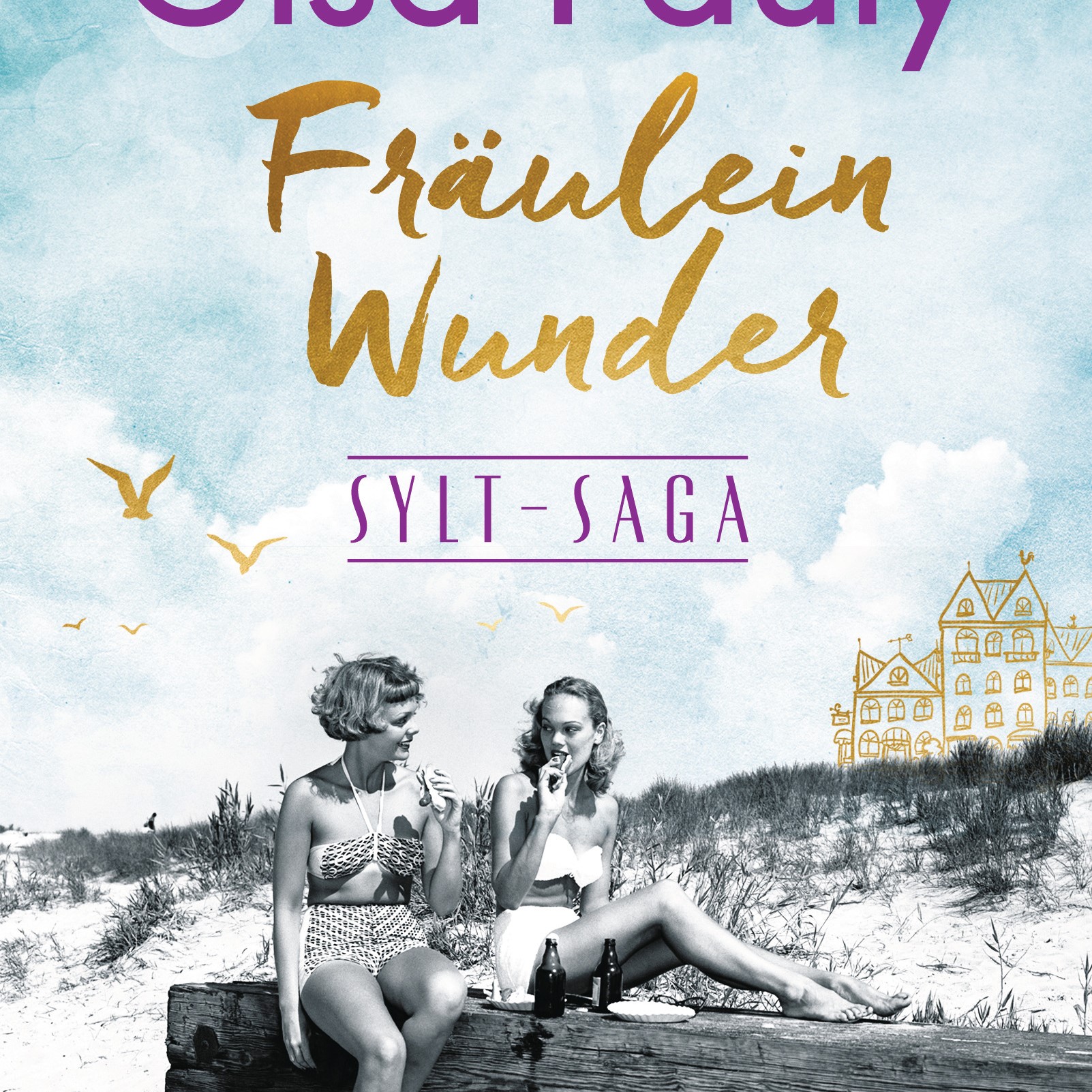
Bikini ist nicht nur ein verstrahltes Atoll. Vielmehr gehört ein Bikini im Wirtschaftswunderland von 1959 zu den Must-haves jeder statusempfindlichen Sechzehnjährigen. Schreinertochter und Handelsschülerin Brit Heflik kämpft erbittert um das Prestigeobjekt für eine Klassenfahrt. Vater Edward gibt den knorrigen Gegner ...
mehr

Auf der Neuhofstraße reden Tillmann und Paula über die beste Bratwurst der Welt. Von Geros Mutter eingepackt auf einer Arbeitsfläche in der Landmetzgerei Sinnig. Die Landmetzgerei lag in der Stadt. Das Anwesen war unversehrt geblieben, stehengeblieben als Labyrinth und Kinderparadies und Schreckenskammer mit Vorhöllencharakter ...
mehr
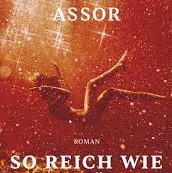
Casablanca in den 1990er Jahren. In einer marokkanischen Hipster-Clique spielt die Französin Sarah die exotischste Rolle. Driss mit seinen „Thymianaugen“ und der Performance eines geblendeten Rehs ist der Reichste. Sarah möchte den gehemmten, in Gesellschaft verstummenden, im Zwiegespräch stammelnden ...
mehr
Dienstagnachmittags geht Marie ins Textorbad, normalerweise mit einer Kollegin, aber heute lieber mit Tecumseh. Sie hat noch keinen großartigeren Delphinkrauler gesehen. Sie schämt sich ein bisschen für das Wenige, das für sie schwimmen ist.
mehr
„Kannst du nicht helfen?“ Die Frage maskiert einen Appell. Seit wann ergeben sich Rechte aus verjährter Verführung? Tillmann war falsch verbunden und richtig verlegen in der spröden Doppelvereinsamung. Ihm ist so heiß, dass er die Haut ausziehen möchte.
mehr
Die Erzählerin erinnert ihre Kindheit und Jugend als eine Laufbahn kleiner Siege. Während sie sich an den Ecken und Kanten eines patriarchalen Repressionsregimes stieß, triumphierte sie in einer Praxis trotziger Selbstermächtigungen.
mehr

Tillmann streichelt seine Grundig-Tonbandmaschine, gebaut im Jahr von ‚Spinning Wheel‘ als Ghettoblaster für den Mittelstand. Wehmütig betrachtet er den restaurierten TK 147 de Luxe mit automatischer Bandendabschaltung.
mehr

Adriane sagt: „So viel Aufmerksamkeit ist auch mal schön.“ Traktor vernimmt den Vorwurf ... im „Terrence Tino“ ist noch jede seiner Freundinnen begutachtet worden. Er schenkt Adriane Wein ein und weiß nicht, was er denken soll. Die Wirtin schreit: „Adriane, möchtest duuu …?“ und Adriane möchte geradezu alles bis hin zum Pfeffer aus der übermannshohen Mühle, einem Erbstück und einer Rarität und trotzdem voll funktionsfähig ...
mehr
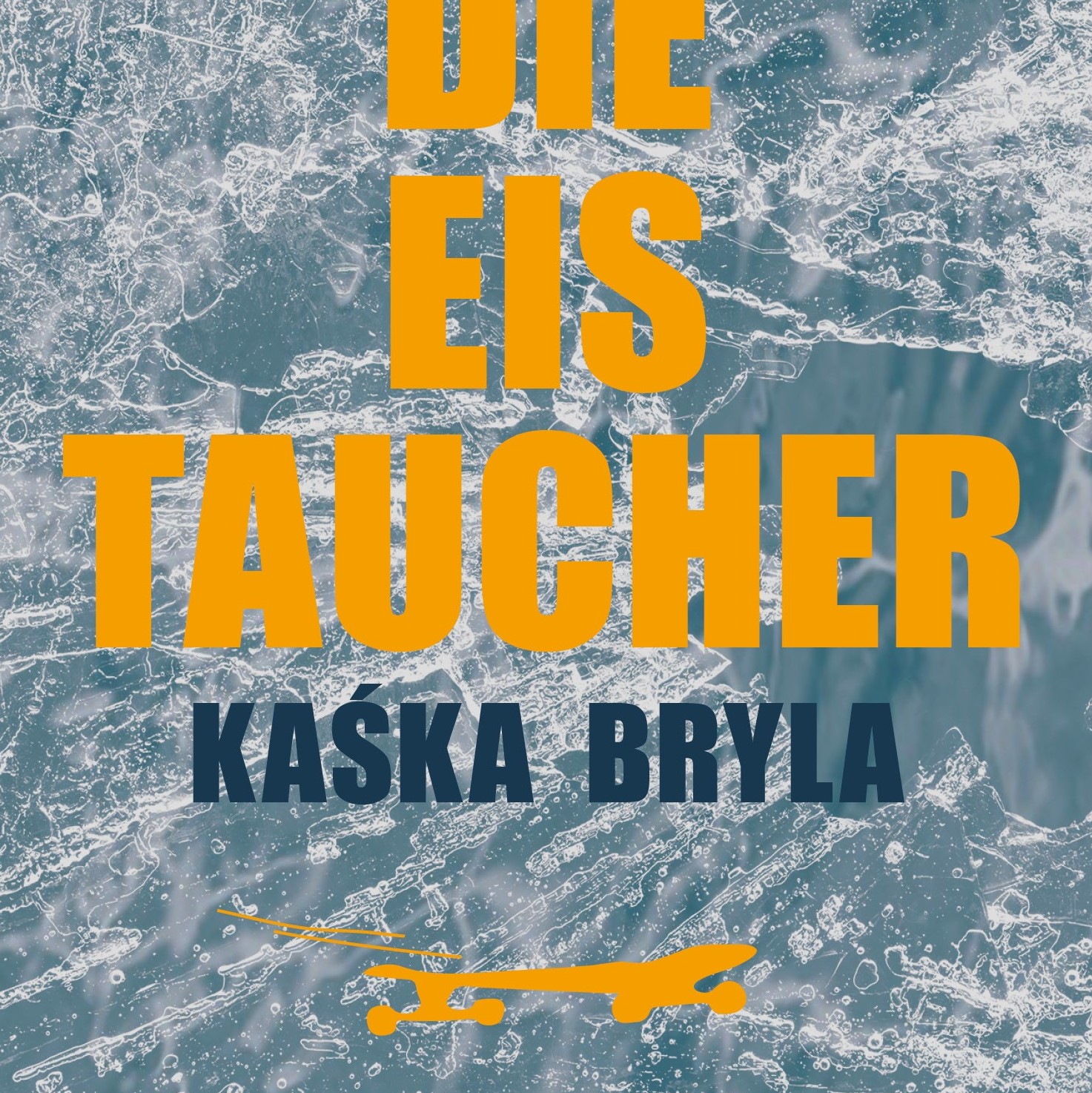
Zuerst verbindet sie nichts außer der plumpen Tatsache, die Neuen in einer Klasse zu sein. Iga Sulkowska und Ras-Putin Gerasimowitsch Bogdanow bilden eine Antipoden-Konstellation. Sie ist schnell, souverän und gradlinig, er ist langsam, wehleidig und labyrinthisch.
mehr
Tillmann stört Karolins bodenloser Maximalismus. Der gebieterische Drang, ihn in ihre Haltlosigkeit zu ziehen. Das tonnenschwere Gewicht, das manchen Sätzen nach ein paar Monate leichten Herzens wieder abgesprochen wird. Karolin ist studierte Kindergärtnerin im vorgezogenen Ruhestand, sie verlangt von Tillmann, wie ein ABC-Schütze vor roten Ampeln zu warten.
mehr

Sehr geehrte Stipendienbewerberin, sehr geehrter Stipendienbewerber, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Antrag auf Förderung bei der VG WORT bewilligt wurde. Um den Fördervertrag mit der VG WORT abzuschließen, bitten wir Sie, den Fördervertrag über Ihren Account auf dem Online-Portal …
mehr

„Tanja ist die Bescheidenheit als Persiko“, behauptet der König. Er streicht über meine Beine wie über ein Fell. Er klopft mich, sein Hund hebt den Kopf, den Hund seines Vaters hat der König im Wald ausgesetzt und die Prothese seiner Mutter einem Theaterfundus gestiftet. Er steckt mir ein paar Gemeinheiten, die Boris zu mir eingefallen sind. Ich verstehe die Gemeinheiten als Verarbeitung meiner Zurückweisung.
mehr

Zwei, drei Mal wurde es auf der Demonstration zum Thema. In der Ukraine geht es entschieden auch um die Freiheit des Westens. Die Selbstverständlichkeit unserer demokratischen Standards findet ihre Begründungen nicht zuletzt in alten Verabredungen des Kalten Krieges.
mehr
Die Routine eines kalifornisch entspannten Fotomodells, das - technisch gesehen uneitel und schmerzfrei - seit seiner Schulzeit Katalogjobs abreißt, wie andere an ihrem Lieblingsstrandabschnitt Wassersport-Equipment und Speiseeis verkaufen, zerfällt unter dem Druck einer weltweiten Betrachtung ihres Körpers. Die Identität einer privilegierten Jobberin ... kollabiert im Überbietungswettbewerb der Deutungshoheitsbehauptungen ...
mehr
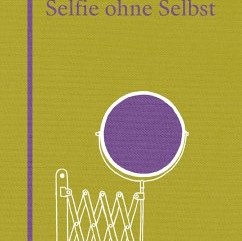
Es ist oft erzählt worden. In der Hochzeit des „Ungeheuren Alltags“ formierte sich eine Korona der talentierten Zustimmung um Marie-Luise Scherer, Gabriele Göttle, Jutta Voigt und (als einer Ermöglicherin, die mir am Herzen lag) Jutta Stössinger. Kleine Lichter flackerten an den Peripherien Illuminierter. Das Niveau garantierten ...
mehr

Tanja sagt etwas zu ihrer Entschuldigung, das sollte sie lassen. Eine Frau hält ein Mädchen ab, das schon schulpflichtig ist. Zwei Gitarristen fangen mit amerikanischer Volksmusik an. Der Strand (ein sandiger Parkstreifen) nimmt seiner Umgebung immer mehr Raum ab. Das sieht aus, als würden die Nachtspieler:innen aufrücken.
mehr

Eines Morgens setzt schlagartig die Gewöhnung ein. Für beide ist das eine Heimkehr zu Themen der Kindheit und Jugend. Karolin erzählt, was sie eben beim Bäcker erlebt hat. Sie wäre beinah in Schlappen vor die Tür gegangen. Das erinnert Tillmann an einen Sommer, in dem er im Bademantel seine Nachtasyle abgeklapperte.
mehr
Plakatierte Echtheitszertifikate „beweisen“ die Richtigkeit schillernder biografischer Angaben. Vermutlich besaßen die Ausgestellten den weltweit höchsten Schauwert. Ihre Präsentation als (der Legende nach) lebensgefährliche, über Nacht in Ketten liegenden Kannibalen, lässt die afrikanische Exotik offenbar hinter sich. „Rudolf Virchow, die anatomische Ikone der Humboldt-Universität“, nimmt die „Raritäten“ wissenschaftlich in Augenschein.
mehr
Man ist noch beim Sie und ganz förmlich. Angetörnt unterschreibt Ilse Aichinger mit „Ihre Sappho“. Da ist sie auf Lesbos im Urlaub, während Günter Eich halbwegs daheim „dionysisch“ verfasste Gedichte schreibt. Der Brief aus dem Jahr 1952 vibriert von dem Wunsch nach Nähe, obwohl der Grad der Bekanntschaft einen distanzierten Duktus nahelegt.
mehr
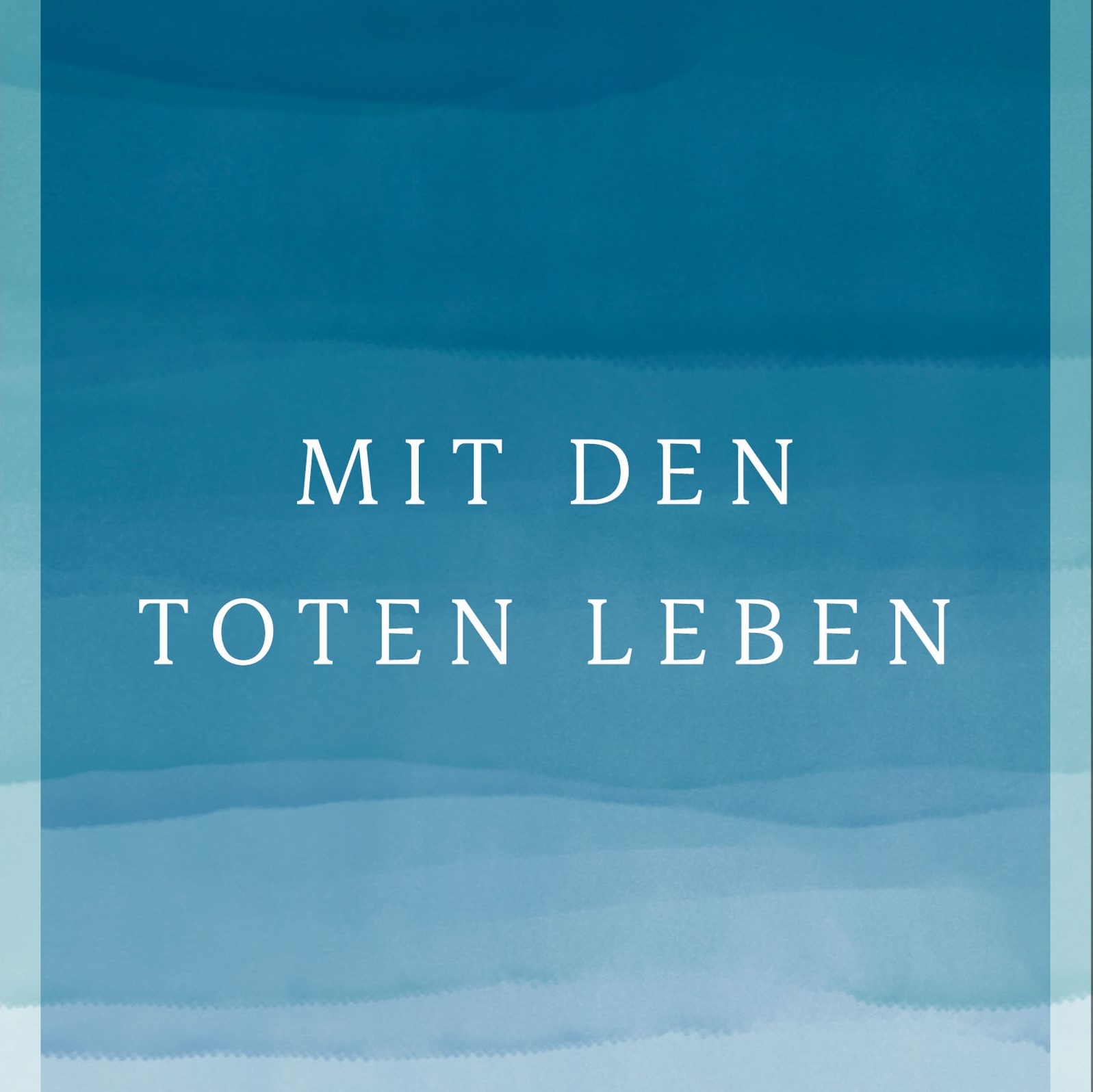
In dem Bett zu sterben, in dem man empfangen und zur Welt gebracht wurde, entspricht keiner aktuellen Vorstellung von Erfüllung und Vollendung. Nach einem gelungenen Leben da den Geist aufzugeben, wo die eigene Geburt stattfand, steht uns als Idee kaum noch zur Verfügung.
mehr

Drei Sätze in den blauen Dunst und man ist wieder „beim Thema“. Wer mit wem vor allem damals. Als die Wagner-Schwestern noch blutjung und kaum eine Ahnung. Aber die Soundso schon. Und jetzt macht die Dirne auf Dame, wie lächerlich und geradezu. Toni glüht vor Verachtung. Jedes Urteil nimmt sie aus ...
mehr

Milada streicht über ihre Beine, als kämen sie ihr sonst abhanden. Manchmal unterstütze ich ihre Selbstanbetung mit meiner rechten Hand. Ich zitiere den verbotenen Vogtländer Gerald Zschorsch: „Und warten nah der Grenze / mit Lied und mit Gedicht / dass durch die vielen Strophen / die Mauer einmal bricht.“
mehr

Offiziere im besonderen Einsatz bewirtschaften den Treffpunkt. Sie helfen notorisch klammen Dichtern aus den Bredouillen, die unangepasste Lebensführungen mit sich bringen. Sie heißen Inge und Klaus S. Zumal Inge wirkt sehr überzeugend als Aktivmuse und unerschöpfliche Inspirationsquelle für Künstler.
mehr
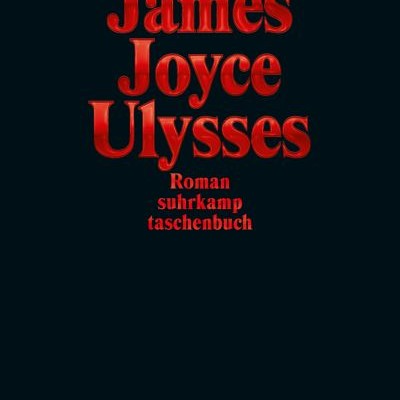
Stephen fährt im Zug seiner Aufmerksamkeit alle Linien ab, die das Gelände in spezifischer Beliebigkeit hergibt. Der Laserstrahl seiner Wahrnehmung tastet Vorsprünge, Kavernen und Felsnasen in dem Massiv über der Irischen See ab. Das Meer schäumt wie Weißdorn auf moosgrünen Kämmen. Stephen stolpert über einen Hundekadaver ...
mehr

Inzwischen sieht Goya liegengebliebene Bildzeitungen mit anderen Augen durch als in der arroganten Armut des selbst Malenden vor vierzehn Jahren. Damals gewann ein Siebzehnjähriger das weltweit prestigeträchtigste Tennisturnier. Boris Becker war der erste ungesetzte, der erste deutsche und der jüngste Wimbledonsieger. Jetzt scheint er am Ende zu sein, während Goya obenauf ist.
mehr

Wir durchqueren Schwemmland im Fruchtmantel des ursprünglichen Mississippi-Verlaufs; Baumwollland unter bewaldeten Hügeln. Aristokratische Weiher mit ihren von der Gegenwart düpierten Herrenhäusern erniedrigen sich zum Streckensaum. Sie sehen nach einer verlorenen Nacht im Casino aus und ein bisschen auch wie ein wahrhaft verwunschenes Heidelberg.
mehr
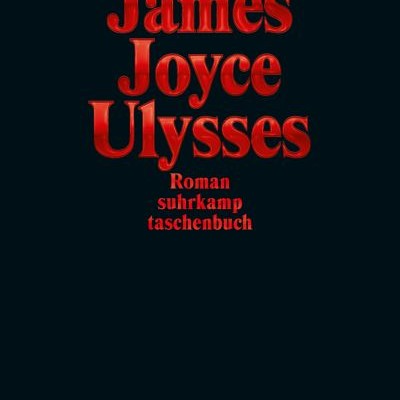
Geboren am 2. Februar 1882, machte James Joyce mit der Veröffentlichung des „Ulysses“ seinen vierzigsten Geburtstag 1922 zum Meilenstein der Literaturgeschichte. Suhrkamp nimmt den Geburtstag und das Jubiläum eines Großmeisters der Moderne zum Anlass für eine weitere Ausgabe der sagenhaften Wollschläger-Übersetzung aus dem Jahr 1975. Hans Wollschlägers Auftritt als Übersetzer evozierte das Kolossal einer postumen Kollaboration, wenn nicht sogar einer Transition aus der anderen Welt ...
mehr
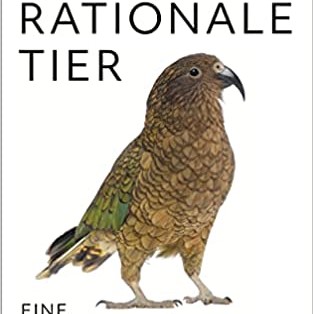
Während bei „einfacheren Lebewesen … nur ein unbewusster Wettbewerb unkoordinierter sensomotorischer Systeme stattfindet“, beweist jeder Elefant auf der Suche nach einem Wasserloch Konsistenz und Persistenz. Das verweist auf zwei konstitutive Merkmale menschlichen Bewusstseins: „Globale Verfügbarkeit und Selbstüberwachung“.
mehr
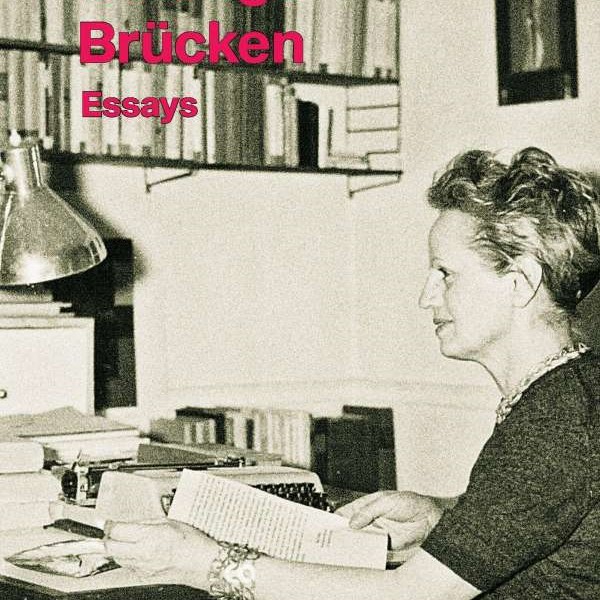
Karl Marx nannte sie die „schönste Revolution der Weltgeschichte“. Ré Soupault schildert den zweiundsiebzig Tage währenden Utopismus ebenso emphatisch. Sie titelt „Paris unter der Kommune 18. März - 28. Mai 1871. Nach zeitgenössischen Dokumenten dargestellt“. Tenor des Radioriemens: „Trotz aller ihrer Fehler ist sie das grandioseste Beispiel der proletarischen Bewegung des 19. Jahrhunderts.“
mehr
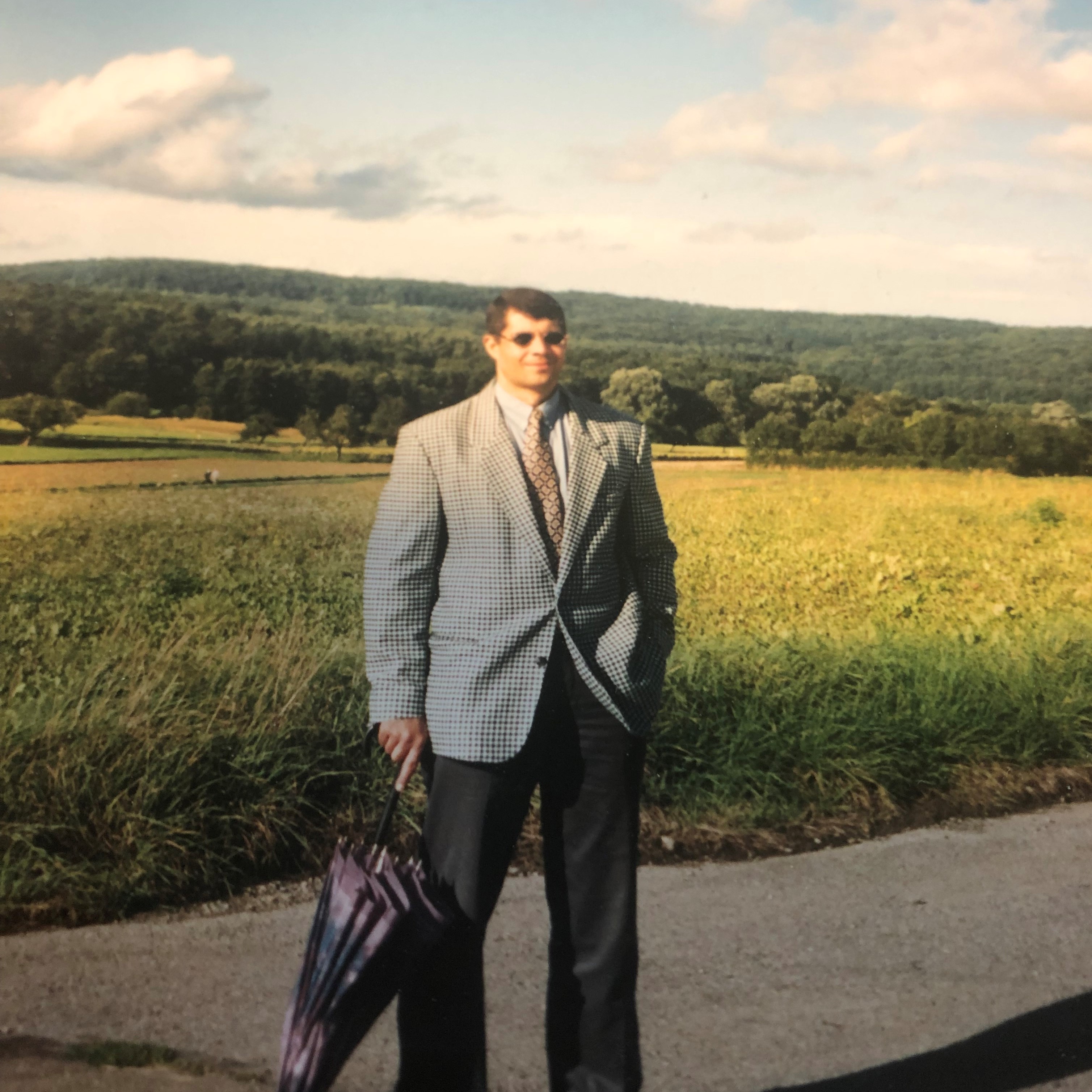
Investigationen wirken auf Antigone wie Rauschmittel. Ihr Jagdtrieb wird stimuliert, etwas Ursprüngliches setzt sich durch. Innerlich reich geboren, fällt es ihr leicht, die Privilegien ihrer Klasse gering zu schätzen. Antigone lebt für ihre Arbeit, das Privatleben verelendet auf hohem Niveau.
mehr

Das Paar hat nichts mitgebracht, was vor Ort zählt. Die Neuen fühlen sich trotzdem großstädtisch überlegen, während die Rohrzange Anpassung sie kleinstädtisch kneift. Davon erzählt Gerda ihrer Freundin Amelie in Episoden, die wie gemalte Erfahrungsberichte in einem Klassenzimmer aneinandergereiht sind.
mehr

Müßiggänger:innen bleiben vor Jims Kneipe hängen. Der Ire könnte als Sizilianer alten Schlags besetzt werden. Immer wieder gerät Jim in sagenhafte Schwierigkeiten. Dann finden im Nordend Verfolgungsjagden statt. Jim räumt Stühle und Schirme zu Tischen auf dem Bürgersteig. Er setzt sich zu den Paaren. Ein Stammgast geht in den Service, Jim nennt das Erlebnisurlaub.
mehr
Das Gefängnis war ursprünglich eine Großküche. Man fand es auf keinem Stadtplan. In seiner Umgebung residierte Markus Wolfs Computer-Abteilung, die realsozialistische Version von Q‘s Labor, in dem James Bond seine Spielsachen kriegt, war auch da. Im kriminaltechnischen Institut des Ministeriums für Staatssicherheit in der Genslerstraße 13 baute man für Entführungsaktionen schalldichte Zellen in Autos (Westfabrikate) ein.
mehr

1923 behauptete eine verheiratete Weiße namens Fannie Taylor nach einem handfesten Streit mit ihrem weißen Liebhaber, von einem Schwarzen angegriffen und verletzt worden zu sein.
Fannie Taylor brauchte eine Erklärung für ihre Blessuren, die sie nicht als Ehebrecherin desavouierten.
mehr
Im Sommer 1808 übernimmt William Paterson den Posten des Gouverneurs von New South Wales. Er folgt dem kaum in Erscheinung getretenen Foveaux, dessen Vorgänger, der glücklose, von korrupten Offizieren gemobbte William Bligh, auf sein königliches Mandat pocht. Bligh ist eine nautische Ausnahmeerscheinung. Seine kartografische Genauigkeit hilft Seefahrer:innen noch im 20. Jahrhundert.
mehr
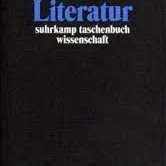
Adorno sagt: Brecht lavierte, schraffierte, vernebelte, fintierte. Er habe sich verhalten im Geist mediokrer Vorgaben. Heiner Müller stimmt zu, deutet das Konzept aber anders. Er wäre gern Schüler dieses Meisters gewesen, und hat manchmal seine Geschichte auch so erzählt als wäre er Brecht nahe gekommen.
mehr
Wir wissen es alle. Didier Eribon und Steffen Mau haben im Kohortendenken der Postbabyboomer:innen Türen aufgestoßen und jede Menge Vorstadtlebensläufe aufgewertet. Die soziologisch diagnostizierte Herkunftsscham und ihr Gegenteil sind zu Schlüsseln des Begreifens geworden.
mehr
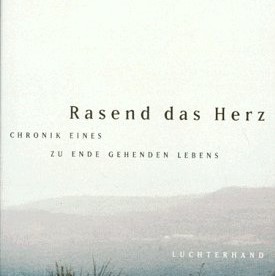
Einmal liegt eine Spenderniere in der Frankfurter Uniklinik bereit, während Karasek mittellos in Sainte-Vertu rotiert. In einem von der Schwester gecharterten Privatflugzeug landet er auf einem Frankfurter Flughafen, um da zu entdecken, dass er ohne Pass reist. Karasek erzählt, wie Käse aus dem Papier geschlagen wird. Der Wein kommt mit schwarzen ...
mehr
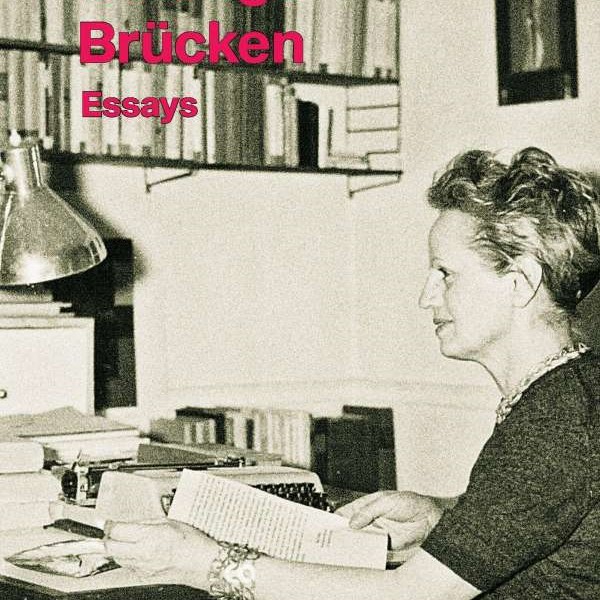
Am 2.3.1982 sendet der Hessische Rundfunk einen Beitrag mit dem Titel „Die Welt der Kelten. Eine Zivilisation und ihr Ende“. Darin trifft Ré Soupault eine fabelhafte Unterscheidung. Im Gegensatz zu ihren Vernichtern, den materialistischen, von einer festgefügten staatlichen Struktur ausgehenden Römern, seien die Kelten „Spiritualisten“ mit einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung gewesen.
mehr
Erinnert sich noch jemand an Horst Karasek? Auf seine Weise war auch er ein Peter Kurzeck in Frankfurt am Main. Und außerdem eine Widerstandspersönlichkeit. Während Horst K. seine Lebhaftigkeit in Auseinandersetzungen an der Startbahn West suchte, erschien einer seiner Brüder televisionär als der junge Mann von Marcel Reich-Ranicki.
mehr

„Ich möchte sterben wie mein Großvater, friedlich und im Schlaf. Auf keinen Fall hysterisch wie sein Beifahrer.“ Das erklärt Sandra, bevor sie den Ball der Aufmerksamkeit an Elke abspielt. Die beiden Frankfurter Rekonvaleszentinnen kuren in Ahrenshoop. Sie machen Front gegen Leute, die keine Hessen sind.
mehr

Niklas Luhmann beschreibt Vertrauen als „einen Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität“. Mir gefällt die mechanistische Erklärung. Ich schinde Malte mit Details. Historisch bedeutender und noch älter als sein Schauplatz ist ein hanseatischer Dielenschrank, ein Danziger Schapp mit Walnussbaumholzfurnier. Die Kugelfüße sind aus Ahorn.
mehr
Das Exil machte Brecht nicht demütig. Er zählte zu den Stars der Emigration. Andere erlitten das Schicksal, dem er treffende Worte gab. Reden wir kurz über die „Flüchtlingsgespräche“ - „Der Pass“, so heißt es in dem fragmentarischen Ertrag des Brecht’schen Nachlasses, „ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch.
mehr
1989 erschien in der von Enzensberger emphatisch edierten „Anderen Bibliothek“ im Eichborn Verlag als 52. Band „Edmond und Jules de Goncourt. Blitzlichter. Portraits aus dem neunzehnten Jahrhundert.“ Ausgewählt, übersetzt und mit einem Nachwort versehen wurde das Journalextrakt von Anita Albus. Die Frankfurter Rundschau schrieb: „Die Tagebücher der Brüder Goncourt sind eine kultur-, zeit-, sozial- und sittengeschichtliche Fundgrube ersten Ranges.”
mehr
Enzensberger vergleicht den Limes mit einer „Membran, die einen osmotischen Austausch zwischen verschiedenen Kulturen und Verkehrsformen beförderte“. Die Römer:innen seien zu klug gewesen, um sich abzuschotten. Doch gebe es Lagen, in denen ein cordon sanitaire als beste Lösung angesehen werden müsse, etwa bei Territorien, die sich Desperados unter die Nägel zu reißen wussten.
mehr

Im Visier der Sonne verläuft die Grenze zwischen Mecklenburg und Pommern. Die Aufnahme entstand auf der pommerschen Seite. So oder so ist das alles UweJohnsonLand. Nach dem Krieg kommt Johnson als Geflüchteter nach Güstrow. Das ist nicht weit weg von Waren an der Müritz, wo zur gleichen Zeit Heiner Müller als Sachse sich Mecklenburger Gemeinheiten gefallen lassen muss. Man bindet den „Ausländer“ an einen Marterpfahl. Das ist eine andere Geschichte.
mehr

Im Verlauf der Jugend kam er zu einer gebrauchten Ausrüstung, so dass er sich auf den ersten Blick nicht sonderlich unterschied von den Arrivierten. Er setzte seinen Stolz in das Unternehmen einer neuen und vollständigen Ausstattung vom Sombrero ... bis zum Sattel. Dafür arbeitete er zwanzig Jahre ... Der Gaucho schaffte sich die Dinge kein zweites Mal an. Sie überlebten auch noch einen Erben. Sie waren hundert Jahre brauchbar.
mehr

Wie eine Schweißnaht zieht sich die Spur der Zensur durch Mandelstams essayistischen Obst- und Gemüseauslagen. Halboffen und halbironisch beschwert sich der Dichter in seiner Rolle als Urheber von semi-literarischem Kleinmist bei seinen Leser:innen über staatliche Bevormundung und brutale Dummheit.
mehr

Michel Serres sagt: „Ekstase und Existenz haben die gleiche Wurzel.“ Das „Fast-Nichts“ der eigenen Existenz schließt sich mit dem Universum kurz. „Diese drei Kurzschlüsse – das Unermessliche im Punkt, das Sein im Nichts, Alles im Nichts – erzeugen einen Energiedruck von unendlicher Dichte, der mitunter über lange Zeiträume in einem Ausbruch von zerstörerischem Hass oder aber einer Liebe freigesetzt, die Zivilisationen schafft.“
mehr
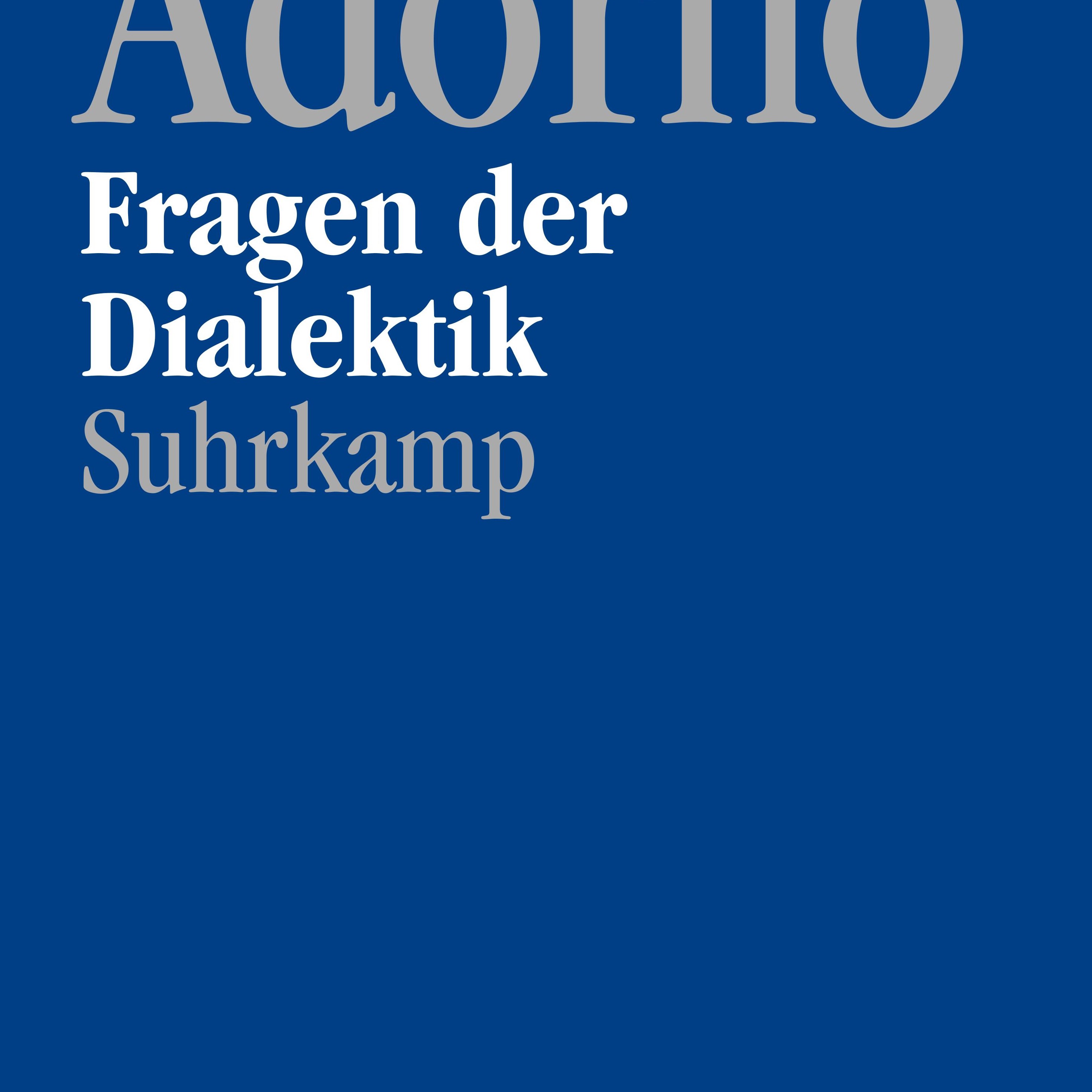
In der Vorlesung vom 21. 11. 1963 wendet sich Adorno gegen „eine Art von verantwortungsloser Drauflosdenkerei, die sich an die Sachgehalte, mit denen sie es zu tun hat“, ruchlos vergreift. Der Vordenker pointiert seine Kritik mit der Wendung „free for all“. Doch verortet er jedweden philosophischen Darkroom-, Späti- und Discounter-Text auf einem gemeinsamen Unterstrom mit der Dialektik.
mehr

Die Aktivist:innen starteten eine restaurative Revolution. Sie bemühten sich um den Erhalt von Pittoresken und kombinierten traditionelle Elemente mit dem stadteigenen Pop in Opposition gegen volksrepublikanische Störungen. Ihr Ansehen war auch deshalb so hoch, weil der Aktionismus vom Charakter der Gutwilligkeit eingekleidet und der Identitätsdiskurs eher konservativ geführt wurde.
mehr

Eben fiel mir eine Geschichte ein, an die ich lange nicht mehr gedacht habe. In meiner Hanauer Zeit klapperte ich Anglerheime, Campingplatzschwemmen und Gartengaststätten am Main zwischen Frankfurt und Aschaffenburg ab. Weitere lohnenswerte Ziele waren verschwiegen-eingesessene ...
mehr

Die Todesnähe entmachtet den Unterschied zwischen Tag und Nacht. Heiner Müller wehrt sich mit chemischen Keulen, doch wird der Tod Heimat („der tod wird heimat“). Das ganze Wissen und die Gabe, es zu bündeln, gehen dahin. „Man tritt immer weiter aus der Bibliothek heraus und schreibt immer mehr in der eigenen Blindheit.“
mehr
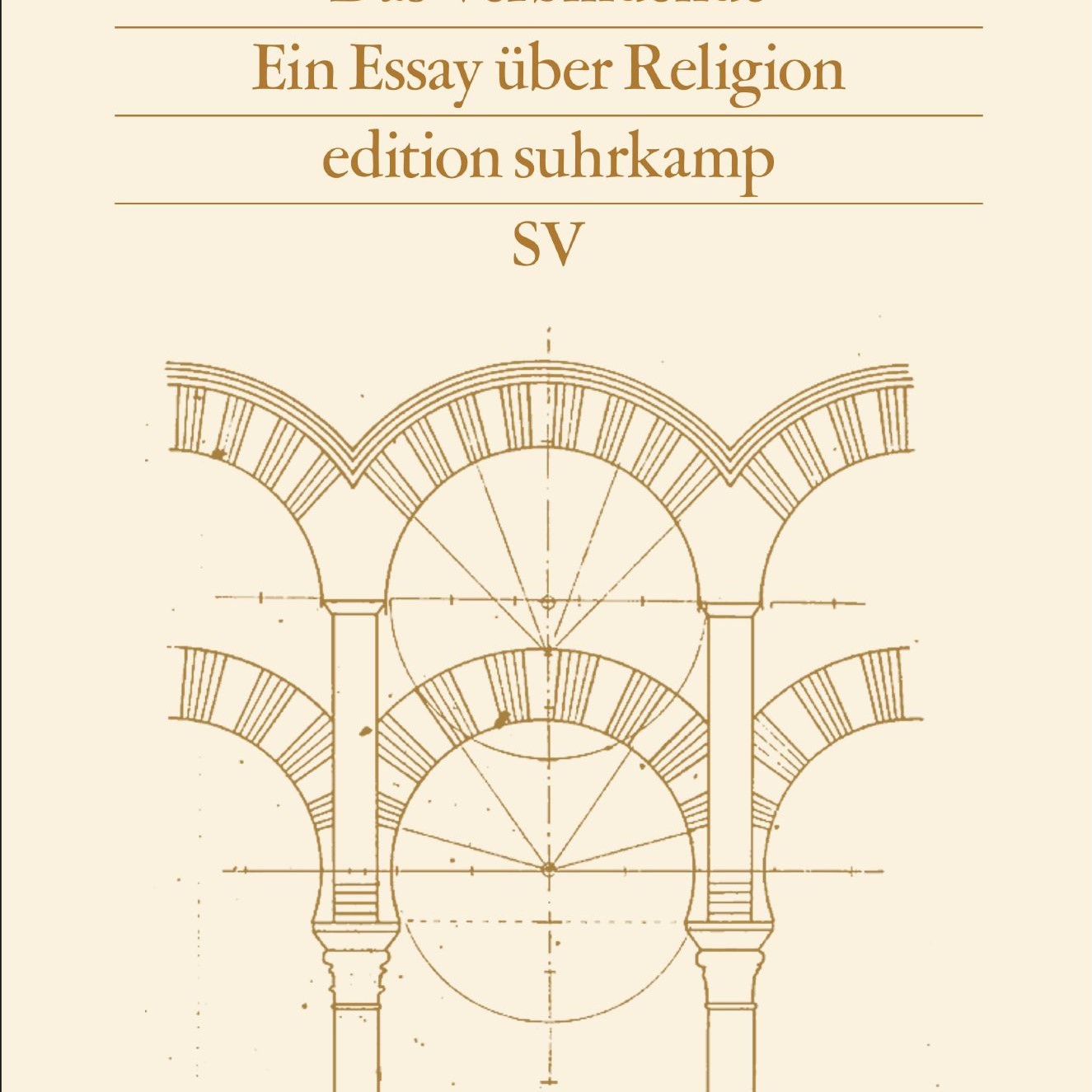
„Das Geld, das algebraische X und der Buchstabe können, weil bar jeder Bedeutung, alle Bedeutungen annehmen. Das Abstrakte oder Virtuelle lässt sich also in allen drei Fällen auf etwas Konkretes anwenden.“ Serres untersucht das Verhältnis von erd- und menschheitsgeschichtlichen Hotspots auf der Linie Tektonik, Vulkanismus, Einschläge aus dem All und den Tsunamis des Wissens. Plötzlich ist alles da.
mehr
Uns alle packte das Entsetzen, als wir – im medialen Echo der Weltereignisse - die Taliban auf Kabul vorrücken sahen und aus den Nachrichten erfuhren, dass bereits informelle Gespräche mit den künftigen Machthabern in Gang gekommen seien und die ersten diplomatischen Kanäle zur Kanaille gebohrt würden.
mehr
Flaubert startet sein eigenes Programm, bei dem das Symbolische vor dem Imaginären kommt. Der Kriseninhaber erlebt sich gesteigert, wenn er die Welt in sich erfindet. Dabei geht er über die dialogische Struktur von Interaktionen hinaus. Gleichzeitig fällt er archaisch hinter ihr zurück, indem er sein Leben monologisiert. In den Augen der Sozialkompetenten erscheint er deshalb naiv.
mehr
Da er lange ein berühmter Unbekannter bleibt, muss Heiner Müller wieder und wieder im Westen wie im Osten und so auch im Westen und Osten von Amerika die Butterdose seiner Biografie auskratzen. Das strapaziert, es führt zu einem schleifenden Text, der sich an folgenden Punkten wiederholt. Eine Großmutter war für Adolf Hitler, sie ging bis zur Kreisleitung, um sich gegen eine Schergenbehauptung zu verwahren.
mehr
„Dass ich nicht ersticke” handelt von der sozialistischen Arbeits- und Lebensgemeinschaft Inge & Heiner Müller. Die Produktionsbedingungen dieser Keimzelle von Werk und Mythos ordneten sich so, dass die Krisen in Inge ausgetragen wurden und Heiner sich mit lyrischem Stoizismus muskulös hielt. Der Sachse Heiner hatte im Krieg nichts Schlimmeres erlebt als ein Zugezogenenschicksal in Waren an der Müritz (im Uwejohnsonland).
mehr

In seiner Vorlesung vom 21. 11. 1963 wendet sich Adorno gegen „eine Art von verantwortungsloser Drauflosdenkerei, die sich an die Sachgehalte, mit denen sie es zu tun hat“, ruchlos vergreift. Der Vordenker pointiert seine Kritik mit der Wendung „free for all“. Doch verortet er jedweden philosophischen Darkroom-, Wasserhäuschen- und Discounter-Text auf einem gemeinsamen Unterstrom mit der Dialektik. Adorno spricht von dem „auf Flaschen gezogen(en) … (Hegel‘schen) Geist der Dialektik“.
mehr
„Vor der Schöpfung war nichts. Gott hat auch bei null angefangen. Wir stellen ein paar Wurfzelte auf“, sagte Einar. Frankfurt kroch vor ihm, er hätte einen Schrebergarten auf die Bühne bringen und von dem Schrebergarten behaupten können, das ist alles, was sich noch sagen lässt. Wir saßen im Frankfurter Hof, Schleef, Müller ...
mehr
Uwe Johnson dachte wohl eine Weile darüber nach, wen er zur Hauptträgerin seiner literarischen Gewichte machen wollte. Auf einer sehr langen Linie entschied er sich für Gesine Cresspahl. Die Mecklenburgerin mit dem geraden Herzen betrachtete die Welt Jahrzehnte mit den Augen ihres Schöpfers. Er veredelte sie im Geist des sozialdemokratischen Antifaschismus. Johnson lieh seiner Gesine jede Menge kleidsame Ansichten.
mehr
Michel Serres fasst den genialen Kurzschluss so auf: „Galileis wahre Erfindung ... war der Zusammenhang, den er zwischen Mathematik und Erfahrung herstellte. Den Griechen, die darum keine exakte Wissenschaft von der Welt kannten, war deren Schnittpunkt verborgen geblieben. Galilei dagegen setzt Gleichung und Versuchsanordnung zueinander in Beziehung. Durch einen so blendenden wie fruchtbaren Kurzschluss zwischen einer virtuellen und …“
mehr
„Das Reich, in dem wir zusammentrafen, senkte sich herab wie eine Wolke, die sich öffnete um uns in ein verborgenes Paradies aufzunehmen.“ Bettina von Arnim über den Kreis der Romantiker:innen, in dem sich Karoline von Günderrode in Friedrich Carl von Savigny verliebte.
mehr
Johnson schildert ein sozialdemokratisches, kirchenkritisches Milieu, das von den Nazis aus der Fassung gedreht und nach dem Krieg in der sowjetisch besetzten Zone nicht mehr auf die Beine kam. In der Handlungsgegenwart erleidet Cresspahl ein Orientierungsdesaster. Er erkennt, dass gegen Hitler gewesen zu sein, keine ausreichende Basis für das Weitere ist.
mehr
Walter Faber, der Held in dem vielbesungenen, zu Tode gequatschten und doch als Kassiber der Zeit ergiebig gebliebenen Bericht „Homo Faber“, strandet in der mexikanischen Wüste als Überlebender und mehrfach herausgeforderter Zeuge eines technischen Versagens. Der Ingenieur erscheint als Apologet des technischen Zeitalters. Sein Flugzeug hatte eine Panne. So what.
mehr
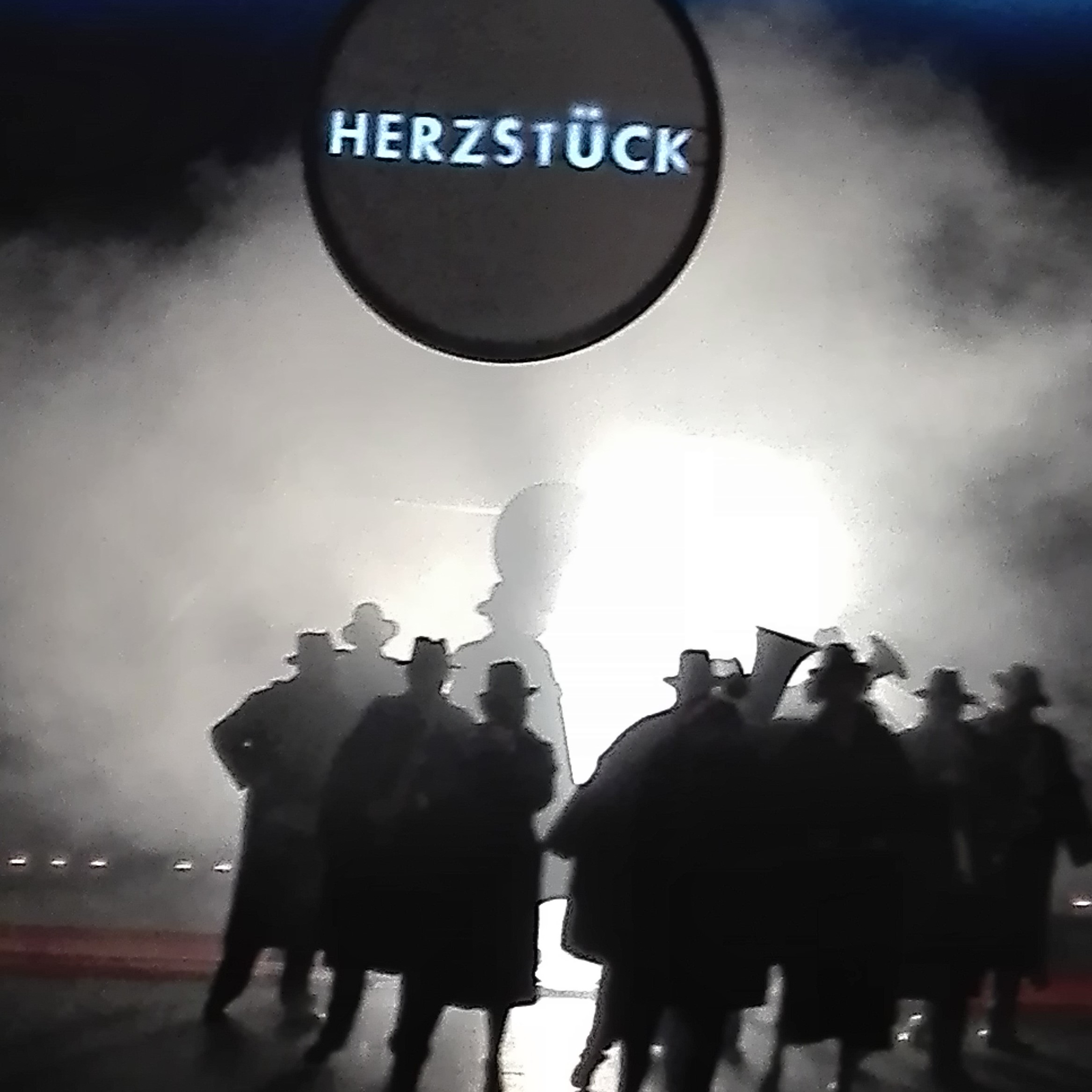
Der mittlere Müller klingt noch jugendbewegt wie ein Wandervogel. Seine Stimme durchläuft eine ähnliche Karriere wie die Stimme von Johnny Cash. Der späte Cash singt wie ein Delegierter des Todes, damit die Lebenden schon mal reinhören können. Aus dem späten Müller spricht ein vom Passivrauchen entnervter Tod.
mehr
Ende der 1960er Jahre tauchte Jean Genet in Tanger auf. Er gab das Genie im Hotel. Das Personal erschreckte er mit abseitigen Gewohnheiten. Seine Großzügigkeit zeigte Genet Lumpen und Poeten. Er bewirtete Mohamed Choukri, den Paul Bowles entdeckt hatte ...
mehr
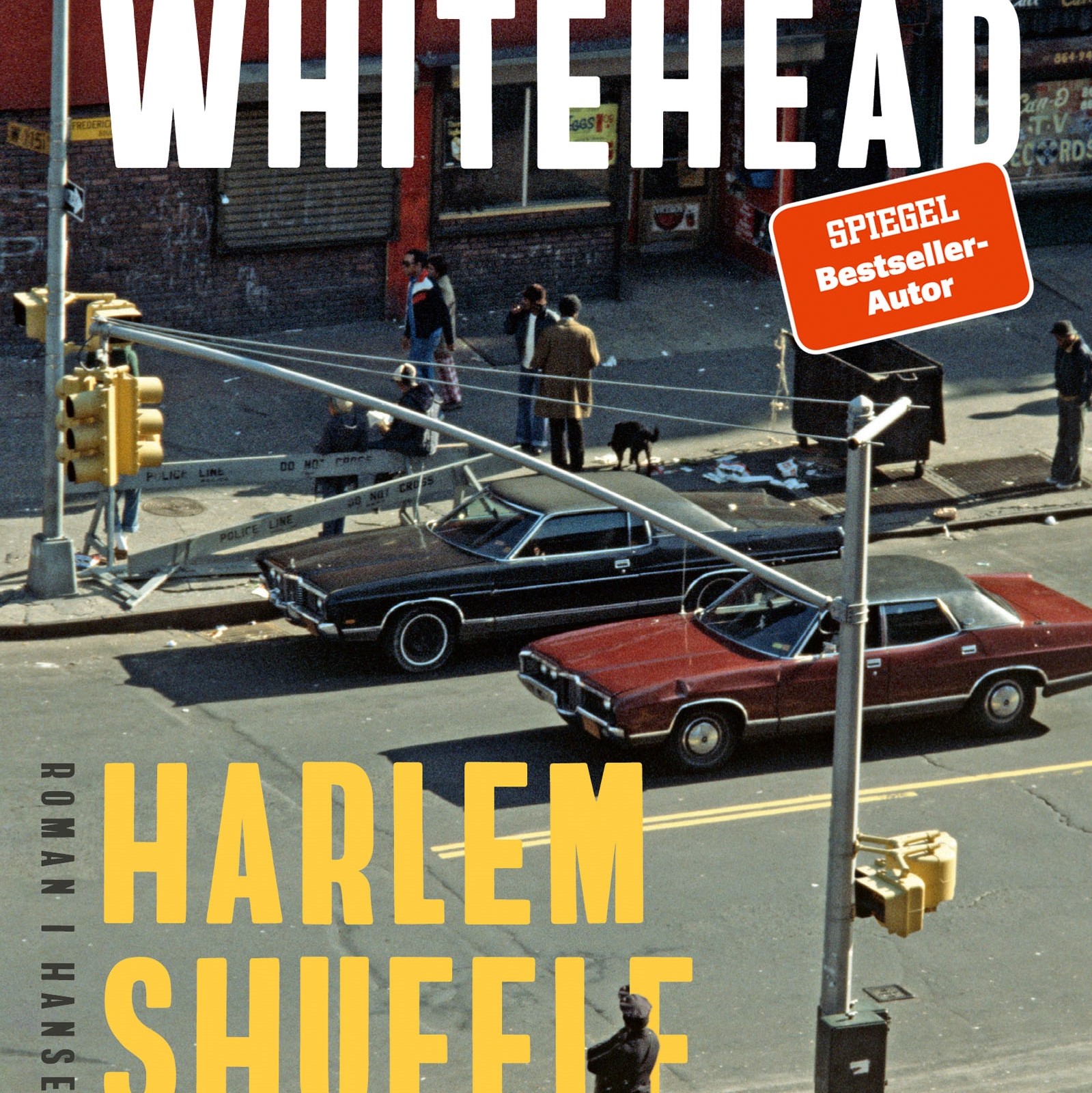
Ja, Carney kennt sich aus mit dem Herumgestoßenwerden. Er wundert sich, wenn ihn jemand Mister nennt. Nach seinen Wünschen gefragt zu werden, löst bei Carney basales Erstaunen aus. Seine Kalenderspruchweisheiten rahmt ein Trauerrand. Ihm fehlt der Optimismus der Einwanderer, deren Ambitionen im Augenblick des Romangeschehens mit dem „Elektronikboom“ flirten.
mehr

Adorno schildert Ernst Jünger als „elend schlechten, verkitschten Schriftsteller … (und) second hand-George“. Der Kritiker sagt dem Autor eine „kurzfristige Unsterblichkeit voraus“.
mehr
Als die frisch vermählte Baronin Blixen Nairobi kennenlernt, leben da „knapp vierhundert Weiße, zweitausend Inder und circa viertausend Afrikaner“. Nicht weniger als tausend Einheimische begrüßen das skandinavische Aristokratenpaar auf ihrer eben erworbenen Kaffeefarm MBagathi im nairobischen Umland. Karen Blixen registriert lauter „splitternackte Männer“. Sie folgen den neuen Herrschaften „mit dröhnendem Gesang“.
mehr
Dänemark im Packeis, der Kontinent im Planetensturm. Die DDR vor ihrer Auflösung – Müller inszeniert „Hamlet/Hamletmaschine“ 1990 als lange Strecke am Deutschen Theater. „Was du dem Zuschauer nicht antun willst, das tut er dir an.“ Westliche Berichterstatter:innen sprechen voller Vertrauen in den Abstand von „Ost-Berlin“ und „DDR-Dramatik“. Die deutsche Spaltung ist nicht nur noch sichtbar, sondern nun auch zu besichtigen wie ein Riss in der Erde. In den Köpfen steht die Mauer.
mehr

Mühe erinnert sich an Müller: „Ich habe ihn an einem Morgen in seiner Wohnung abgeholt. Er hatte verschlafen, weil es am Abend vorher spät geworden war, ich wollte ihm einen Kaffee machen. Aber er hatte keinen Kaffee im Haus. Er hatte eigentlich gar nichts im Haus. Irgendwo in dieser leeren Küche habe ich dann noch einen Teebeutel gefunden.“
mehr
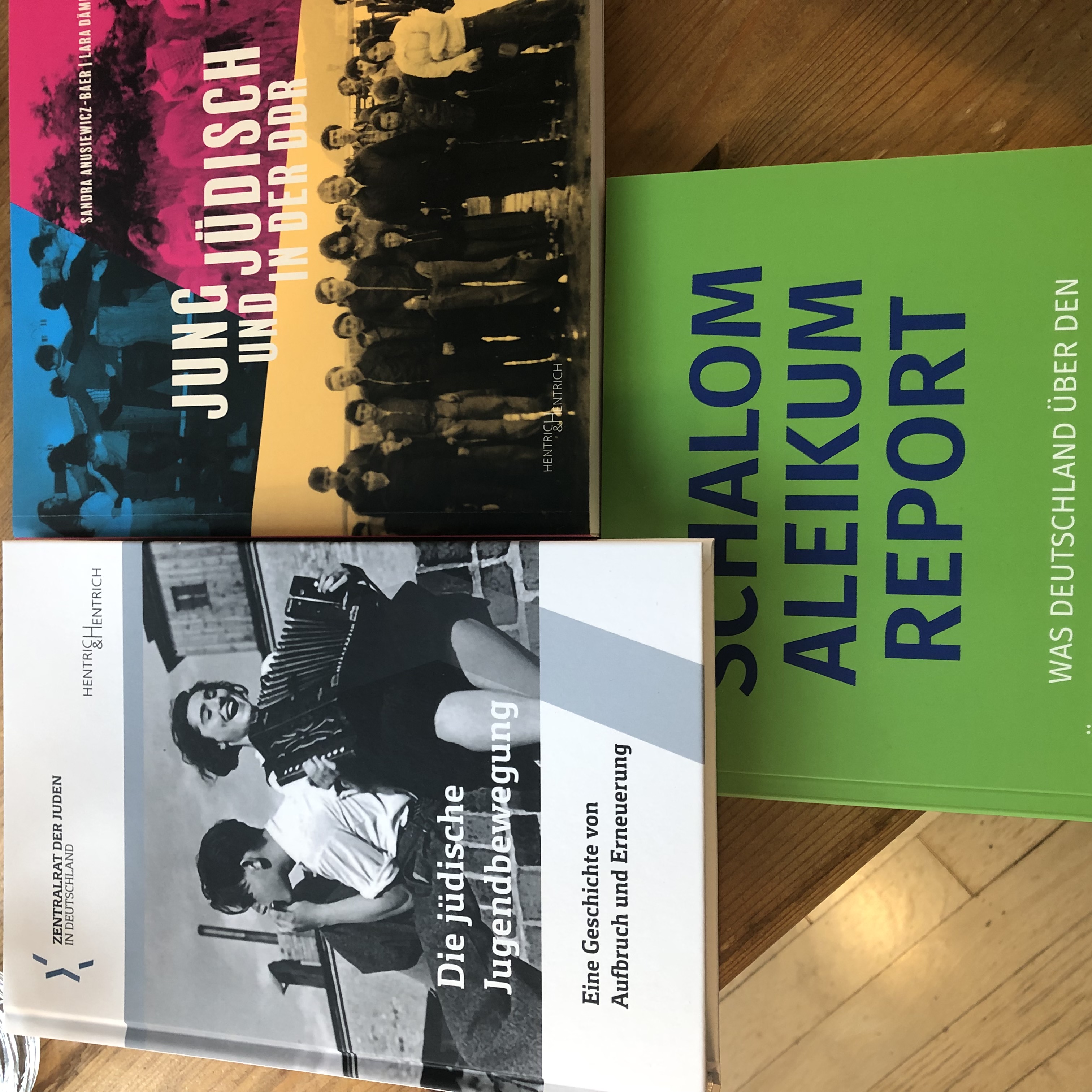
Assimilierungsbestrebungen und zionistische Emanzipation kreuzten sich mannigfaltig. Ob bündisch oder zionistisch: man strebte einer „neuen Zeit“ entgegen. In jedem Fall wurde Härte gefordert, auch in den Mädchen- und Frauen-Gemeinschaften, die innerhalb der Verbände von „männlicher Hegemonie marginalisiert“ zu werden drohten. Leiterinnen jüdischer „Mädelschaften“ sprachen sich gegen das „Salonvagabundieren“ aus. Sie postulierten einen zünftigen Rigorismus „auf Fahrt“.
mehr

Adorno vermied jeden Auflauf. Er wäre niemals in einer Gemeinschaft Skandierender mitgelaufen. Das hat er selbst festgestellt; man hat es ihm zum Vorwurf gemacht. Adorno verwahrte sich gegen die doppelte Zumutung der Aufforderung zur Beteiligung am Massenhaften sowie der Kritik an seiner Verweigerung mit einer Formulierung aus der Kreisklasse.
mehr
In Antonio Skármetas Roman „Mit brennender Geduld” ergibt sich eine Freundschaft zwischen Pablo Neruda und einem Briefträger. Irgendwann schickt der Mann ein Gedicht von Neruda seiner Angebetete, es als sein eigenes ausgebend. Neruda bekommt davon Wind und beschwert sich: „Das ist mein Gedicht”, sagt er. Der Briefträger antwortet: „Nein, Gedichte gehören denen, die sie brauchen.”
mehr

Katharina Thalbach spielt lange tapfer mit Pulswärmern. Doch dann gerät ihr Schwung in die Verlangsamung. Sie taumelt in die Neujahrsnacht. Sie spielt alldieweil mit Dominosteinen ... Jetzt könnte sie das Motto des Films zitieren: „Es gibt im Leben eine Zeit, / wo es sich auffallend verlangsamt, / als zögerte es weiterzugehen / oder wollte seine Richtung ändern. / Es mag sein, daß einem in dieser Zeit / leichter ein Unglück zustößt.“ Robert Musil
mehr

Aliyah bedeutet im Hebräischen Aufstieg. Elaboriert man den Begriff, bedeutet Aliyah das Ende der Diaspora und die Heimkehr aus der Zerstreuung. Es gab eine vormoderne Aliyah im osmanischen und post-osmanischen Palästina. Die Restriktionen unterlaufende Einwanderung (zumal im Rahmen der britischen Mandatsmachtausübung) nannte man Aliyah Bet.
mehr
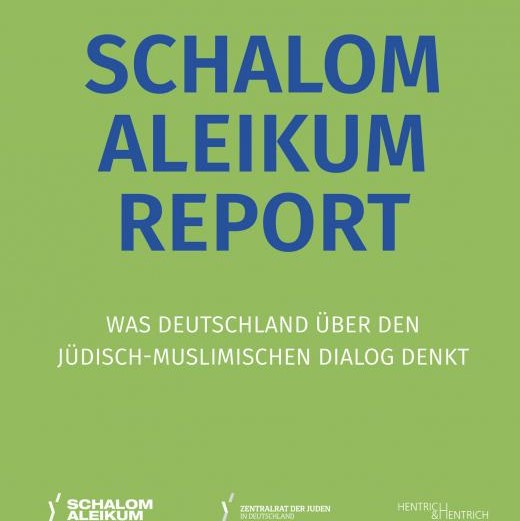
Wir freuen uns auf den fünften Band von „Schalom Aleikum“, dem Periodikum des „jüdisch-muslimischen Dialogs“. Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland Daniel Botmann und der Historiker Dmitrij Belkin erklären in einer Vorbemerkung, dass der „jüdisch-muslimische Dialog“ die ganze Gesellschaft betrifft.
mehr
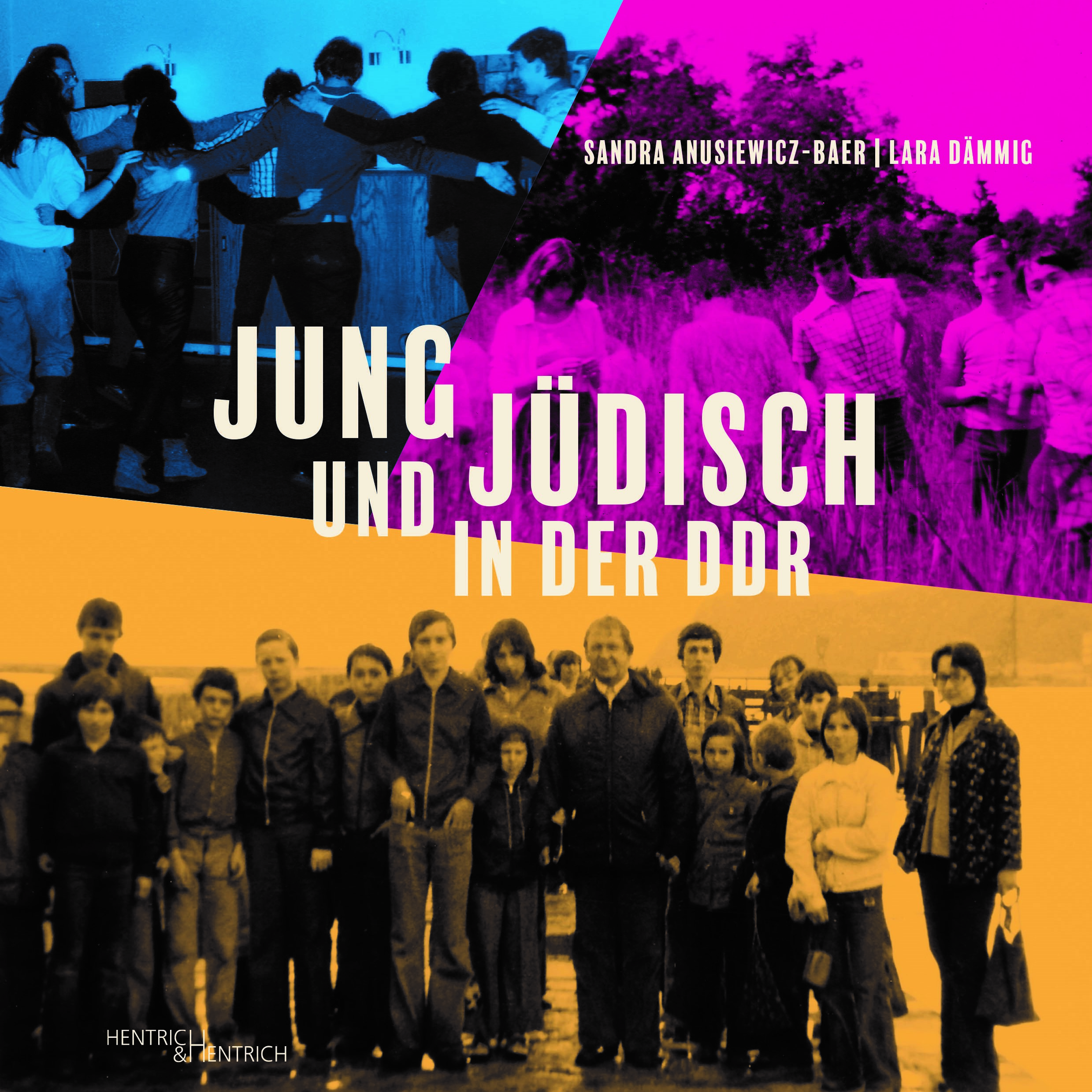
Das Ferienlager als kindliche Zentralerfahrung spielt auch in Helgas Biografie eine bedeutende Rolle. In ihren von Lara Dämmig fixierten Aufzeichnungen „Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen“ erzählt Helga von glücklichen Ferien in Boltenhagen, Güstrow, Ueckermünde und Glowe, wo dann auch ihre Kinder Erlebnisse sammelten.
mehr

„Die Schlangen sollen deine Scheiße fressen, deinen Arsch die Krokodile, die Piranhas deine Hoden.“ Das zu schreiben, hat bestimmt Spaß gemacht. Die trübe Pracht garniert einem Einschub. Der Einschub ist eine Vergegenwärtigung des „Auftrags“. Die Welt, in der Müller den „Auftrag“ schreibt, sieht an Ecken und Kanten aus wie seine Beschreibung. Ein realistischer Rahmen füllt sich mit surrealem Schaum.
mehr
Nichts zeigt deutlicher das Ende einer Epoche an als jene Frauenbilder, die in meiner Generation zur Identifikation einluden. Ich rede von Marilyn Monroe und Jayne Mansfield, deren Ikonografie in der gegenwärtigsten Lesart herabsetzenden und längst vom Markt genommenen Zuschreibungen geschuldet sind. Der letzte Schrei von gestern verhallt nicht als geachtete Ladenhüterin im kulturellen Gedächtnis ...
mehr

Die Verfasser:innen der Beiträge sind Partizipant:innen der Geschichte, die sie memorieren. Zugleich sind sie Schrittmacher:innen der Entwicklungen, die sie referieren. „Die Geschichte der jüdischen Jugendbewegungen (interpretieren sie) als prägnanten und zugleich ambivalenten Ausdruck des Modernisierungsprozesses mitteleuropäischer Gesellschaften.“
mehr
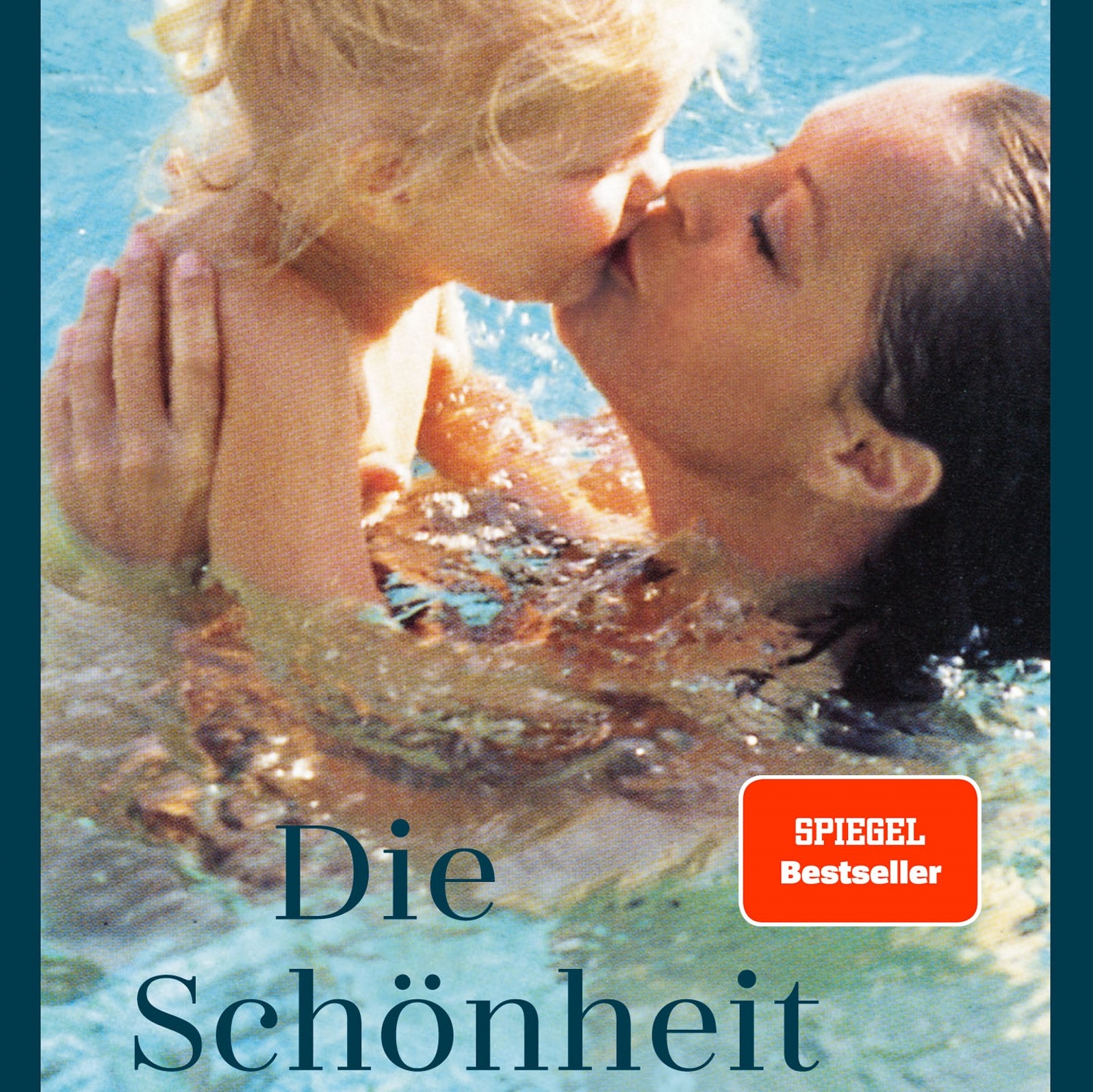
Einmal wählt das Kind den Vornamen des Vaters als Anrede und versteht die Aufregung nicht, die das auslöst. Für seine Tochter will Daniel Biasini „nur eine Identität haben, die des Vaters“. Jahre später sieht sie sich selbst außerstande, den Unterschied zwischen der Schauspielerin und ihrer Mutter Romy Schneider in einem öffentlichen Rahmen zu fassen.
mehr
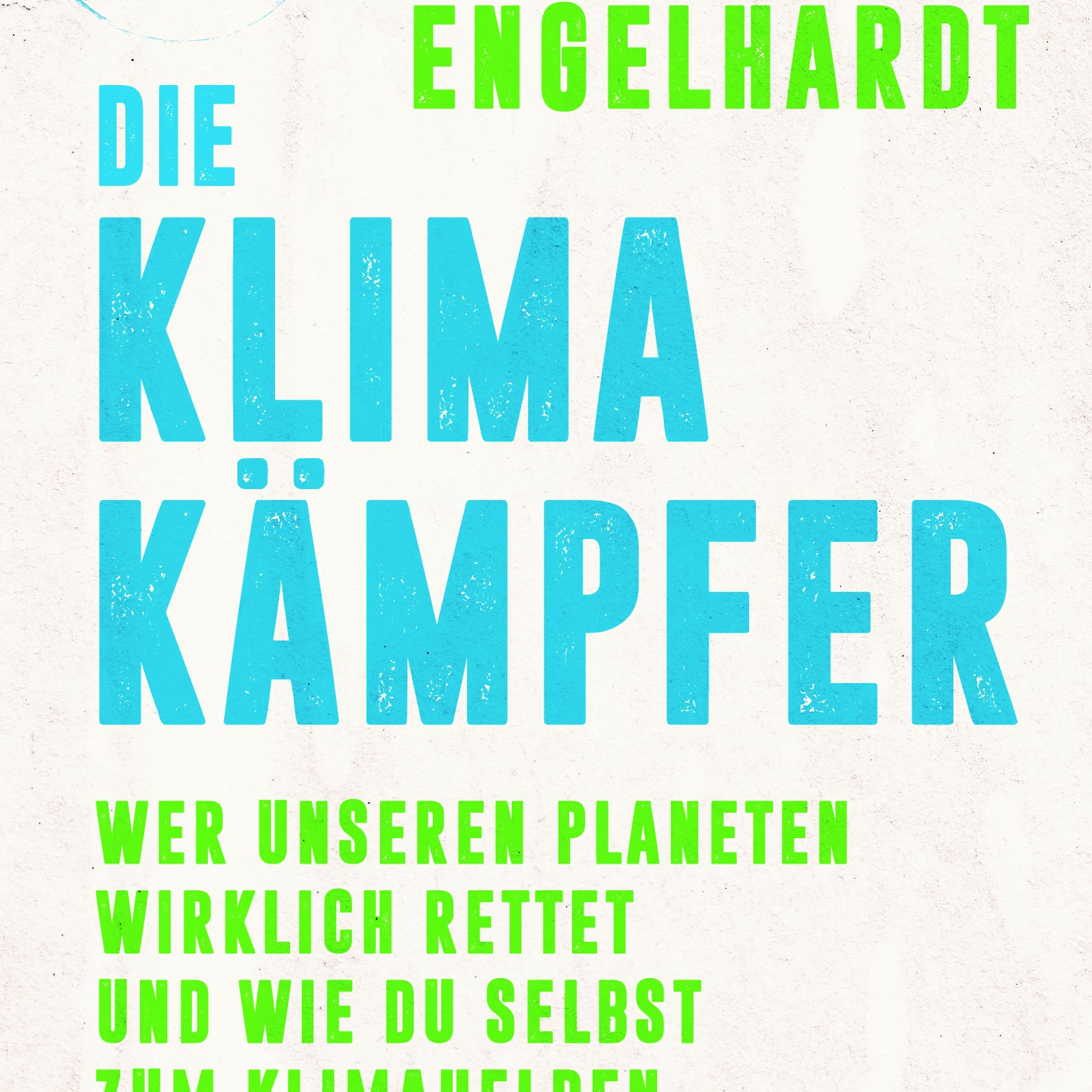
„Der Permafrost taut, der Amazonas brennt, die Pole schmelzen. Der Klimawandel scheint unaufhaltsam voranzuschreiten. Ist Widerstand also zwecklos? Auf keinen Fall, wie die hier vorgestellten Klimakämpfer beweisen. Überall auf der Erde setzen sie sich mutig für den Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit ein, wehren sich gegen Raubbau, Lebensmittelverschwendung und Klimakrise. Die Weltreporter haben diese heimlichen Heldinnen und Helden auf dem ganzen Globus besucht und begleitet.“
mehr
„Wahrscheinlich hasse ich das geschriebene Wort, ganz egal wie ich es gebrauche“, schreibt sie Paul Bowles 1947. 1950 meldet die Autorin: „Wenn ich mein Buch nicht zustande bringe, gebe ich das Schreiben auf.“ Die Rede ist von Jane Bowles zweiten, nie vollendeten Roman. „Und dann entweder Selbstmord oder ein anderes Leben.“ In einem Geschäftsbrief findet sich die Zeile: „Lieber Mr. – Wenn das Geld nicht bis Dienstag da ist, erschieße ich mich.“
mehr
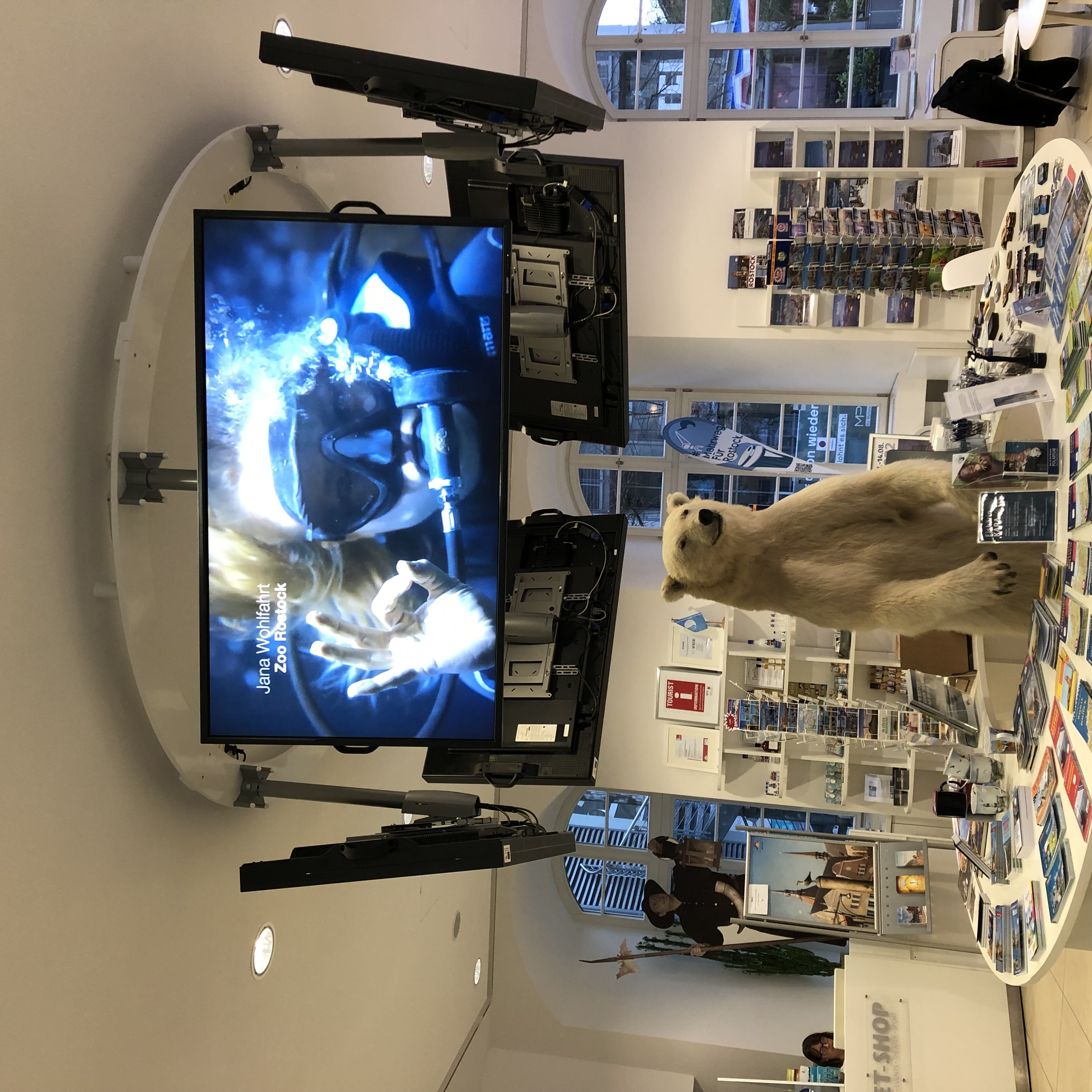
Anfang der Sechziger geht Schleef nach Berlin und studiert in Weißensee Bühnenbild. Er wirkt an lauter ersten Linien, die Mutter versteckt seine Tagebücher vor dem Vater und der Stasi unter den Kohlen im Keller. „Was sagen all diese Bücher über mich aus?“, fragt er sich. „Ach, es ist so viel Unwahres darin, so viel Lüge und Widerspruch.“
mehr

Als Gefangener der Wehrmacht gelangt Milo Dor 1942 nach Wien. Er wird von „rückwärtsgewandten Utopien“ überrascht, denen „Nachkommen des untergegangenen Vielvölkerstaates“ rauschhaft und fiebrig anhängen. Die ordnende Kraft der Habsburger Monarchie ist die beliebteste (abgegriffenste) Spielkarte der umlaufenden Klischees.
mehr

„Der Hildesheimer hat gesagt, daß er es für sinnlos hält, heute noch zu schreiben … (da es keine Nachwelt mehr gibt.) Das ist etwas ganz Defätistisches. Wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich sie doch, weil ich diese Arbeit gern mache, weil ich sie so gut machen will wie ich kann. Da ist es doch uninteressant, ob das fertige Produkt morgen in einem Museum steht oder wie eine Flaschenpost im Atlantik treibt.“
mehr
Ein kleiner Spielraum genügt dem großen Grauen. Die sofort überlasteten Zuschauer:innen sehen ein Stück „inszenierter Wirklichkeit“ (Henning Fülle); kommen aber kaum dazu, das zu begreifen. Die Erpressungen, denen die Delinquenten ausgesetzt sind, erreichen das Publikum als monumentale Zumutung. 'The Brig' handelt von den pervers-kafkaesken Zuständen ...
mehr
Dem Faschismus nach Amerika entgangene deutsche Theaterleute gründeten und inspirierten das Living Theatre und andere Motoren der Avantgarde, während in Westdeutschland der bürgerliche Theaterbetrieb aus dem letzten Loch pfiff. Bemerkt wurde die Misere von Walter Höllerer, der Anfang der 1960er Jahre ein omnipräsenter Erklärer war.
mehr

Tanja hält an ihrer Mundart fest. Die Steilküste ihrer Kindheit hängt als Bild in dem Schachtelreich über Doris' Silberblick. Tanjas merkwürdige Bleibe ist eine Sehenswürdigkeit. Früher hausten in solchen den Treppenhäusern und Versorgungslabyrinthen abgetrotzten Räumen Faktoten; lemurenhaft-gespenstische Erscheinungen ...
mehr
Halimi moniert den „frauenfeindlichen Geist der Revolution von 1789 ... der den Bürger für mündig erklärt hatte und die Bürgerin für politikunfähig“. Als parteiungebundene, mit François Mitterands Sozialist:innen lediglich assoziierte Abgeordnete erlebte Gisèle Halimi ihre alltägliche Demontage. Mitterand sei ein Chauvinist alter Schule gewesen, charmant und herablassend.
mehr
Sein Gesicht hält dem erdgeschichtlichen Budenzauber stand, der in dem frühen Spätwestern One Eyed Jack 1961 als Kulisse herangezogen wurde – all die Tafelberge, Schründe, Kegel, Dolmen, Gipfel, Canyons, Reliefs, säulenförmige Mammutsukkulenten, Dünen, Kämme und Grate - sowie der kalifornisch-pazifische Brandungsschick unter einem dramatischen Himmel.
mehr

Ständig klingelte ihr Telefon, von einem Freund war den ganzen Abend nicht die Rede. Lydia schwärmte routiniert für frische Petersilie und Pfefferminze. Sie war in Indien, Pakistan, Afghanistan als Rucksacktouristin. Sie strahlte vehement, anscheinend eingenommen von Tillmanns vulkanischer Ruhe.
mehr

Anfang der 1950er Jahre lebt Müller illegal in Berlin. Am Westen interessieren ihn nur die Filme, in jeder S-Bahnstation gibt es ein Kino. Müller kommt aus der Kleinstadt, da sind „die Ungerechtigkeiten persönlicher“. Er dichtet wie der Weise vom Berg: „Ihr lasst euch gern in euren Flüssen treiben / den sommerlichen, wenn der Himmel brennt ...“
mehr

Ergreifend gut passt das Paar in die Gegend. Lockere Leute. Doch dann tritt ein schwarzer Hüne im rosa Hemd auf, und neben ihm schwebt ein Fotomodell ein. Wahrscheinlich gibt es kein größeres rosa Hemd auf Erden, es platzt trotzdem gleich.
mehr

Bianca erfüllt alle Bedingungen an eine Selbstoptimiererin nach dem aktuellen Standard. Sie luncht „zweckmäßig“, überholt sich selbst auf dem Laufband, brilliert funktionselitär als Keyboard-Warriorin. Sie ist „flink“ und fluffig und trotzdem ganz und gar Gefangene eines merkwürdigen Fluchs. Wo Bianca aufkreuzt, fängt die Welt an zu lecken.
mehr
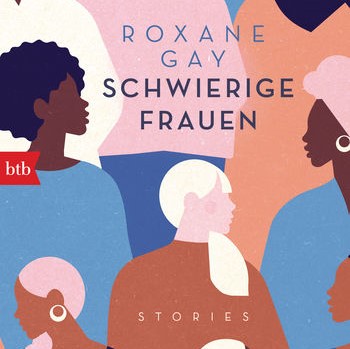
Feministische Verve und schriftstellerisches Vermögen - Roxane Gay entlarvt Innenverkleidungen der Attitüden im Geschlechterkampf als psychologisches Sperrholz.
mehr
Die Frauenrechtlerin und Anwältin Gisèle Halimi kämpfte ihr Leben lang leidenschaftlich für die Freiheit und die Gleichberechtigung der Frauen. Sie starb im Juli 2020 mit 93 Jahren in Paris. „Seid unbeugsam!“ ...
mehr
Nach dem Selbstmord eines Bruders hält Eberhardt nichts mehr in Europa. Sie trennt sich nicht nur von dem Kontinent, sondern auch von ihrem Verlobten, einem Diplomaten des Osmanischen Reichs. Die Zivilisationsmüde eilt nach Tunis, erwirbt den Hengst „Souf“ und reitet allein durch die Wüste nach Algerien. Born to be wild in einer polyglotten Variante.
mehr
1685 machte Ludwig XIV. Schluss mit dem Protestantismus in Frankreich. Er schuf die reformierte Kirche ab und kurbelte so die Wirtschaft in den Nachbarländern an. Landgraf Carl von Hessen-Kassel (1654 - 1730) rieb sich die Hände, er gewährte Hugenotten Siedlungsfreiheit. Geflüchtete bauten die Kasseler Oberneustadt. Sie revanchierten sich, indem sie in der Residenzstadt den Merkantilismus modellhaft auf die Spitze trieben.
mehr
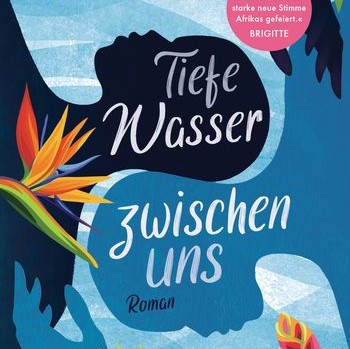
Hassana und ihre Geschwister, darunter die Zwillingsschwester Husseina, verbringen eine idyllisch-urwüchsige Kindheit in der Gegend von Djenné. Die Stadt im Delta zwischen Niger und Bani zählte zu den Hotspots des (in vorislamischer Zeit entstandenen, in der Handlungsgegenwart nicht mehr relevanten) Songhaireiches. Eines Tages überfallen Menschenjäger:innen Hassanas Dorf. Sie ignorieren Familienbande und beenden die Zwillingssymbiose.
mehr

Stunden vor dem Erlöschen des Großbritannien vom Völkerbund übertragenen Mandats für Palästina am 14. Mai 1948 traf ich Alan Cunningham im King David Hotel, wo die britische Administration untergebracht war. Ich wunderte mich über die Ruhe im Haus. Es herrschte keine Auf- oder besser Abbruchstimmung. Jemand spielte Ohrwürmer von Benny Goodman auf einem Klavier.
mehr
Simmel holt aus. Mühelos schlägt er einen Bogen von Judy Garland via Seidenhemden und Transatlantikflügen zum Ödipuskomplex. Das sind Ingredienzien der Droge Simmel, die heute keinen mehr vom Hocker reißt. Sie wirkte aber im Schleiflack-Muff angehobener Massenquartiere. Ich las mir die Ohren heiß. Die indirekte Kapitalismuskritik eines Casanovas des XX. Jahrhunderts entging mir selbstverständlich nicht.
mehr
Wer regelte 1971 in Hamburg den Verkehr für Monika Ertl, als sie (angeblich) Roberto Quintanilla Pereira mit drei Kopfschüssen hinrichtete? Sie nahm gekonnt Rache. Ihr Vater hatte in Bolivien eine Kunstschützin und Herrenreiterin aus ihr gemacht. Monika konnte auch Golf, sie pendelte zwischen Camouflage und Robe. Der Mord quittierte (nach einer Legende) eine von Pereira befohlene postume Entwürdigung Che Guevaras ...
mehr
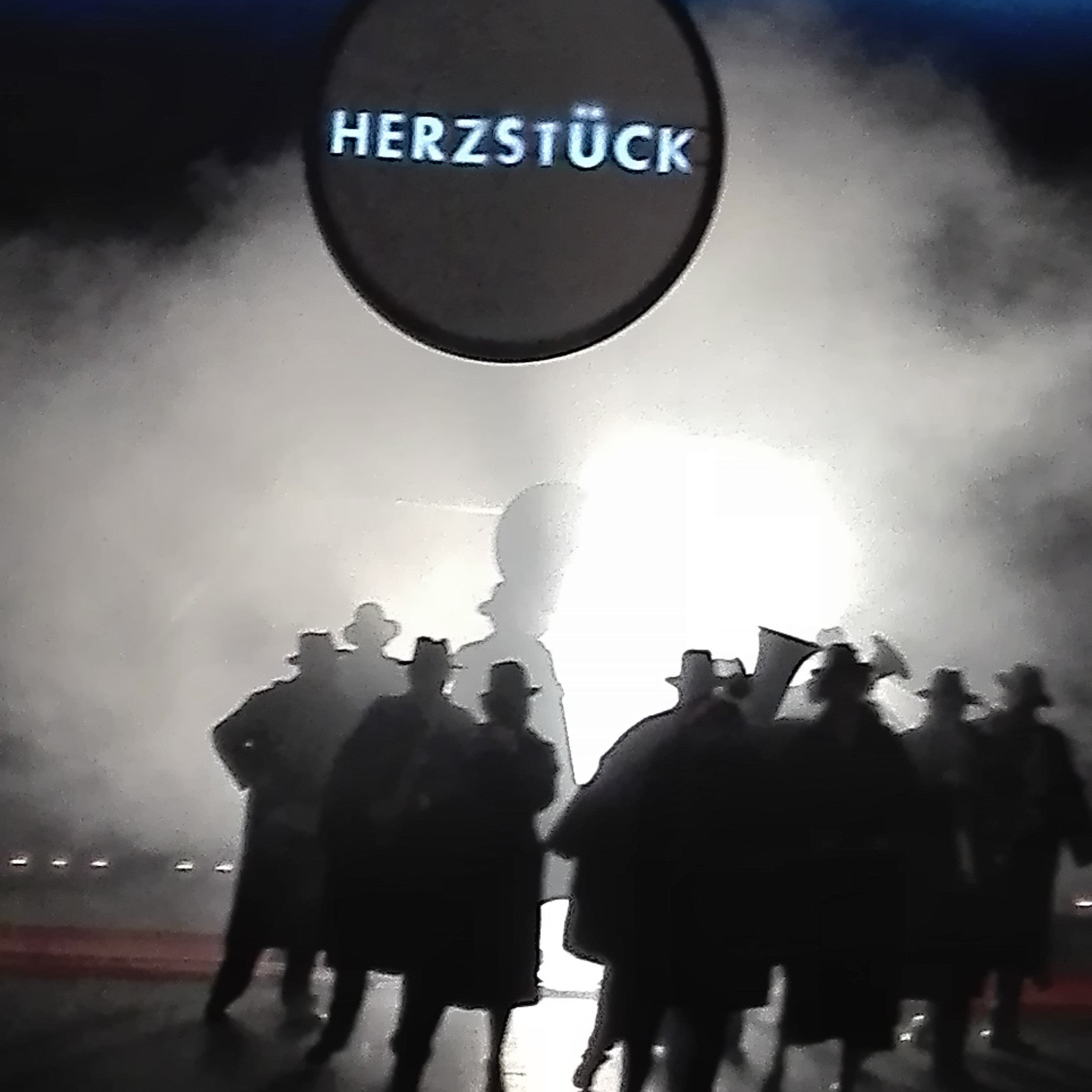
Lew Kopelew und Alexander Solschenizyn liefern den Abgrundszenarien des Kalten Krieges traumhafte Bilder aus einer ewigen schwarzweißen Winterwelt. Der „anti-imperialistische Schutzwall“ wirkt wie ein Embargo. In der Ostsee-Zeitung stellt ein Obermaat fest: „Durch das Bestehen unserer Armee und durch ihre feste Waffenbrüderschaft mit den Armeen des Warschauer Paktes ...“
mehr
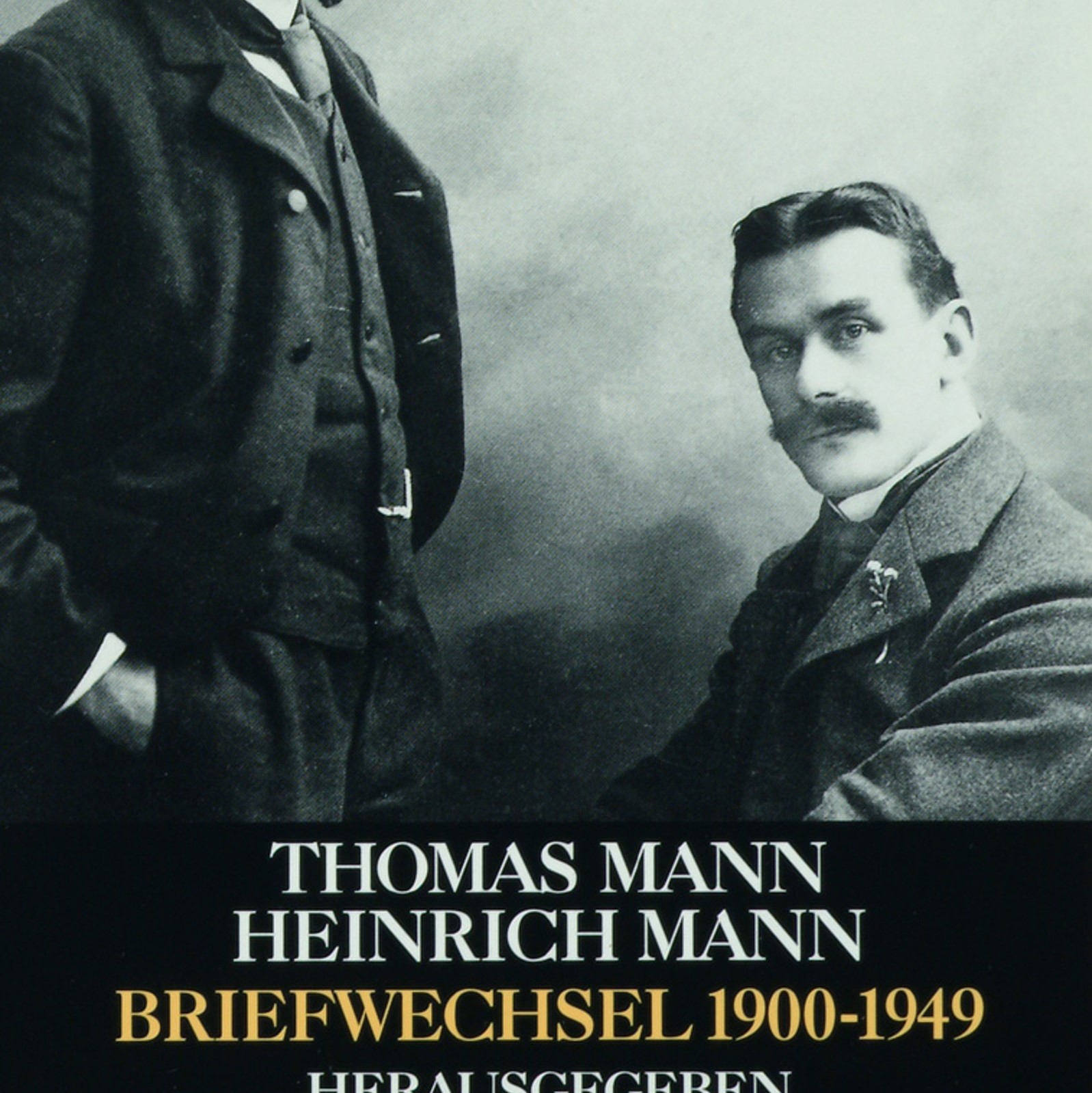
Im Dezember 1910 stirbt Samuel Lublinski. Thomas Mann erwähnt den Tod des Publizisten in einem Brief an seinen Bruder Heinrich. Er führt aus: „(Theodor) Lessing veröffentlichte in der 'Schaubühne' einen Nekrolog von so milder Verlogenheit, dass man sich erbrechen könnte.“ Als Lessing 1933 von Nationalsozialisten ermordet wird, vertraut Mann seinem Tagebuch an ...
mehr
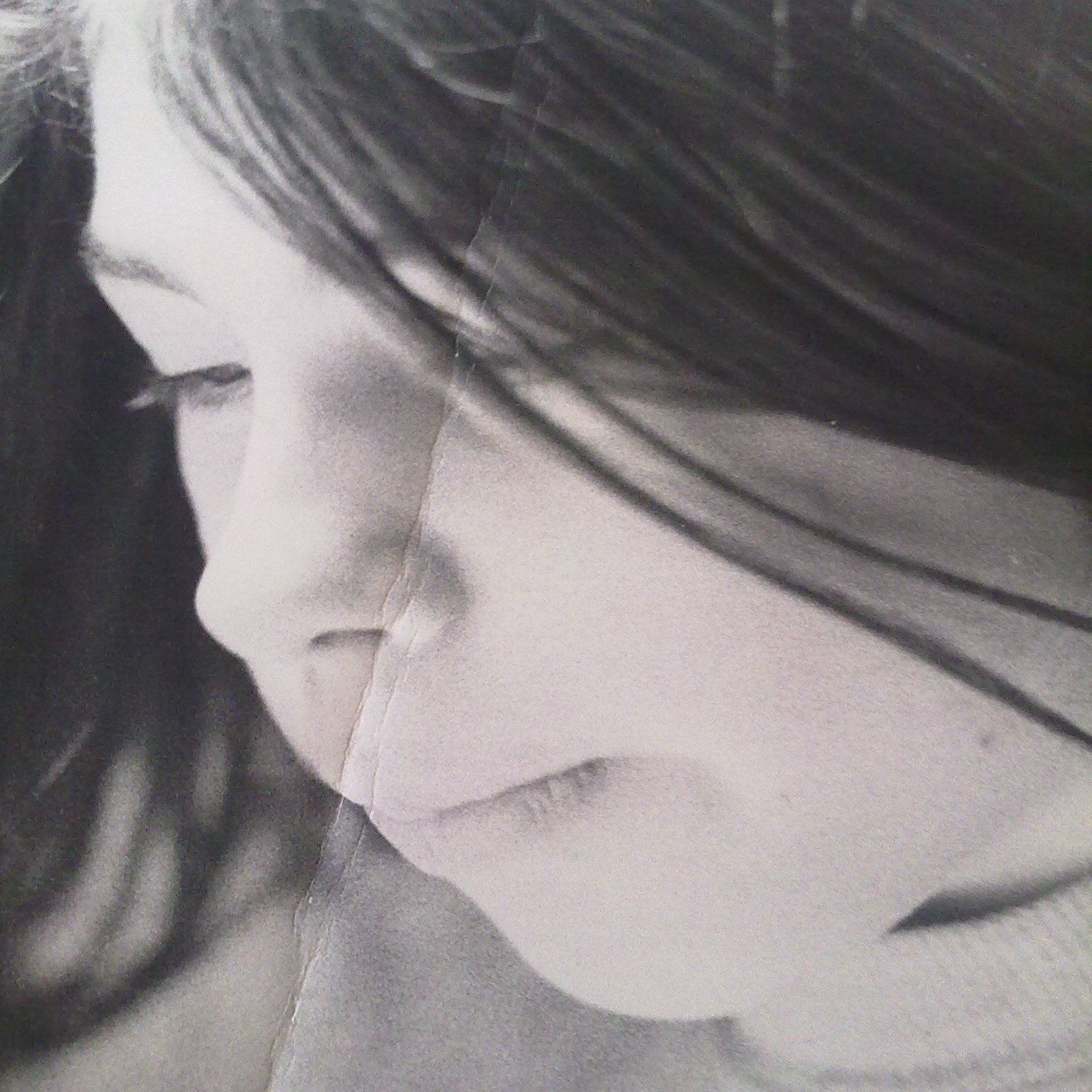
Siegfried Unseld legte sich einen Jaguar zu, um Max Frisch einzuholen, der nicht nur großbürgerlich auftrat, sondern so auch vorfuhr. Dann holte Hermann Burger im Ferrari Testarossa auf und erwies sich als uneinholbar auf seiner letzten Fahrt von Suhrkamp durch den Gotthardtunnel zu S. Fischer in Ffm-Sachsenhausen. Burger starb neunundachtzig mit sechsundvierzig.
mehr
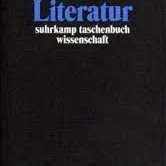
„Den Satzzeichen gegenüber befindet der Schriftsteller sich in permanenter Not; wäre man beim Schreiben seiner selbst ganz mächtig, man fühlte die Unmöglichkeit, je eines richtig zu setzen, und gäbe das Schreiben ganz auf.“
mehr
Der Roman erschien erstmals 1944 in der anglo-amerikanischen Hemisphäre. Stefan Heym schrieb ihn als Soldat* in der letzten Phase vor dem D-Day. Während alle anderen auf Englisch erstveröffentlichten Werke schließlich übersetzt wurden, blieb „Of Smiling Peace“ zu Heyms Lebzeiten für deutsche Leserinnen eine fremdsprachliche Trouvaille.
mehr
1984 hymnisiert Springsteen seine Growing-Up-Smalltown-Prägung. Er wähnt sich eingespeist in einen Geschichtsprozess. Er begreift die Kleinstadt seiner Herkunft als Schicksalsschauplatz. Gebunden fühlt er sich an „die guten und die schlechten Dinge“. Springsteen solidarisiert sich postum mit den Akteuren der Newark-Riots von 1967. Damals titelte die Zeit: „N...aufstand in Newark Schwarzes Elend hinter weißer Fassade“.
mehr
„Peter Stein, Jürgen Flimm und ich: alle (kamen vom Studententheater und) spielten Brecht … Wir hatten es sehr leicht. Unsere Gegner waren die Patriarchen … Ich bin Achtundsechzig noch einmal geboren worden … Wir waren natürlich blöd und hatten nur das Protestgefühl.“ Handke habe „außenseiterisch den Hauptstrom der Zeit subkutan erfasst“.
mehr

Tania G. ist ein Russenkind, hervorgegangen aus der flüchtigen Begegnung ihrer Mutter mit einem Besatzungssoldaten ... Unter dem Druck der öffentlichen Meinung knickt die Mutter ein und gibt das Kind zu Verwandten. Mit einem Mann aus der Gegend gründet Tanias Mutter eine „normale“ Familie, von der Tania ... ausgeschlossen wird.
mehr
Da ist ein Speakeasy für Literatur, ein Hinterzimmer für Geistreiche, ich finde, das klingt pathologisch. Thomas Kapielski, Charlottenburger von Geburt und Nasenflötist aus Passion, liest „Neue sezessionistische Heizkörperverkleidungen”. „Noch vor Anbruch der Nüchternheit bleicht Morgengraun die Schwärze” heißt es. Bald nimmt „Zuversicht” die “Gestalt von Milchreis an”.
mehr
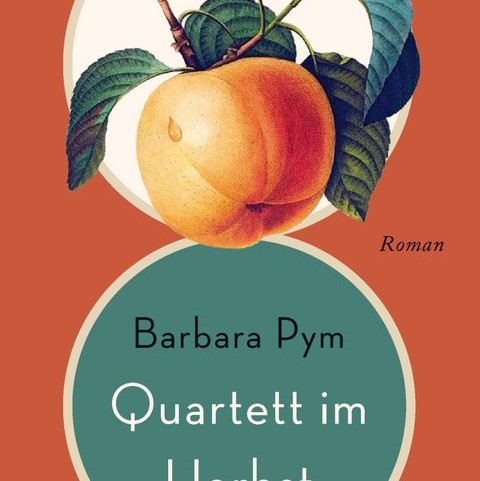
Barbara Pym arrangiert Marotten ergrauter Angestellter zu einem Bouquet heimeliger Tristesse. Dazu gehören die Enthauptungen von „Geleepüppchen“, das psychoanalytisch aufschlussreiche Versagen der Tischmanieren, eine manierierte Handhabung abgenagter Hühnerbeine und umständliche Teebeutelprozeduren. Die Ramschprozessionen vollziehen sich auf engem Raum.
mehr
„Keine Privatschule und keine der großartigen britischen Universitäten hatte diese revolutionären Jungs hervorgebracht, sondern eine zerbombte Hafenstadt im Norden.“ Hanif Kureishi
mehr
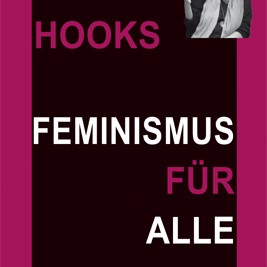
Der erste Schritt hin zu einem revolutionären Feminismus führt zur Schärfung des Bewusstseins. Aus dieser Einsicht entstanden in einer von der Autorin angenommenen Latenzzeit bewusstseinsbildende Gruppen, in denen Auseinandersetzungen über Strategien „der (politischen) Interventionen und Transformationen” zugunsten einer therapeutischen Praxis vernachlässigt wurden.
mehr

In Erwartung einer amourösen Unterhaltung fiebert der Erzähler tagelang einem von Robert de Saint-Loup arrangierten Rendezvous entgegen. Schauplatz der Begegnung soll eine Insel im Bois de Boulogne werden. Sie zählt zu den Sensationen der Künstlichkeit aus der Louis Bonaparte-Ära.
mehr
Wer andere ausschließt, schließt sich schon länger nicht mehr sichernd ein, sondern vollkommen ungesichert aus. Auch Sabine Hark liefert einem neuen Wir starke Argumente. Die Autorin bezieht sich auf Bernice Johnson Reagon, die in der Keimzeit von Reagans Präsidentschaft Anfang der 1980er Jahre bereits wusste: „Niemand könne (im Sinn von solle) mehr davon ausgehen, dass wir nur mit jenen Menschen zusammenleben ... die so sind wie wir selbst.“
mehr

Er liebte den Nebel, die Unschärfe, eine unklare Geografie. Jules Renard (1864 - 1910) führte das Leben eines Verstimmten. Früh wähnte er sich am Ende seiner Kräfte.
mehr
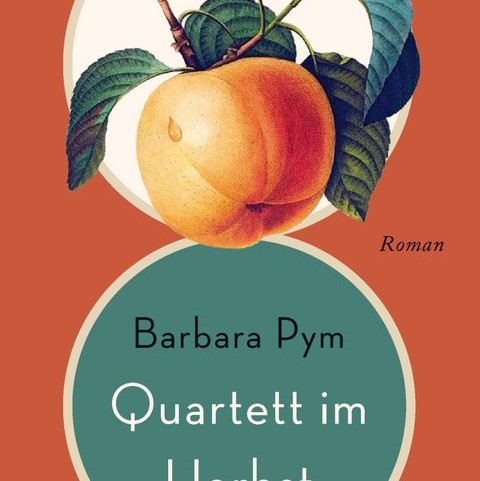
Lauter verpasste Gelegenheiten bilden eine Kette aus Enttäuschungsperlen. Jahrzehnte ist Letty eine hingebungsvolle Romanleserin, vorderhand angetrieben von dem Wunsch nach „geistiger Fortentwicklung“. In Wahrheit sucht sie narrative Spiegelungen ihrer Existenz.
mehr

Das Epochennukleus der elisabethanischen Renaissance war die Zerschlagung der Armada. Sie beendete die spanische Vormachtstellung auf den Weltmeeren. Die maritime Suprematie ging über auf das Vereinigte Königreich. Britannia, rule the waves! Kein anderer Vorgang wirkte so stark auf die Zeit, in der Shakespeare lebte. Trotzdem ist an keiner Werkstelle direkt davon die Rede.
mehr
Roberto Rossellinis „Rom – offene Stadt“ ist eine schwarzweiße Enttäuschung aus dem Jahr 1945. Der Zweite Weltkrieg ist noch nicht zu Ende, als der römische Regisseur Roberto Rossellini in seiner Stadt einen Film dreht, der den Faschismus einer fremden Macht zuordnet und die katholische Freiheitsliebe dem Volk am Tiber.
mehr
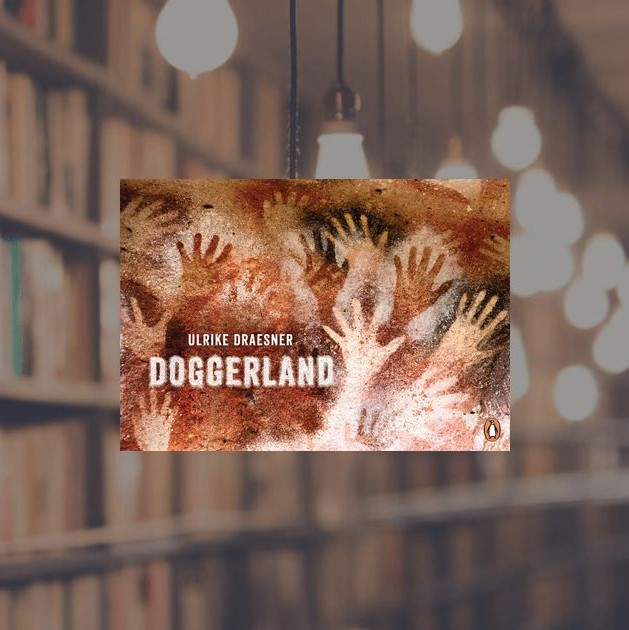
"In einem großen vielstimmigen Gesang lässt Ulrike Draesner die versunkene Welt Doggerlands für uns entstehen: eine grüne, hügelige Landschaft mit weiten Ebenen, Flüssen und Seen, die heute unter den Wassern des Ärmelkanals liegt. Ihre früheren Bewohner suchen Sprache, begegnen anderen Hominiden, erforschen Flora und Fauna."
mehr

Der Kolonialismus hatte im 19. Jahrhundert auch noch im letzten Krähwinkel seine Resonanzkörper. Die untüchtig Zurückgebliebenen kannten sich auf ihre Weise damit aus. Sie konsumierten Kolonialwaren so wie sie die Erzählungen von den Wilden im Westen konsumierten.
mehr
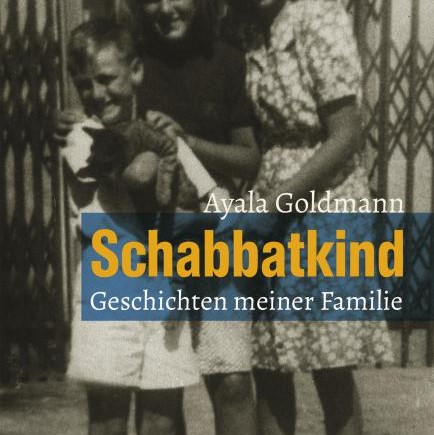
Nach dem Tod des Vaters erinnert die Erzählerin Rituale ihrer Kindheit. Sie ergaben sich auf einer Kreuzung zwischen Tradition und Skepsis ... einer säkularen, den religiösen Rigorismus moderierenden Praxis und offensiver Verweigerung.
mehr
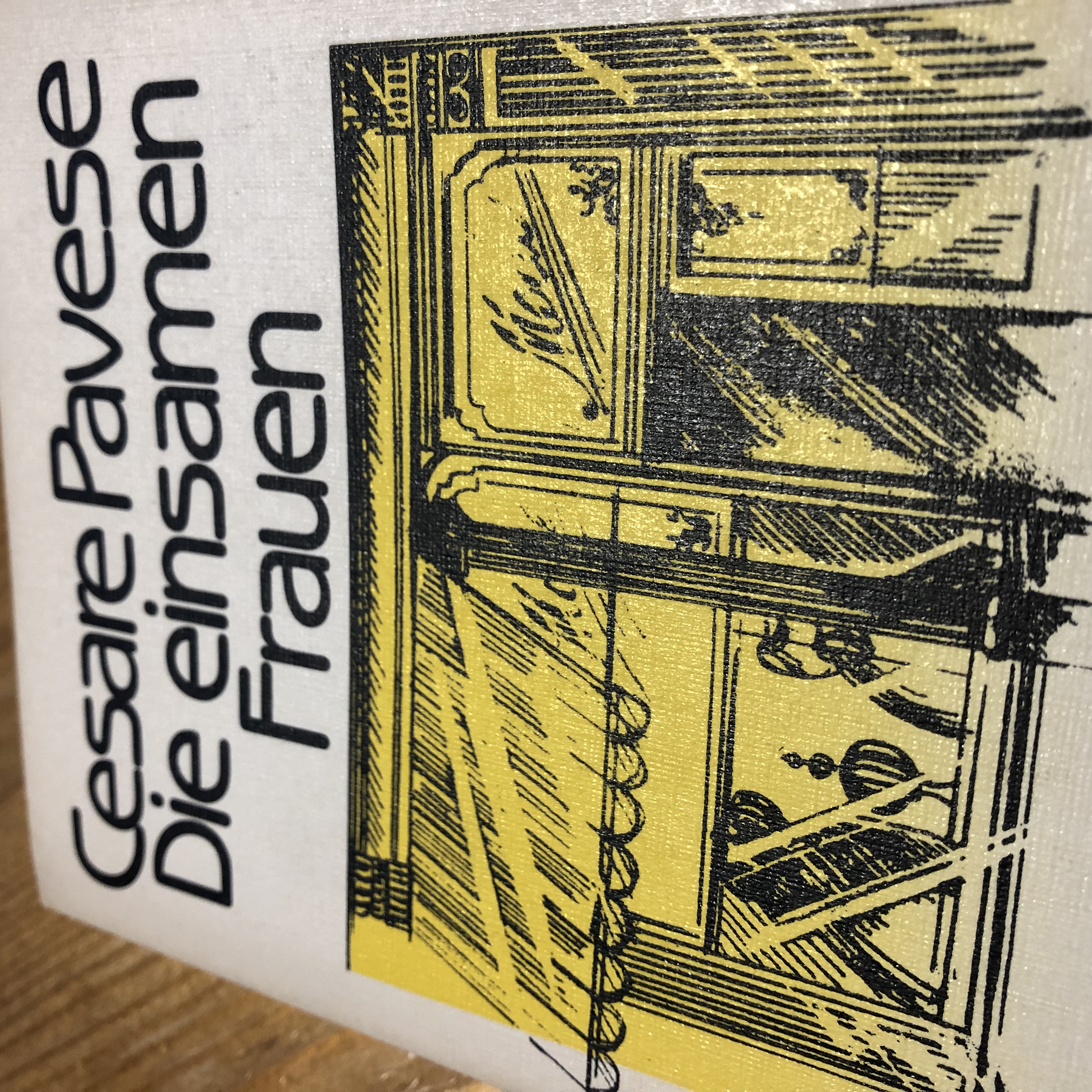
„Die einsamen Frauen“ - Ich habe den 1949 erstmals erschienenen Roman in beinah jedem Lebensjahrzehnt wenigstens einmal gelesen. Eine stabile Düsternis zeichnet das Werk aus. Ich denke heute nicht anders darüber als vor vierzig Jahren. Das ist italienischer Existenzialismus ...
mehr

Adorno dekonstruiert Heidegger. Wer sich anschicke, „das echte Sagen“ für sich zu beanspruchen, habe mehr nicht als „mindere Heimatkunst“ auf der Pfanne. Adorno entdeckt eine billige Absicht, die mit einer noblen Anschrift lediglich verbunden wird, wenn es um die Heidegger’sche Hölderlinverherrlichung geht.
mehr
Der Namenlose labert und wabert in einem Souterrain an der Petersburger Peripherie. Überschießender Selbsthass verleitet ihn zu einem solistischen Selbstschmähungsfestival; einer solipsistischen Orgie.
mehr
Poes erste öffentlich gemachte Schauerschote lässt sich gut als Parodie auf das German Gothic-Genre lesen. Sie erlaubt ebenso ihre Wahrnehmung als ernsthafte Adaption. Der Debütant reichte den Text 1831 beim Philadelphia Saturday Courier als Wettbewerbsbeitrag ein.
mehr
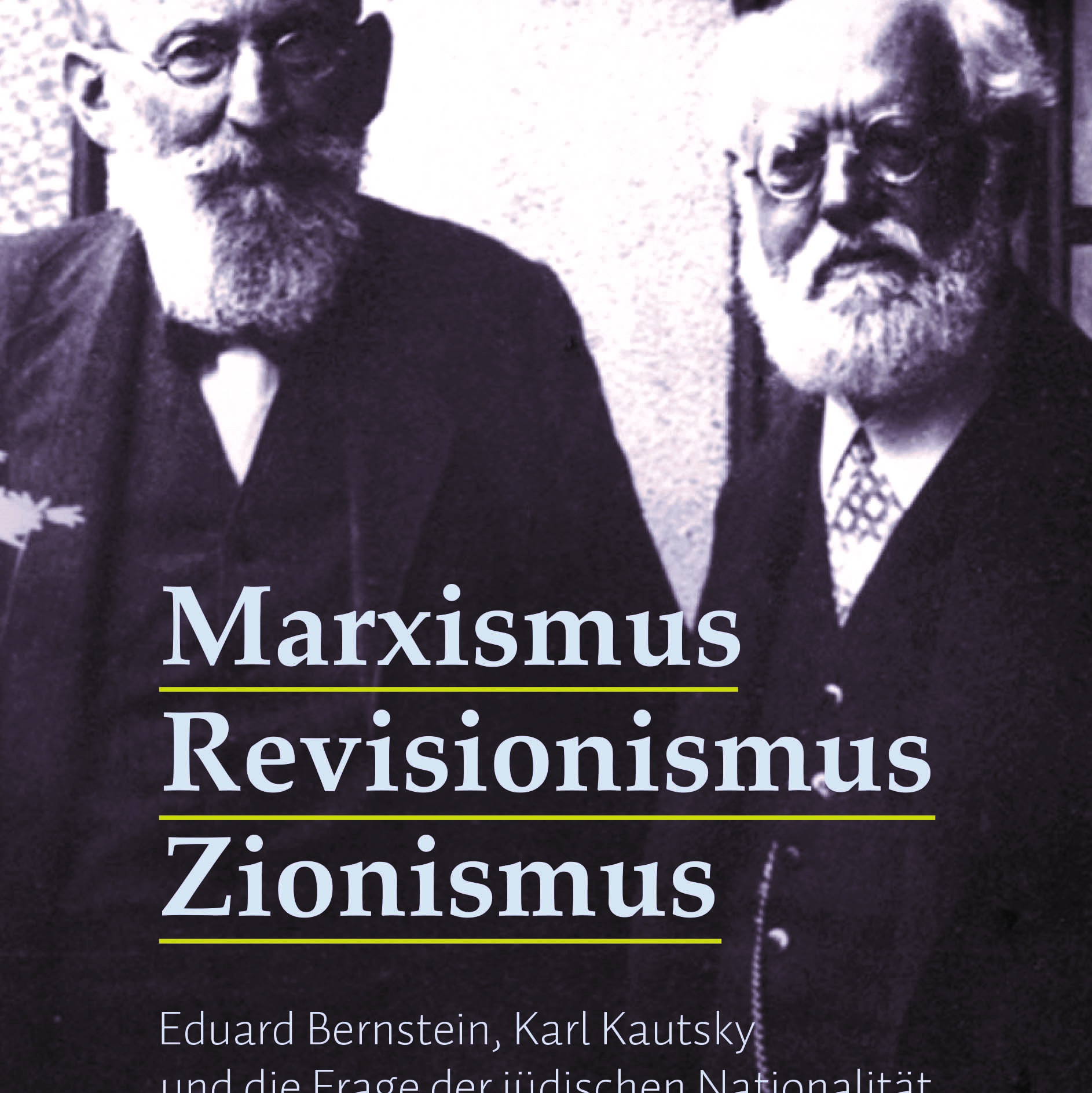
Zunehmender Antisemitismus erzwang die Verknüpfung der „Judenfrage“ mit der nationalen Frage unter sozialistischen Vorzeichen. Bernstein und Kautsky diskutierten den intellektuellen Dreisprung Jude - Nation - Sozialismus als führende Köpfe ...
mehr

„Ich irrte spätnachts durch diese Mondlandschaft, wo die körperliche Begierde vollends jedes Gefühl ersetzt hat ... (ich) vögelte mit der Wonne eines Kindes, das aus Versehen in einen Süßwarenladen eingesperrt wurde, und schrieb alles auf.“ Dies oft genug zu der Musik von Bob Marley.
mehr
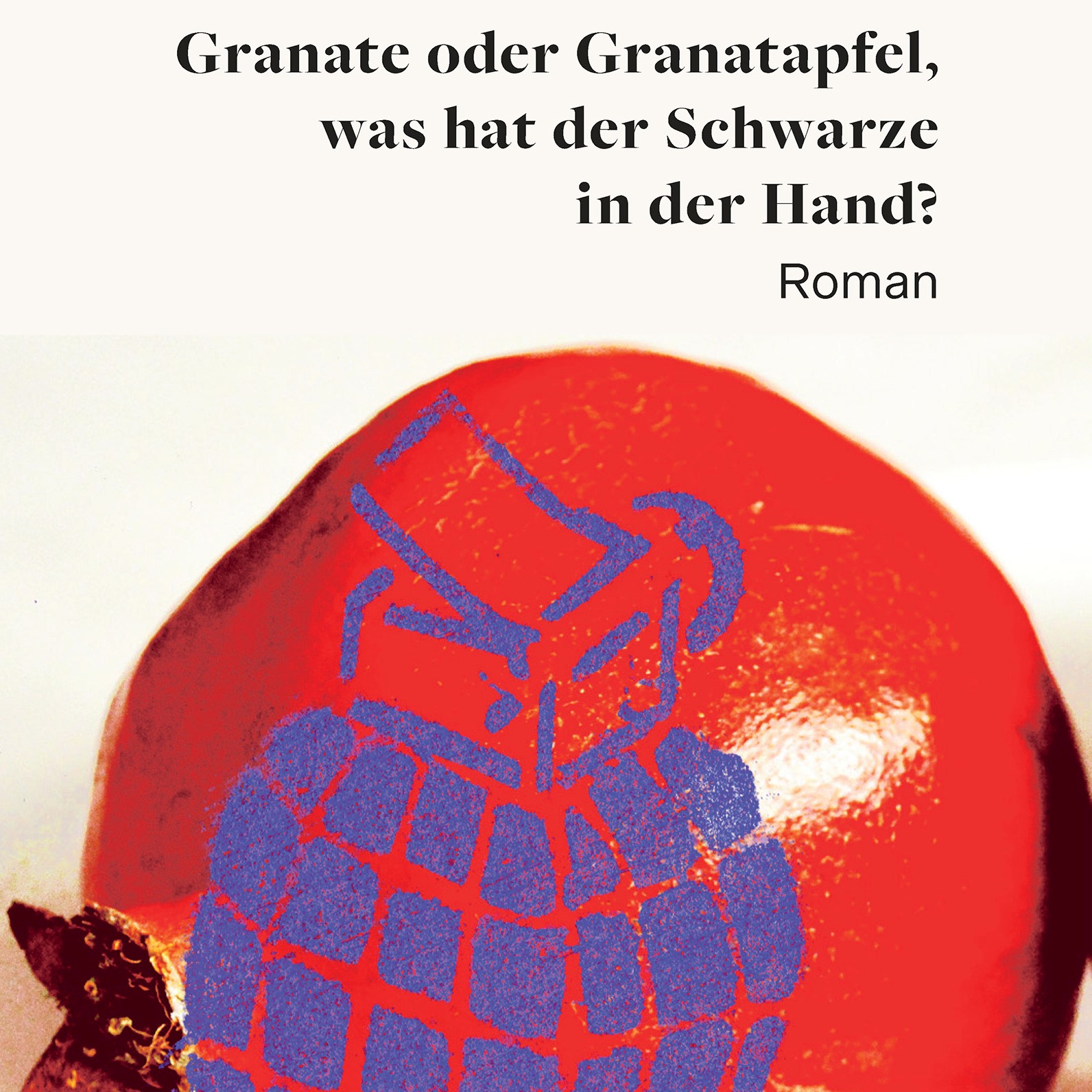
Es kommt vor, „dass ich ein Mädchen mit zu mir nehme, ohne sie überhaupt nach dem Namen gefragt zu haben“. Trotzdem verbringt Laferrière die aufregendste und vor allem glücklichste Zeit mit Dostojewski in der Badewanne ...
mehr
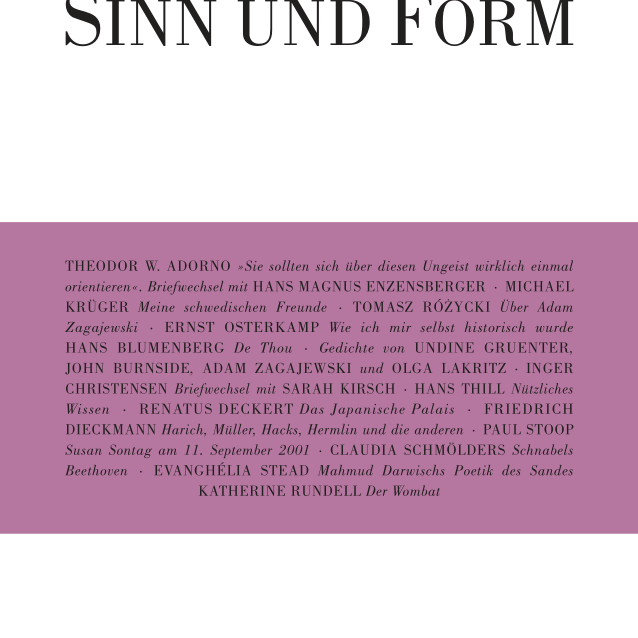
Enzensberger erkennt die Ladung der Kritischen Theorie. Sie schließt „jeden Akt der Versöhnung“ aus. Dies mit hyperbourgeoisem Gestus ex cathedra zu verkünden, ist ein Raumflug des Geistes, der Bewunderung hervorrufen muss.
mehr
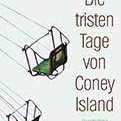
Stephen Crane zeigte sich als Meister der Schnurre; der über dem Pfeifenkopf (in eine aromatische Rauchwolke hinein) zum Besten gegebenen Merkwürdigkeit in der Preisklasse einer Kalenderwahrheit.
mehr
Im Sommer 1917 entzieht sich der Freigestellte dem deutschen Trauerspiel. Walter Benjamin verlegt seine Existenz in die Schweiz und immatrikuliert sich an der Universität Bern. Er ist verheiratet und kurz davor, Vater zu werden.
mehr
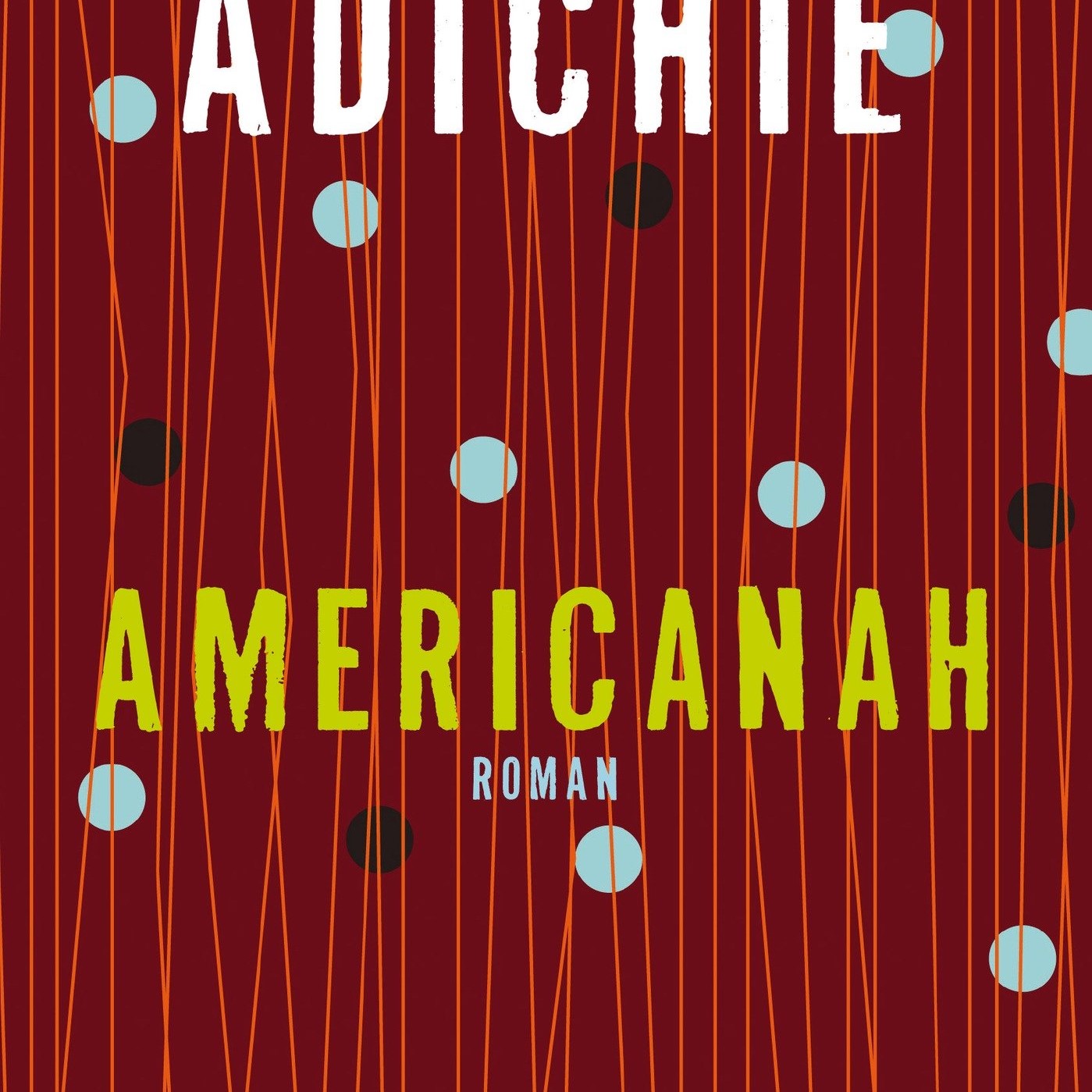
In Nigeria begreift man Migration als weiche Lösung. Der zur Heimkehr entschlossenen Ifemelu unterstellt man, der Fata Morgana einer Sehnsucht aufzusitzen. Ifemelu fürchtet selbst die Irrationalität ihrer Motive.
mehr
1959 ziehen Dagmar und Dieter Hestaskítur von Goslar nach Gera. Den Umzug gegen die Laufrichtung motiviert die totale Verwirrung. Dagmar und Dieter fehlen soziale Antennen. Sie sind komplett Banane, aber nett.
mehr
Für Ifemelu unterscheidet sich Princeton von anderen amerikanischen Orten mit Markencharakter in einer besonders angenehmen Weise. Der Nigerianerin gefallen die „maßvoll überteuerten Geschäfte“. Den Campus findet sie ...
mehr
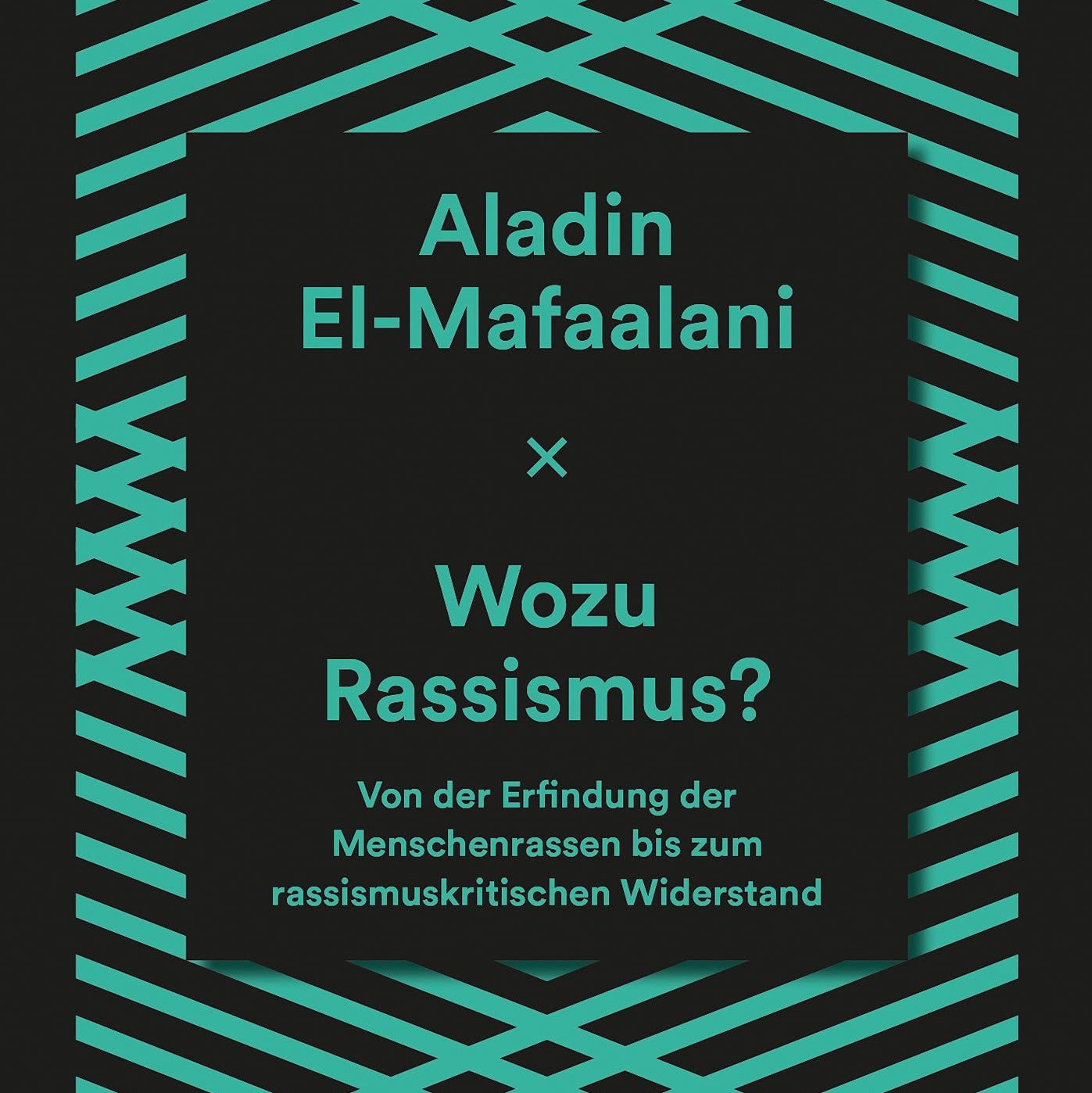
„Rassismus (hat u.a.) ökonomische Ursachen ... (er) ist ein Erbe der Nationalstaatenbildung, des Kolonialismus, der europäischen Aufklärung und der europäischen Geistes- und Naturwissenschaften. Somit handelt es sich in keiner Weise um ein natürliches Phänomen.“
mehr
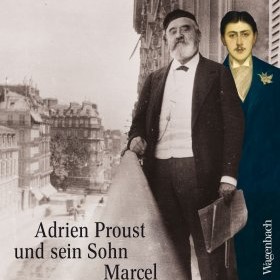
Die Welt erinnert Marcel Prousts Romanfiguren besser als seinen in der III. französischen Republik staatspolitisch ausschlaggebenden Vater. Der Epidemiologe stand dem Gesundheitswesen seines Landes mit leidenschaftlicher Autorität vor ...
mehr
Franco verehrt (so obszön wie er nur kann) die neue Nachbarin Señora Marián Maroños, die ihre Form in einem Fitnessstudio kultiviert und gern die allerkürzesten „Seiden-Miniröcke“ trägt. Fröhlich und zufrieden schaukelt ...
mehr
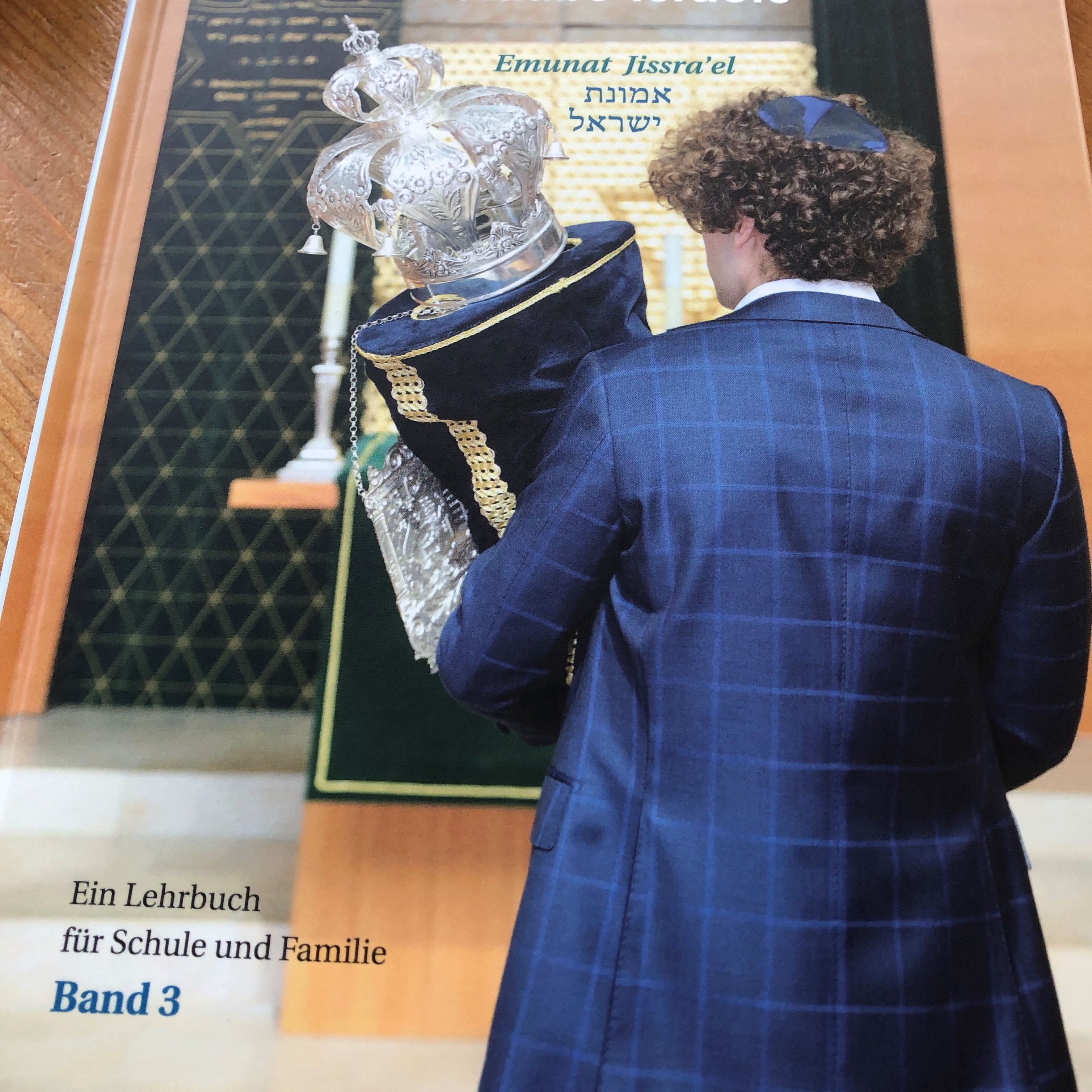
Unter uns atmen Personen, die sich als genetische Nachkommen von Akteuren begreifen, die in der Bibel exemplarische Rollen spielen.
mehr
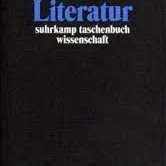
Adorno erinnert daran, dass Hölderlin nicht gleich als das verunglückte Genie verstanden wurde, sondern erst einmal als ein „stiller und feiner Nebenpoet“ mit rührendem Lebenslauf. „Manie als Nachkrankheit der Krätze“, diagnostizierte Johann Heinrich Ferdinand von Autenrieth.
mehr

Ein Kind, nachtwandelnd im „langen weißen Hemd“, kniet endlich vor den Devotionalien des Stubenschreins. Es „murmelt“ hin zur Jungfrau Maria jene formelhaften Schuldbekenntnisse, die ein erpresserischer Gott fordert.
mehr
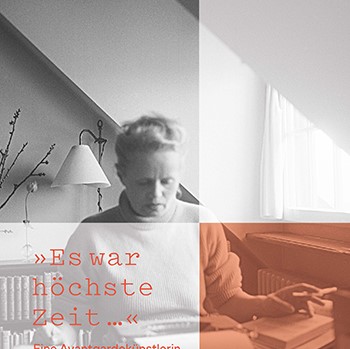
Erst 1953 gelingt der Verarmten die Überwindung der Untermiete als Daseinsform. Sie bezieht eine Wohnung am Nadelberg. Die Verbesserung weitet sie. In den neuen Verhältnissen übersetzt Ré Soupault Comte de Lautréamonts 'Gesänge des Maldoror' ohne Auftrag.
mehr
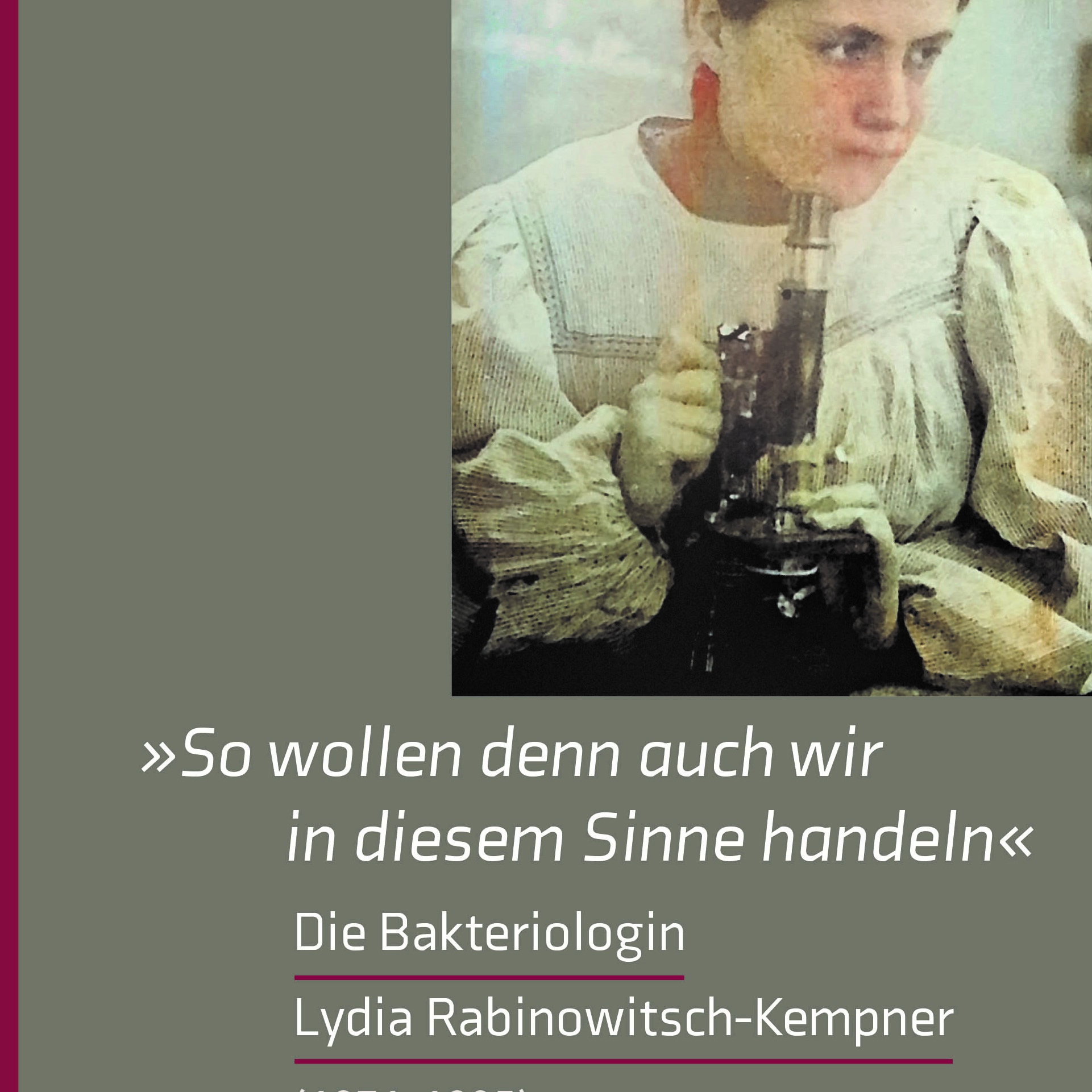
Zu ihrem 150. Geburtstag erinnere ich an jene Frau, die Carl Bolle im Berliner Milchkrieg zäh Paroli bot und den Großmeier endlich besiegte. Obwohl Lydia Rabinowitsch weltweites Renommee genoss, endete ihre Karriere 1934 mit der Zwangspensionierung.
mehr
Sich selbst schildert Klaus Mann „als Biene Maja mit Bencedrin-Flügelchen“ (Originalschreibweise). Er klatscht und tratscht auf hohem Niveau. Die ganze Emigration geht im Entre-nous einer Westentaschenvisitation durch. Die Protagonist:innen des Exils sind quasi alles untergegebene Tanten und Onkel des literarischen Großfürstensprosses.
mehr
May Ayims Seelenschwester Marion Kraft erinnert sich: „Schwarz und deutsch sein war die Erfahrung einer grausamen Kindheit in den Nachkriegsjahren und einer Jugend bestimmt von Ausgrenzung.“
mehr
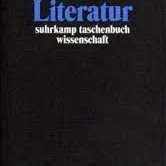
Adorno sagt: „Die Komplexion von handfestem Plot … und destillierbarer Idee (trägt) Sartre den großen Erfolg zu und (macht) ihn, ganz gewiss gegen seinen integren Willen, der Kulturindustrie akzeptabel.“ Sartre suggeriere, „dass auf den sozialen Kommandohöhen noch Leben sei“.
mehr
Im Beisein des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg Dietmar Woidke und der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg Manja Schüle wurde gestern ...
mehr
In den Anmerkungen zu der 1978 erstmals erschienenen Werkauswahl von Erich Mühsams Gedichte ... findet man Erklärungen zu Phänomenen, die unter den Tisch der Zeit gefallen sind.
mehr
„grenzenlos und unverschämt“ heißt ein Gedicht von May Ayim. Sie schrieb es „gegen die deutsche sch-einheit“. Es hebt an mit den Zeilen: ich werde trotzdem/afrikanisch/sein/auch wenn ihr/mich gerne/deutsch/haben wollt/und werde trotzdem/deutsch sein ...
mehr
In einem Brief an den aus Kattowitz gebürtigen Juristen und Kritiker Franz Goldstein (1898 - 1982) unterscheidet Klaus Mann hierarchisch lyrische von gedanklicher Schönheit zum Nachteil der glücklichen Fügung und des gelungenen Wortes.
mehr

Überlässt man den Gegenstand einer Betrachtung der Gleichgültigkeit und bedenkt nur die Argumentation, ergibt sich Bemerkenswertes. Tucholsky behauptet: Der Nationalcharakter mildere spezifische Eigenschaften, sofern er sie nicht stärker hervortreten lasse.
mehr

Während der Einnahme von Świecie/Schwetz an der Weichsel ächtet die Wehrmacht die Geachteten der Gegend. Man treibt „alle Notabeln des Landkreises zusammen“ und erhängt sie „auf dem jüdischen Friedhof. Unterschiedslos. Ob Polen, Kaschuben oder Juden“.
mehr
Die DDR war für ihre Schriftsteller:innen eine Druckkammer, der sie sich nicht einfach verschließen konnten. Der Staat scheiterte, seine Literatur gelang jedenfalls da, wo ästhetische Redlichkeit nur für einen hohen sozialen Preis zu haben war.
mehr
In der Hierarchie der Künste folgt die Dichtung der Malerei. Daran erinnert Victor Klemperer unter der Überschrift „Grenzverwischung“. Der Philologe scheidet den Impressionismus vom Expressionismus ...
mehr
1966 veröffentlichte Gerhard Wolf in der bei „Volk und Welt“ erschienenen Reihe „Schriftsteller der Gegenwart“ eine Abhandlung über Johannes Bobrowski.
mehr
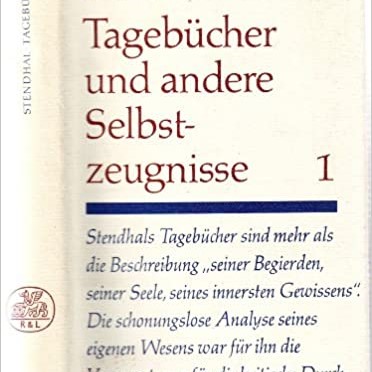
Am 21. Mai 1811 gesteht Stendhal Madame Daru eine Not, die zu beheben, sie ablehnt. Sie fessele sein Herz, erklärt er. Na und, fragt die Gräfin im Gegenzug schläfrig.
mehr

Vom 1. bis zum 4. September finden in Berlin die Deutsch-Israelischen Literaturtage statt. Unter dem Motto „Alles auf Anfang?“ widmen sich neun Autor*innen in mehreren Einzelveranstaltungen der Frage ...
mehr

Als im Jahr 2013 die School of Jewish Theology an der Universität Potsdam gegründet wurde, erfüllte sich nach fast 200 Jahren die Forderung nach der Gleichberechtigung der jüdischen mit den christlichen und islamischen Theologien.
mehr

Die Unterwanderung der Wirklichkeit verlangt nach dem Komplementär „der Boshaftigkeit“. Aus gefühlslasch und gemein entsteht „vulgäre Antipathie“.
mehr

Die Autorin versteht, dass ihre „Beziehung zum eigenen Leiden, eine Beziehung, die sich zutiefst privat anfühlt, eigentlich überhaupt nicht privat ist. Der Ursprung (des) Leidens ist Narrativen geschuldet, die es einem weißen Mädchen sehr leichtmachen ...“
mehr
Erst in der Presse weißer Folter zeigt die Begabung ihre Macht. In einer offenen Gesellschaft käme es nie zu dieser Klärung: ein Genie wie Ossip Mandelstam musst du krönen oder killen.
mehr

Ink & Liquor - Schriftsteller ziehen aus dem Rausch lyrische Luzidität. Sie begreifen Alkohol als Produktionsmittel, Motor und Treibstoff auf den Teststrecken zum Ruhm.
mehr

Mit zwölf erlebte Jean Rhys eine unangebrachte Annäherung. Der verbrecherische Verehrer malte der Minderjährigen eine gemeinsam-eheliche Häuslichkeit mit lunaren Sensationen und somnambulen Fledermäusen aus.
mehr
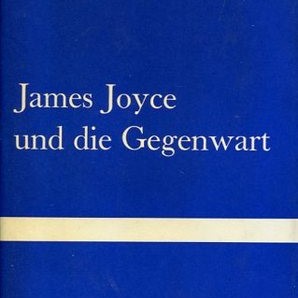
„Hat das Werk tatsächlich den Geist seiner Epoche (über den allgemein geltenden Zeitstil hinaus) in sich aufgenommen?“ Das fragte sich Hermann Broch in einer Festschrift zum fünfzigsten Geburtstag des Kollegen Joyce.
mehr
Über seinen klügsten Schüler sagte Adorno: „In diesem Krahl hausen die Wölfe.“ Hans-Jürgen Krahl starb in der Nacht des 14. Februar 1970. Nach seiner Beerdigung löste sich der SDS auf.
mehr

In den 1920er Jahren bespricht Ossip Mandelstam Filme, Inszenierungen, Bücher und Tendenzen. Er analysiert literarische Moden. Er knöpft sich den Unanimismus um Jules Romains vor.
mehr

Dem „ungeschönten Einzelmenschen“ wendet sich Flaubert mit „Hochmut (und) Ekel“ zu. Das Genie beansprucht eine aristokratische Warte. Man ahnt Mandelstams Faszination für den Streit der Gegensätze. Unter Stalins Knute sind solche Gedankenausflüge verbotene Gänge.
mehr

„Das hängt nun wieder damit zusammen, dass die Weimarer Klassik ein Revolutionsersatz war. Es gab keine (deutsche) Revolution ...“ Heiner Müller
mehr
1932 denkt Ossip Mandelstam über Charles Darwin nach. Er stellt fest: „Darwin dichtet der Natur keinerlei Ziel an und verneint jedes Heilsprinzip.“
mehr
Genazino lud mich in seine Wohnung ein, ich kam im Anzug und mit Krawatte. Den Anzug hatte ich mir zur Hochzeit einer Freundin gekauft.
mehr

In „Solo Sunny“ spielt Klaus Brasch den erotisch expansiven Saxophonisten Norbert. Mit seinem römischen Feuerkopf sieht er aus wie die Idealbesetzung für einen Dichter.
mehr

Krisen gehören zum Leben jedes Einzelnen, gehören in Familien, es gibt sie zwischen Ländern und weltweit. Ob Brexit, Finanz- oder Klimakrise, Menschen auf der Flucht ...
mehr
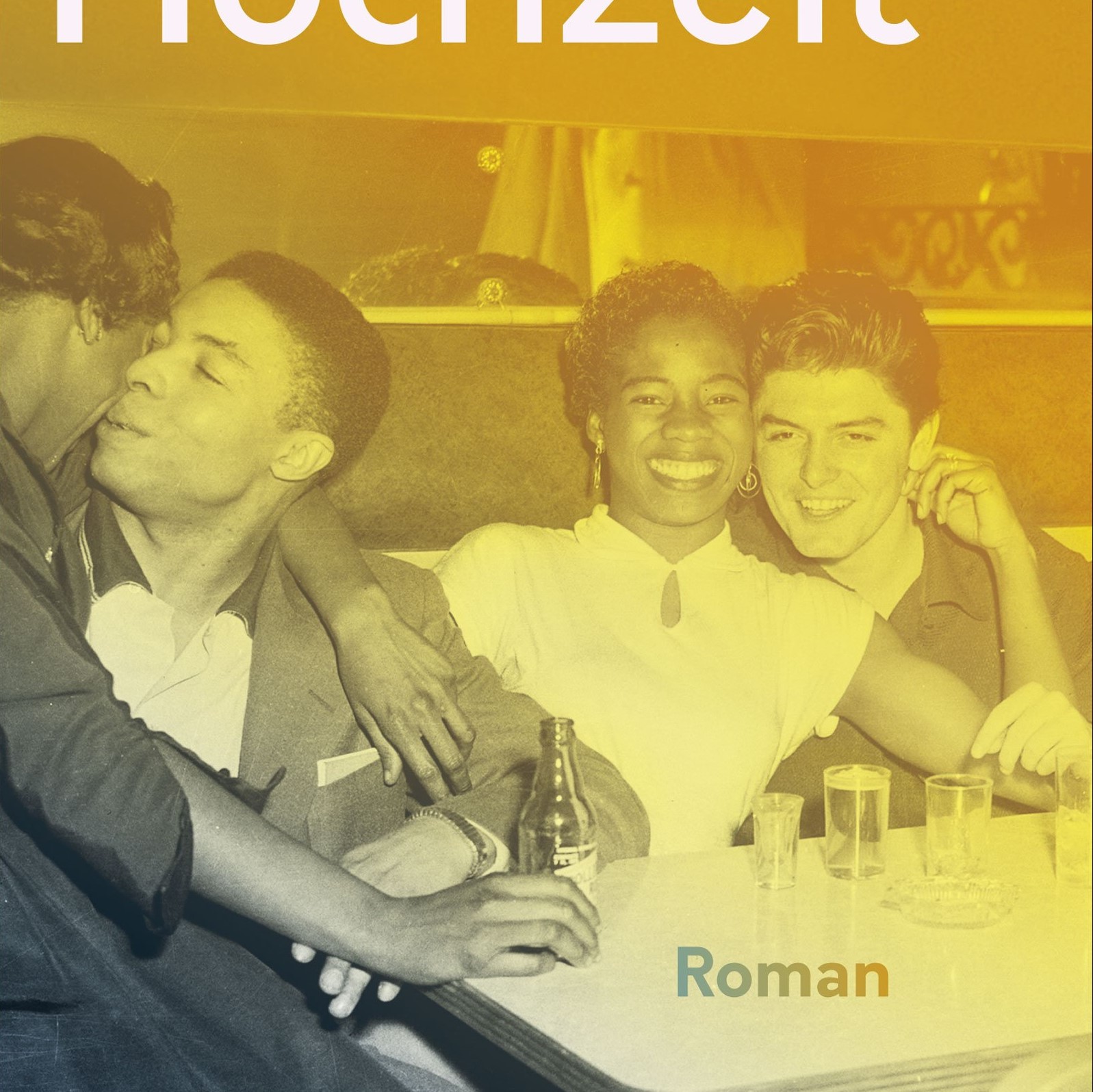
Da sind Kinder, die den Unterschied zwischen einer Mutter und einer Haushälterin nicht kennen. „Hab ich auch mal eine Mutter gehabt? fragte Tina schüchtern.“
mehr
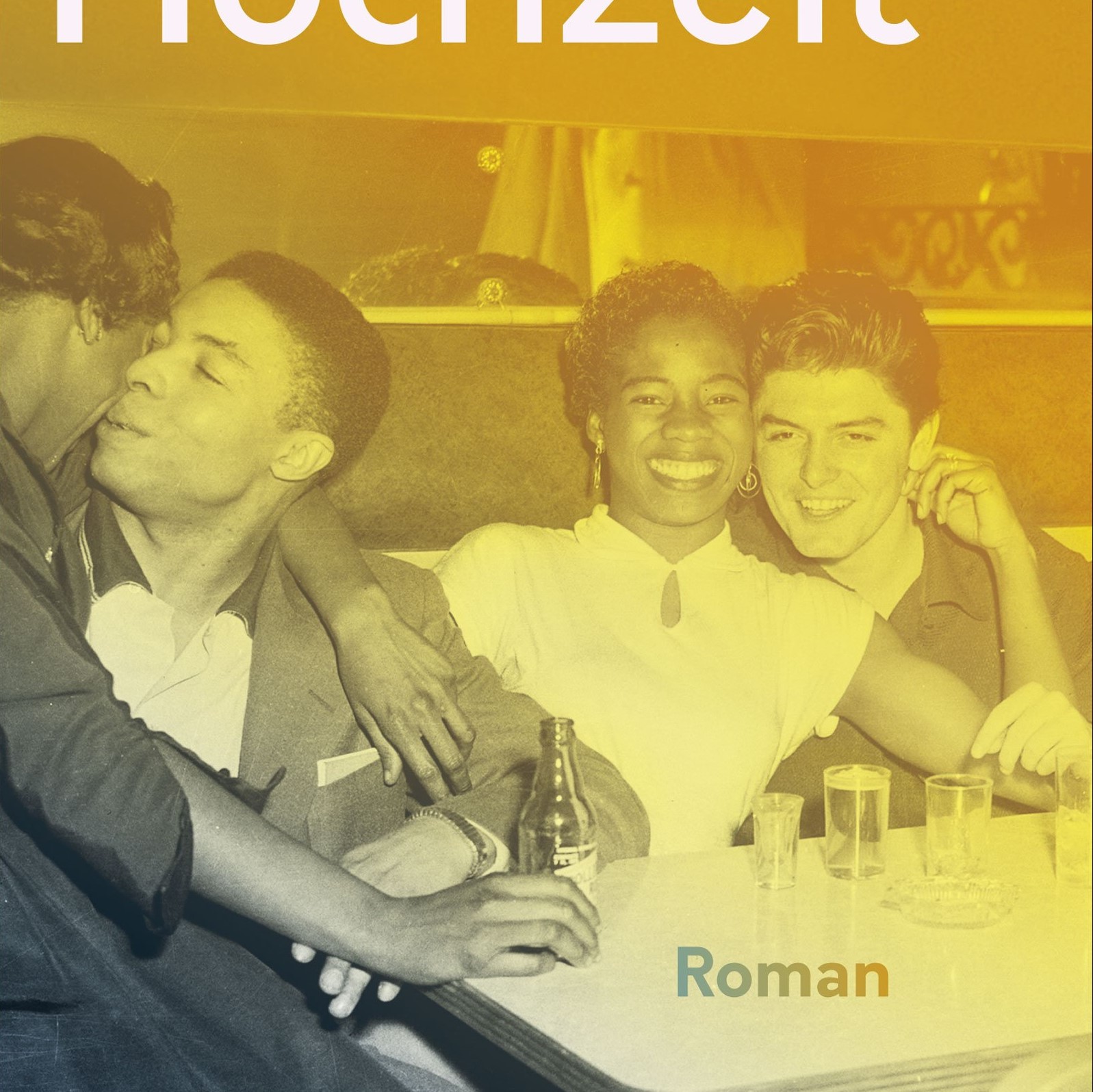
Schwarze, die in einer Ringburg des Wohlstands Abstand zu den Normalverläufen halten, verlangen von den vermutlich grundsätzlich Schwarzen Arbeiter:innen der Gegend ...
mehr
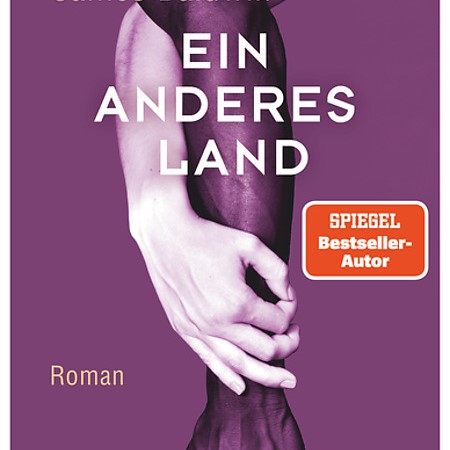
Vivaldo lebt als Weißer unter Schwarzen. Der Vorwurf von Cultural Appropriation im Raum. „Er war bloß ein armer weißer Junge in Not, und es war ganz und gar nicht originell, zu den Schwarzen gelaufen zu kommen.“
mehr
Unter Ärzten gelten Gerichtsmediziner als „postmortale Klugscheißer“. In Fernsehkrimis halten sie an der Hades-Pforte bürgerliche Umgangsformen hoch.
mehr
„Wir Menschen sind ... kognitiv ... weiter als ... unsere Biologie. Trotzdem spüren wir die Auswirkungen der neurophysiologischen und hormonellen Grundlagen des Fight-or-Flight-Geschehens, denn sie sind in uns veranlagt.“
mehr
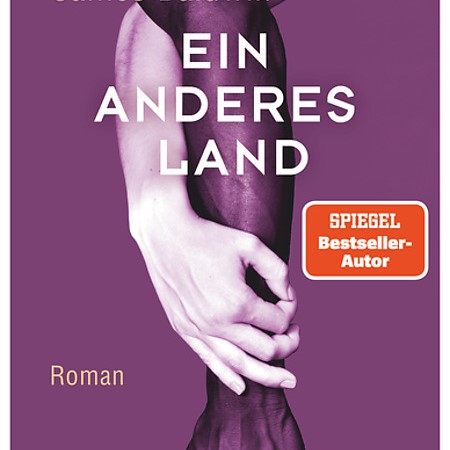
Baldwin beschreibt eine Ghettoexistenz, die nach den Gesetzen und dem Beat von Harlem lebt. Das Faustrecht regiert; wer zu weit geht, „fängt sich ein Klappmesser“ ...
mehr
Als Free Lancer fliegt Aust via Paris nach Algier zum Panafrikanischen Kulturfestival. Er hofft, da den vom FBI zur Fahndung ausgeschriebenen Black Panther Eldridge Cleaver zu treffen.
mehr
Stefan Aust beschreibt Ulrike Meinhof und Klaus Rainer Röhl als „linkes Erfolgspaar mit Eigenheim und Urlaubsreisen nach Sylt.“ Die Ehe der Premium-Kolumnistin ...
mehr
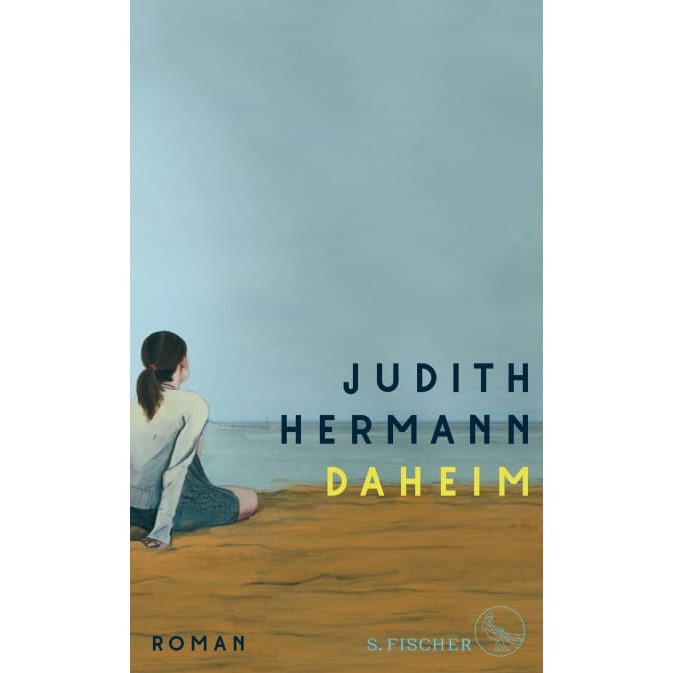
Die wetterfeste Mimi marschiert ohne zu prusten und zu zagen in die frühlingskalte Ostsee. Das vorspiellose Direkt entspricht einer von der Großmutter übernommenen Praxis.
mehr
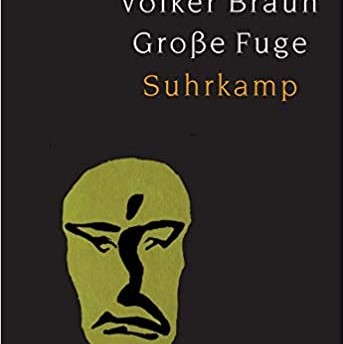
„Der Senat schließt die Kneipen zu“. Das haben wir alle erlebt, jene ausgefallene Saison, die wir für eine Ausnahme von der Regel hielten, bis sich die Verhältnisse zuverlässig ...
mehr
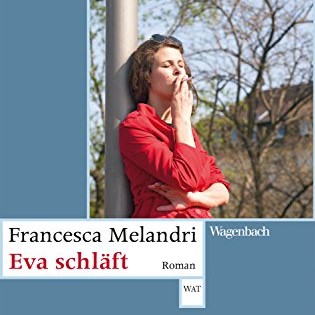
Als Tochter eines Ausgestoßenen und Schwester eines Terroristen bewegt sich Gerda an einem Rand. Doch widersteht die Küchenhelferin dem Unglück.
mehr

Sie nannten sich Rote Armee Fraktion. Ihre Dekade waren die Siebziger. Schon vor Anbruch des neuen Jahrzehnts erlahmte das revolutionäre Stehvermögen.
mehr
In den Südtiroler Dolomiten registriert man den Nachwuchs nach einer antiken Klanordnung. Ein uferloses Verwandtschaftsgeflecht konkurriert mit transgenerationalen Zerwürfnissen.
mehr
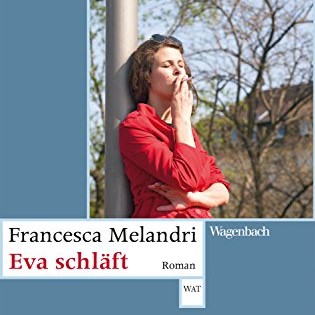
Die Hand der jugendlichen Mutter ist „rau wie altes Holz“. Ihre Liebe erschöpft sich in einer Abwandlung des Stillens. Zu seiner Stärkung erhält der Sohn „die lauwarme Milch vom ersten Melken am Morgen“ ...
mehr
Beas Eltern haben dieses gewaltige Boomer:innenego. Sie sind high vom schieren Dasein. Das Leben ist Musik in ihren Ohren. Auf ihren Überholspuren verbrennen sie jede Menge fossiler Brennstoffe zu Kohlendioxid.
mehr

In der Mühle eines strapaziösen Müßiggangs werden die Tage gemahlen, nachdem sie kopfüber durch den Trichter gepurzelt sind. Gerade war noch gestern, zumindest heller Nachmittag ...
mehr
Die meisten Texte verstummen wie alte Leute, die sogar ihr Geschwätz vergessen haben. Viele Romane bleiben noch nicht einmal als Quellen interessant. Unbemerkt erlitten sie den Schock der Zeit. Manche Sachen gewinnen unter ihrer Patina neue Qualitäten.
mehr

Räumlich residieren die Guermantes' unter den Prousts. Gesellschaftlich stehen sie aber turmhoch über den Großbürger:innen, die sich den informativen Vorwitz ...
mehr

Der „unermüdliche Flug der Mauersegler“ vor seinen Pariser Fenstern erscheint dem Debütanten als ein „Feuerwerk von Leben“. Ist das eine prosaische Übertreibung? Oder eine Indolenzfeststellung ex negativo?
mehr
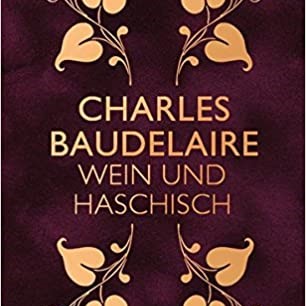
Baudelaire findet ein Gemälde so verboten, dass es ihm nicht reicht, in der Sache „das absolute Gegenteil von Kunst“ zu erkennen. Vielmehr stellt er eine „kriminelle Absonderlichkeit“ fest. Er wütet und weitet das Areal seiner Abneigung ...
mehr
Der Heranwachsende weidet auf den Almen und in den Auen erotischer Märchen. Seine Phantasie entzündet sich an der sagenhaften Madame de Guermantes. „Wie oft habe ich mir diese Geschichte erzählt! ...“
mehr
Irgendwo sagt Jorge Luis Borges, er habe nie aus der Bibliothek seines Vaters in Buenos Aires herausgefunden. Er arbeitete auch als Bibliothekar in einer Zeit „soliden Unglücks“. Ab 1955 leitete Borges die argentinische Nationalbibliothek.
mehr

Der Künstler als Knabe gibt in der Sommerfrische den abgebrühten Beobachter. Er bemerkt „unfreundliche“ Hügel am Strand von Balbec. Den Bahnhofsvorsteher verortet er „zwischen Tamarisken und Rosen“. Er lächelt auf den „künstlichen Marmor“ der Monumentaltreppe ...
mehr
Hitler brachte Heinrich & Thomas zwar zusammen, sorgte aber nicht für Nähe. Ich glaube, dass sich die Brüder bis zum Schluss nicht riechen konnten. In Kalifornien bewahrten sie sich vor den Peinlichkeiten offen ausgetragener Gegnerschaft ...
mehr

Stéphane Mallarmé unterscheidet Dichter, die Leute, Dinge und Szenen beschreiben, von solchen, die sich für die Frage qu'est-ce que ça veut dire interessieren. Die Frage entspricht einem oppositionellen Reflex.
mehr

Rilke repräsentiert seine Epoche nicht. Vielmehr wirkt er abgeschnitten; gefangen in einem Kokon des Eigensinns. Zagajewski schildert ihn als „kalligrafisches Fragezeichen am Rande der Geschichte“.
mehr
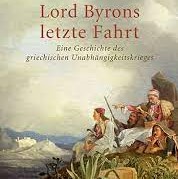
Man ver-dichtete verschiedene ethnische Gruppen zu einem Volk (dem mythisch überhöhten Volk der Griechen). Es regierte die Fremdzuschreibung in einer Kombination mit neuen, nämlich nationalstaatlichen Ideen.
mehr
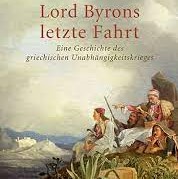
Schuberths analytische Erzählung entfaltet einen wunderbar starken Sog. Dem Autor dient Lord Byron als Kulminationspunkt epochaler Ideen und Irrtümer. Ihm geht es nicht um die aristokratische Euro-Gang ...
mehr
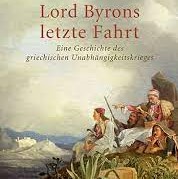
Der Osmanische Reichskahn krängt längst dem sprichwörtlichen Invaliden am Bosporus entgegen, als der Volksaufstand ohne Nationalbewusstsein losgeht. Das Gros der Aufständischen ...
mehr

"Dana Grigorcea: Die Gefahr der Islamisierung ist ein Lieblingsthema der Populisten. Da kann man nur den Kopf schütteln, dass Chauvinismus und Rassismus, diese alten Geister der Vergangenheit, die wir längst begraben hatten ... "
mehr
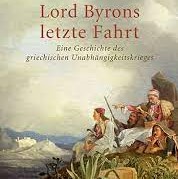
Die Hellenisierung des neuzeitlichen Griechenlands (als einer geografisch höchst ungefähren Größe) ergab sich auch im Zug einer „antifeudalen Transformation“. Im Verein mit allen möglichen Idealisierungen ...
mehr

Am vergangenen Sonntag ist in Krakau der polnische Dichter Adam Zagajewski gestorben. Ich habe ihn mal auf einem Zuneigungsgipfel mit seinem Freund Michael Krüger in der Berliner Akademie der Künste erlebt.
mehr
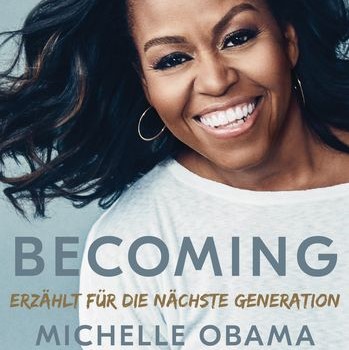
Michelle Obama bekennt sich zu einer „Pingeligkeit“, die es ihr nicht erlaubt, Schulfreundinnen nach Hause einzuladen. Sie sollen sich nämlich nicht an ihren Puppen zu schaffen machen. Von ihren Inspektionen anderer Kinderzimmer ...
mehr

Der zweite Whisky war einer zu viel. Eine Überschreitung mit vorhersehbaren Folgen. Mir passiert das nicht mehr oft. Inzwischen kriege ich schon Kopfschmerzen, wenn ich nur daran denke, wie es war, in der verräucherten Theaterkantine ...
mehr

Den gesellschaftlichen Verwerfungen zum Trotz gelingt der Erzählerin eine tadellose Kindheit und Jugend mit den Schwerpunkten Tennis und Literatur. Sie absolviert das Höhere-Tochter-Programm. Sie spricht die Leserin direkt an und zeigt ...
mehr
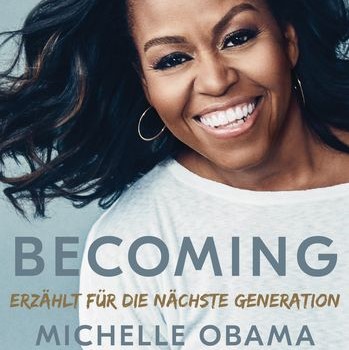
Das weiße Haus ist ein Ort, wo die Hunde der Obamas, solange die Präsidentschaft währt, ab und zu auf die Teppiche kacken. Michelle schreibt kacken. Sie erzählt das so locker vom Hocker, um Berührungsängste zu zerstreuen. Für den zu empowernden Nachwuchs will sie ein erreichbares Vorbild sein, handsome und easy im Umgang. Das Sicherheitsregime blockiert die Aktivistin auf dem Thron der First Lady.
mehr

Erinnert Ihr euch, wie uns Mayowa Osinubi zurief: „Lasst euch nicht abriegeln und runterregulieren. Geht aus euch heraus, wenn ihr das wollt, auch in der Öffentlichkeit.“ - Stay tough und tragt den Spirit so weiter, wie es Kimberlé Crenshaw vorlebt. Aus dem Katalog ihrer Devisen:„Intersektionalität ist kein Universitätssport, sondern eine Handlungsanleitung für soziale Gerechtigkeit.“ „Now we get ready to rumble.“
mehr
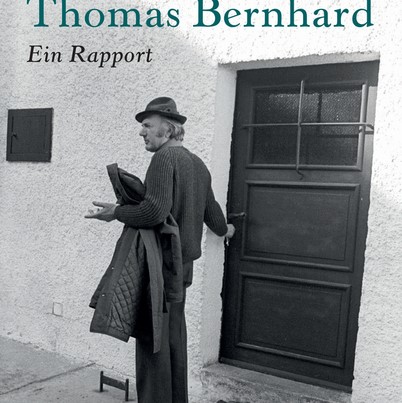
Der Ältere verkleidet den Jüngeren. Thomas trichtert Peter einen Humorbegriff ein, der von Bösartigkeit kaum zu unterscheiden ist. Noch in der späten Schilderung grausamer Kriegs- und Nachkriegskindheitserlebnisse verwahrt sich der Chronist gegen den erzwungenen Mummenschanz. „Unter Protest und Heulen (wurde Peter) als busenbewehrte Frau maskiert“ und so vorgeführt.
mehr
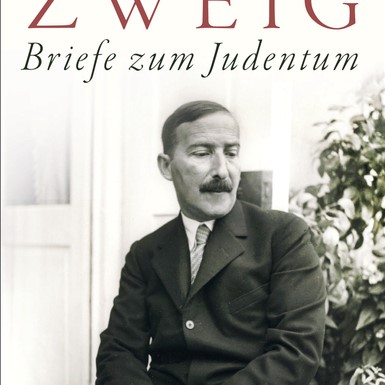
Vorausschauend und hellsichtig diagnostiziert Stefan Zweig Antisemitismus als Verliererkrankheit. Bereits zu Beginn des Krieges sieht er Reaktionen der Mittelmächte auf die en passant prognostizierte Niederlage voraus. An Abraham Schwadron schreibt Zweig im Frühjahr 1915: „Ich bin fest überzeugt, dass die Erbitterung ...
mehr
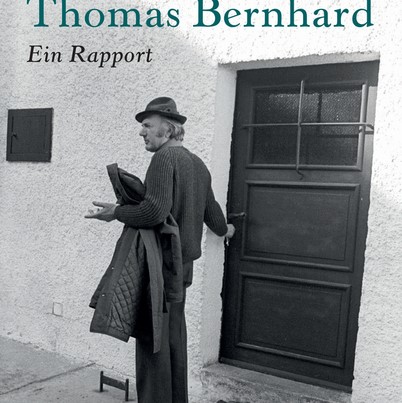
Der Ältere verkleidet den Jüngeren. Thomas trichtert Peter einen Humorbegriff ein, der von Bösartigkeit kaum zu unterscheiden ist. Noch in der späten Schilderung grausamer Kriegs- und Nachkriegskindheitserlebnisse verwahrt sich der Chronist gegen den erzwungenen Mummenschanz. „Unter Protest und Heulen (wurde Peter) als busenbewehrte Frau maskiert“ und so vorgeführt. „In meiner Erinnerung sind, ganz nebulös, noch gemeinsame Ausflüge mit dem Schlitten und Hamsterfahrten abrufbar.“
mehr

Stefan Zweig sieht im Judentum „Ferment und Bindung aller Nationen“. Das formuliert er 1917 in einer informellen Mitteilung, niedergedrückt von der Stupidität aller Kriegspropaganda. Stefan Litt überliefert eine Schätzung, nach der Zweig rund 25 000 Briefe und Postkarten geschrieben hat. Der Editor rechnet die Post in besonderer Weise zum Werk. Er wählte 120 Korrespondenzexponate an 43 Adressaten aus. „An erster Stelle wurden solche Briefe berücksichtigt ...
mehr
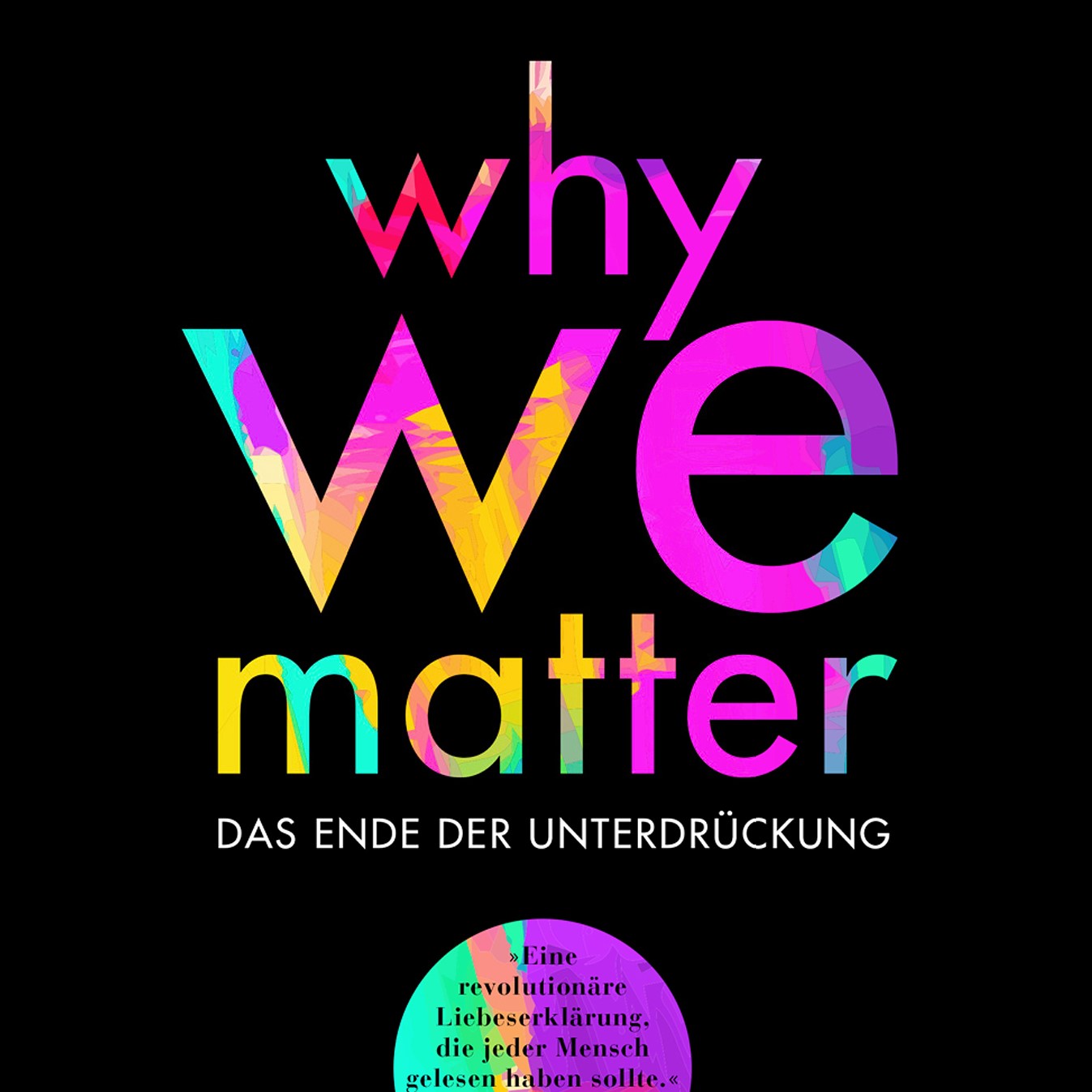
"Wir kennen Rassismus, Homophobie, Transfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, und vieles andere mehr – und viele von uns empfinden darüber eine manchmal hilflose Wut, denn gerade aktuell scheinen die Gräben durch die Gesellschaft tief, unsere Welt so polarisiert wie nie und die Überwindung dieser Gräben in weiter Ferne. Die einen halten erbittert an etablierten Machtstrukturen fest, die anderen kämpfen in einem immer sichtbarer werdenden Widerstand dagegen an."
mehr

In der familiären Umgebung von Bernhards Urgroßmüttern reklamiert man gleichwohl eine illustre Abstammung im Dunstkreis napoleonischer Desaster und mit Hinrichtungen quittierter Konspirationen. Von dem Epauletten-Verve ist eine Generation später nichts übrig. Der bis zum Wahnsinn von sich selbt eingenommene Johannes Freumbichler verführt eine verheiratete Frau zur Verachtung des Bewährten. Sie bricht aus ihrer Ehe aus und erleidet als Ausgestoßene das Dasein einer Haushaltshilfe mit weiten Fußwegen.
mehr

Der alte Freumbichler mag ein famoser Mundartdichter sein. Noch besser beherrscht er das Schinden seiner ins Geschirr gestellten Angehörigen. Er nutzt nicht allein die Ergebenheit seiner Tochter Herta, um sozial auf Deck zu bleiben. Gefügig macht er sich auch den eifrigen Autodidakten Emil, der die ledig zur Mutter gewordene Herta wohl auch deshalb heiratete, weil ihm die Modalitäten des Familienanschlusses behagen. Emil wischt dem alten Meister hinterher ...
mehr

"Ein Bodden ist ein flaches buchtartiges Küstengewässer einer nacheiszeitlich teilweise überfluteten Grundmoränenlandschaft. Der Name Bodden ist vermutlich niederdeutschen Ursprungs und bedeutet Boden, was sich auf die geringe Tiefe dieser Gewässer bezieht. Bodden sind charakteristisch für die südliche Ostsee, wo sie typischerweise durch langgestreckte Inseln und Halbinseln vom offenen Meer abgetrennt sind und Lagunen bilden." Wikipedia
mehr

Er trägt den Mädchennamen der Mutter. Skeptisch begleitet der Sohn Herta Paula Bernhard in die Ehe mit dem „attraktiven“ Emil Fabjan. Der Mann ist zehn Jahre jünger als die Frau. Sie buhlt um ihn. In einem Wirbel der Umtriebigkeit hält sich Emil selbst den Rücken frei. Das mitgebrachte Kind fühlt sich von der furiosen Hinwendung der Mutter an den Nicht-Vater verraten. Vor dem Volksgerichtshof der üblen Nachrede ...
mehr

Ist die Aufgabe groß, gelingt sie gemeinsam besser. Und wer sich (endlich) einmal dem längsten und bedeutendsten Roman der französischen Literatur, "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" von Marcel Proust, widmen will, kann das jetzt in Gemeinschaft tun. Grundlage dafür ist die preisgekrönte und vom rbb produzierte Lesung der sieben Bände und mehreren tausend Seiten von Peter Matic. Die insgesamt 329 Folgen sind im Radio ...
mehr
Mimikry und Mimese ... Gute Tarnung wirkt sich positiv auf den Fortpflanzungsbetrieb aus. Die Camouflage-Virtuos*innen konkurrieren mit den Hochleistungsnachahmer*innen. „Die Hainschwebfliege ahmt mit ihrer gelb-schwarzen Färbung eine wehrhafte Wespe nach, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Sie selbst hat keinen Stachel und ist völlig harmlos. In Deutschland gibt es insgesamt etwa 450 Schwebfliegenarten.“
mehr
Die Kombination Gelbschwarz lässt uns intuitiv zurückweichen. Es gibt viele, den Wespenalarm auslösende, gelbschwarze Aggro-Outfits und Dominanzkostüme. Ich habe mich manchmal gefragt, warum Gelb in den Kampfkünsten hohen Rängen vorbehalten bleibt, ich meine, wir denken doch als Normalos bei Gelb an verkleckertes Ei und die schlechten Umfragewerte der FDP. Jetzt weiß ich, warum gewisse Meister sich gelbgenial vom Fußvolk absetzen. Gelbschwarz suggeriert eine schmerzhafte Begegnung.
mehr
Portia bestellt ein Filet vom Wolfsbarsch. Bevor das Mittelmeer zum Massengrab wurde, gab es vor Lampedusa keine Wolfsbarsche mehr. Die Rückkehr des Branzino, sein starkes Aufkommen in Küstennähe, zeigt an, was auf Lampedusa keinem entgehen kann: dass ein paar Kilometer vor dem europäischen Festland stündlich Menschen ertrinken und diese Ernte einige Kreisläufe beschleunigt. Das erzählt Davide Enia in „Schiffbruch vor Lampedusa“
mehr
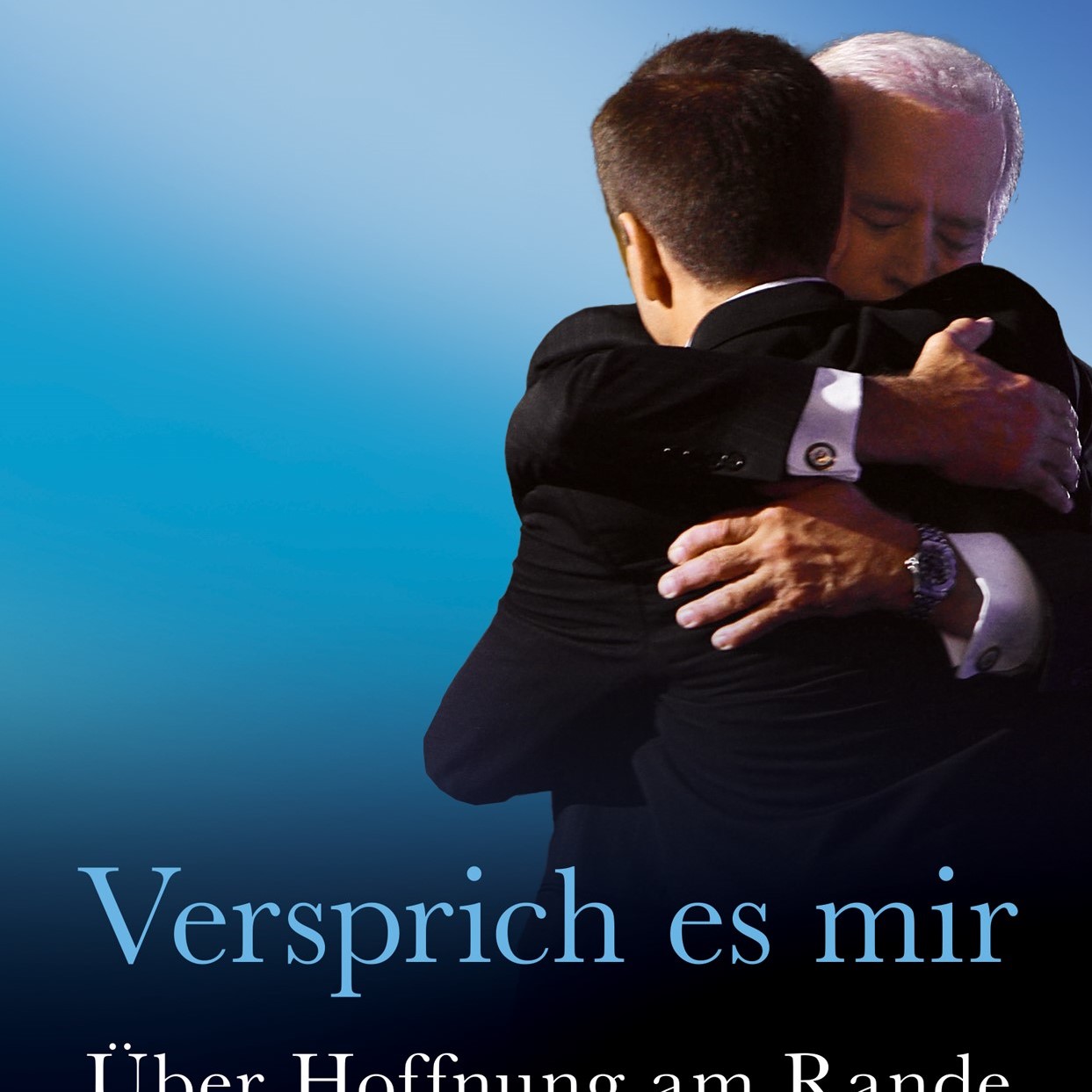
In jeder Sommerfrische verwandelt sich das Washingtoner Establishment in die Nantucket Community. Auf der Insel im Atlantik vor Massachusetts bleibt die Aristokratie der Ostküste unter sich. Joe beschreibt die Nantucket-Traditionen seiner Familie. Die Ausflüge zum Strand mit den Sport- und Spielsachen der Enkel*innen. Mittagessen im Brotherhood. Nie versäumt man es, der Surf- und Board-Designer-Legende Spyder Wrights in dessen Gentlemen-Boutique die Ehre zu erweisen.
mehr

Der Protestbrief einer kleinen Gruppe von Palliativmedizinern und Psychologen zum ARD-Film „GOTT“ von Ferdinand von Schirach, über den die FAZ am 21. November ausführlich berichtet hat, enthält eine bedauernswerte Reihe nachweislich unwahrer oder verzerrender Aussagen. Um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit in dieser wichtigen und komplexen Frage in die Irre geführt wird, sehen wir uns veranlasst, diese Aussagen einem Faktencheck zu unterziehen.
mehr
„Die Beziehung eines Schwarzen zu Europa bedarf stets einer Qualifizierung.“ Für Portia ist das eine neue Erfahrung. Die Tochter eines Schriftstellers mit der Attitüde des (im Verhältnis zum Despoten kongenialen) Dissidenten begreift Europa als den Groß(t)raum, in dem ihr Vater eine donnernde Identität aus dem Exil destillierte. Jahre hat die Familie in England gelebt. Die Vorbehalte der Diaspora-allergischen Mutter prägten Portias Wahrnehmung.
mehr
Exotisch erscheinen Portia „Afrodeutsche, die keine Erinnerung an Afrika haben“, und von denen die aus Sambia gebürtige Lehrerin bislang nur gehört hat. Attraktiv findet sie den Schwarzen Nachbarn ihrer Berliner Airbnb-Wohnung. Portia fängt sofort an zu flirten und zieht ihn in ihren Bann. Der Leser erkennt in dem Gefeierten Ginas Mann wieder. Sie erinnern sich: Viel Zeit verbrachte das alle Erwartungen auf Academia richtende und den männlichen Hemmungen zum Trotz verheiratete Paar in einer Zweiraumwohnung über einem Parkplatz in Arlington ...
mehr
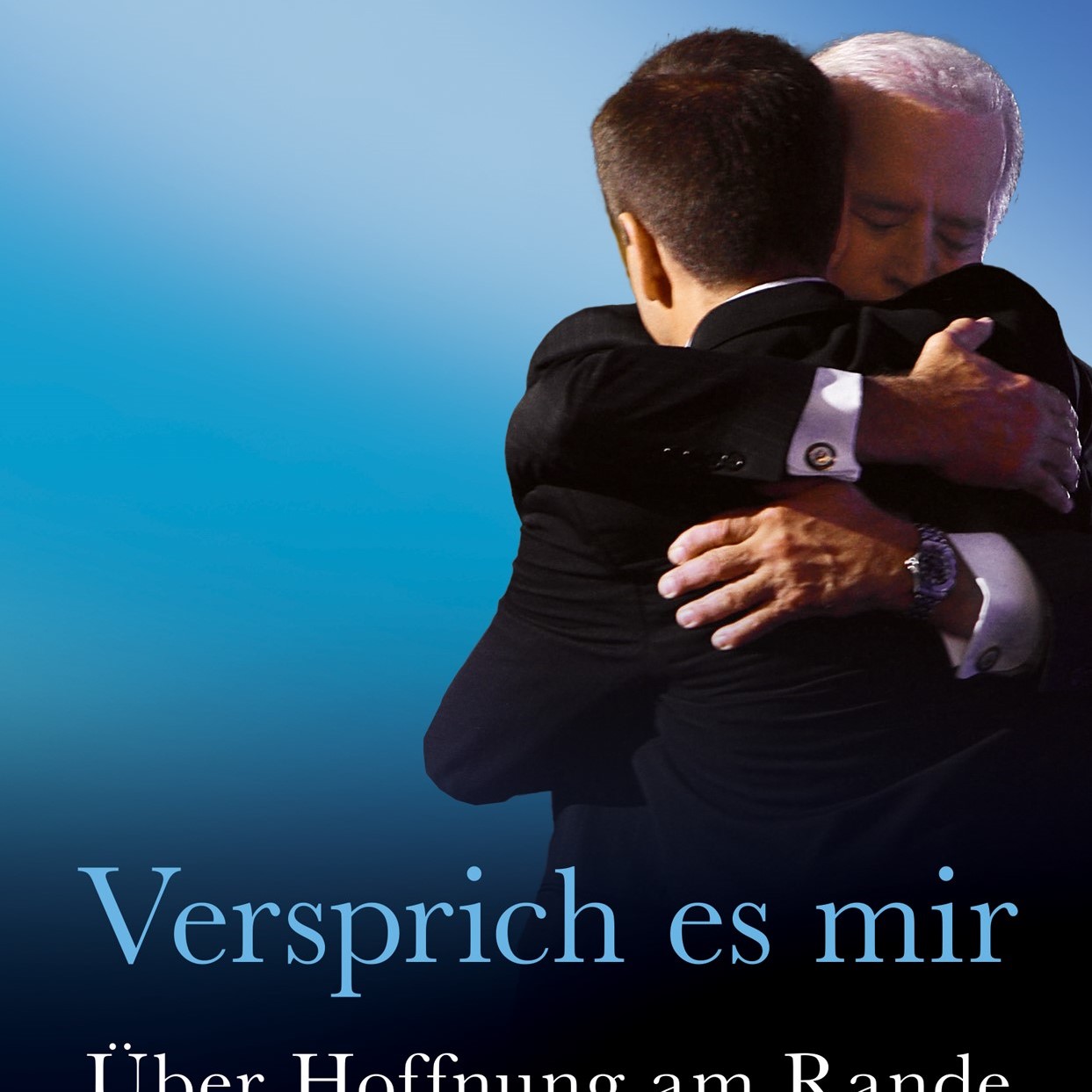
Dem Amt des US-amerikanischen Vizepräsidenten fehlt der Glanz. Schon Benjamin Franklin sprach von „Eurer Überflüssigen Exzellenz“. Ein ernsthafter Bedeutungszuwachs ergibt sich für den zweiten Mann im Staat nur dann, wenn sein Vorgesetzter im Amt stirbt. Das war bislang neun Mal der Fall. Im Übrigen blieb dem Vize nichts anderes übrig, als der Welt mächtigste Person nicht ungefällig zu erscheinen.
mehr
Als Sozialarbeiter brennt Obama im Fegefeuer der Bürokratie. Ständig begegnen ihm Akteure, die Dinge verändern können, es aber nicht tun. Das frustriert den geborenen Macher. „Was wir brauchten, war die Macht Gelder zu verteilen.“ Obama nimmt Maß am Bürgermeister von Chicago. Harold Washington setzte sich mit einer Graswurzler-Kampagne gegen seine Rivalen durch.
mehr
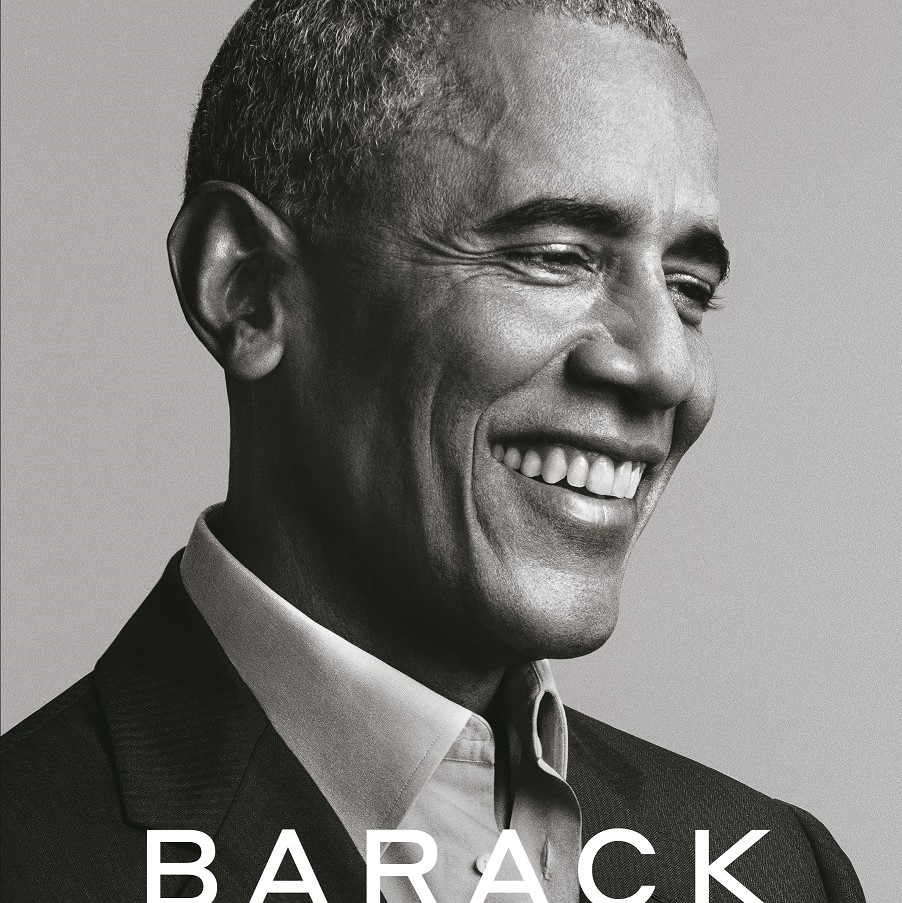
Obama verbrachte viel Zeit in der Aura einer weisen Großmutter, die das Interesse des Enkels an Literatur förderte; dies im Verein mit Surfen, Basketball spielen und in Omas „altem Ford Granada“ Bier trinken. Kurz gesagt, eine herrliche Jugend. Obama liest Marx und Marcuse, um einer „langbeinigen Sozialistin“ zu imponieren. Er zieht Bahnen, wo andere planschen. Sein Leben strukturiert er wie ein Arbeitsfeld.
mehr
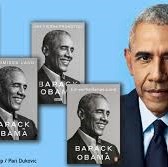
Obama fliegt eine Gedankenschleife, bevor er zum letzten Flug in der präsidialen Powerblase zurückkehrt. Er skizziert die Lässigkeit in großer Höhe. Lachend spielte man mit den Insignien der Macht unter Ausschluss von allem Unbefugten. Der innerste Kreis, die größte Kraft, der geringste Pomp. Solchen heimlichen Ableitungen nimmt der Autor den Schleier. Er lädt seine Leser*innen zum Schlüssellochblick auf den Glanz vergoldeter Kloschüsseln ein.
mehr
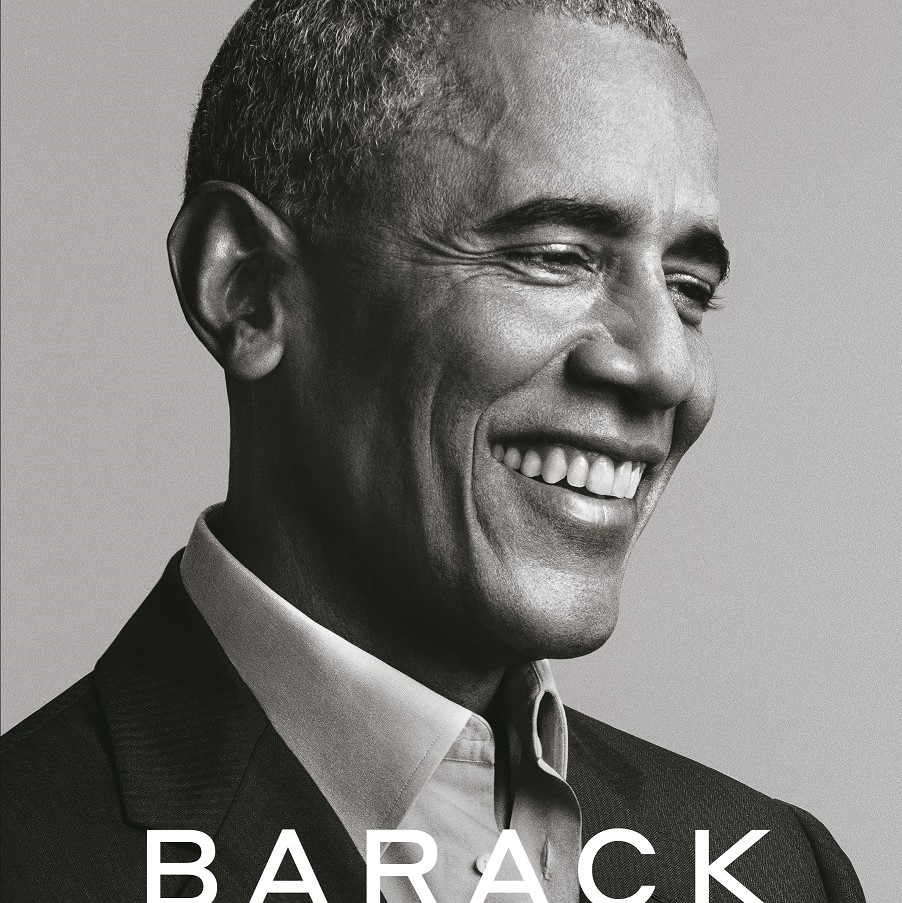
Ovid sagt: Was nur aus Furcht vor Schande vermieden wird, ist schon getan. Eine Verfassung ohne trügerische Zugaben gibt es nicht, so Seneca. Um den Missstand zu überspielen, setzt man dem Mysterienspiel vom Ursprung alles zu, was ein einnehmender Prospekt braucht. Mit verdummenden Erzählungen und Verlegungen grundgesetzgebender Versammlungen in den Himmel lassen sich geduldige Gläubiger erziehen. Jeder Staat hält wenigstens einen Gott an der Spitze.
mehr
In Dulcies heimischer Festung ist noch viel „nach dem Geschmack einer anderen Zeit“. Als Rezensentin der Familienschinken erkennt Viola einen verloren gegangenen Reichtum. Die polierende Wirkung der Konzentration auf Gegenstände bemerkt auch die eher prosaische Dulcie. Sie gesteht sich ihre Überforderung nicht ein.
mehr
Alles läuft auf eine Zuspitzung hinaus. Dulcie Mainwarings Nichte Laurel zieht frohgemut zu ihrer Tante von Nirgendwo auf dem Land nach Irgendwo in London. Das heißt, es gibt bessere Adressen, wie der Nachkommenden wohl bewusst ist. Die Gastgeberin übt rituell Verzicht. Sie hat sich das innere Dauerlächeln schwachsinniger Milde verordnet. Vielleicht wurde sie auch dazu erzogen, wenn nicht sogar abgerichtet.
mehr

Im Dulcies heimischer Festung ist noch viel „nach dem Geschmack einer anderen Zeit“. Als Rezensentin der Familienschinken erkennt Viola einen verloren gegangenen Reichtum. Die polierende Wirkung der Konzentration auf Gegenstände bemerkt auch die eher prosaische Dulcie ... Sie will das alles nicht und findet doch kein Mittel gegen den Rummel ...
mehr
Donald Trump versöhnt klassische Herrschaft und Anti-Establishment in seiner Person. Er ist Hillary Clintons 'Basket of Deplorables' und dessen Gegenteil. Also verkörpert er die regulären Garanten der Suprematie und die Guerilla der Subordination. Und jetzt kommt Joe B. und ist bloß Elite.
mehr

"Ein Bodden ist ein flaches buchtartiges Küstengewässer einer nacheiszeitlich teilweise überfluteten Grundmoränenlandschaft. Der Name Bodden ist vermutlich niederdeutschen Ursprungs und bedeutet „Boden“ oder „Grund“, was sich auf die geringe Tiefe dieser Gewässer bezieht." Wikipedia
mehr
Selbsthass legt eine Spur. Die Erzählerin treibt ihre Deklassierung voran als Zimmermädchen in einer christlichen Einrichtung. Der Tunnel, in dem sie sich rückwärts bewegt, ist die Ehe. Das ist deshalb so grotesk, weil der Selbstausschluss auf der Bildungsbasis erfolgt. Die Souveräne gibt sich auf: „Und es ist nicht der Bräutigam, der mich abholt ... Er wird mich auch nicht ernähren, sondern ich ihn.“
mehr
Die belesene, im Kosmos der deutschen Philosophie beheimatete Ich-Erzählerin erfüllt die Erwartungen unter lauter Analphabetinnen. Sie gibt sich „zurückhaltend und keusch“. Sie kehrt zu den Ausläufern eines Lebens zurück, das ohne sie weiterging. Sie möchte den zurückgebliebenen Verwandten gefallen.
mehr

Leben wir in einer Welt des Hasses? Ist eine Gesellschaft ohne Hass vorstellbar? Was bedarf es dafür? Woher kommt Hass? Ist er subjektiv? Spricht aus Hass Ohnmacht oder Überzeugung? Was lässt sich denjenigen entgegensetzen, die Hass politisch instrumentalisieren?
mehr
Vom 3. Oktober bis 9. November 2020 finden die von Max Czollek kuratierten Tage der Jüdisch-Muslimischen Leitkultur in Theatern und Institutionen im gesamten deutschsprachigen Raum statt. Im 30. Jahr der sogenannten Wiedervereinigung, 20. Jahr des Debattierens einer „deutschen Leitkultur“ ...
mehr

Da er solange ein berühmter Unbekannter bleibt, muss Müller wieder und wieder im Westen wie im Osten und so auch im Westen und Osten von Amerika die Butterdose seiner Biografie auskratzen. Das strapaziert, es führt zu einem schleifenden Text, der sich an folgenden Punkten wiederholt. Eine Großmutter war für Hitler ...
mehr
In Deutschland hat man sich an Zustände gewöhnt, an die man sich niemals gewöhnen darf: Jüdische Schulen müssen von Bewaffneten bewacht werden, jüdischer Gottesdienst findet unter Polizeischutz statt, Bedrohungen sind alltäglich. Der Staat hat zugelassen, dass es so weit kommt.
mehr
"By 1968 Sontag had very nearly become an international symbol of intellectual celebrity at its most accomplished. It mattered too that she was a beautiful woman in a time when her beauty and her sex qualified her for the exotic position of “the brilliant exception,” always a figure held in extravagant regard. It’s hard not to wonder if Sontag’s rise to fame would have been as great had she simply been a pleasant-looking man." New York Times
mehr
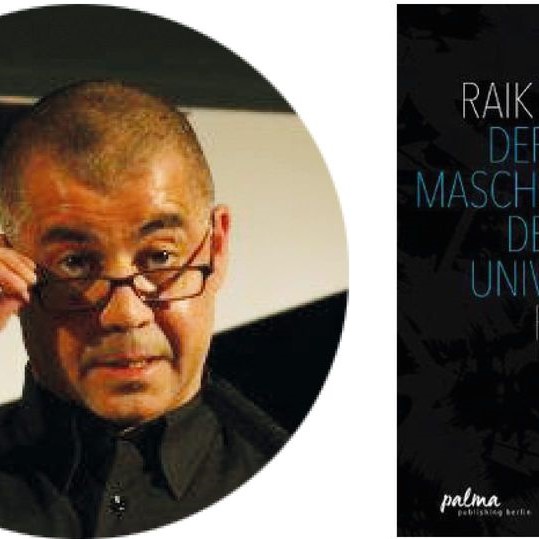
Lieber Jamal Tuschick, da kann ich mich nur verneigen! Was für ein großartiger Artikel, was sage ich, was für ein großartiges Stück Literatur, das Sie geschaffen haben. Ich werde Ihren Artikel noch öfters lesen, weil er so voller Fakten, Bilder und Ideen ist … das erschließt sich nicht beim einfachen Lesen!
mehr

Stephen Crane antizipiert Oliver Stones pseudokriegsberichterstattende „Platoon“-Wackelkameraästhetik. Er schafft surreale Landschaftsbilder, die seelische Zustände spiegeln wie in der Malerei von Max Ernst oder René Magritte. Zudem designt Crane eine Psychologie des unter Druck gesetzten Individuums.
mehr
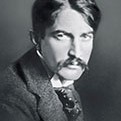
Henry befragt sich. Er fragt sich, wie er sich wohl halten wird, wenn der innere Alarm zur Flucht aufruft. Bereits im amerikanischen Sezessionskrieg (1861 – 1865) wurde der Begegnungsstress unter Gefechtsbedingungen untersucht. Man beobachtete, dass nicht wenige Soldaten ihre Vorderlader mehrfach luden ...
mehr
Die Mutter reiht sich in das Heer jener ein, die in den Amtsfluren aufkreuzen, wenn die Herrschaften Feierabend haben. Sie gehört zur Feudelarmee aus dem Kontingent der Verfügbaren, die dankbar sein sollen, Deutschland putzen zu dürfen. Manchmal begleitet das erzählende Ich die Mutter an die Front der Degradierung.
mehr
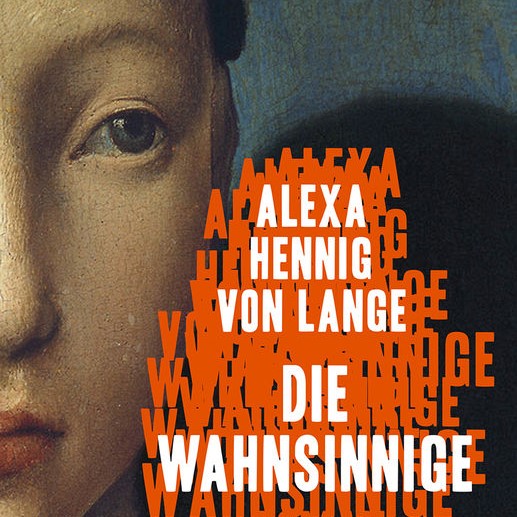
Alexa Hennig von Lange erzählt in ihrem neuen Roman aus dem Leben einer Hauptdarstellerin und all den Regieanweisungen, die zu befolgen jene nicht umhinkommt. Die Autorin schildert das Verhältnis von staatlicher Macht und persönlicher Ohnmacht in der Enge eines Lebens.
mehr
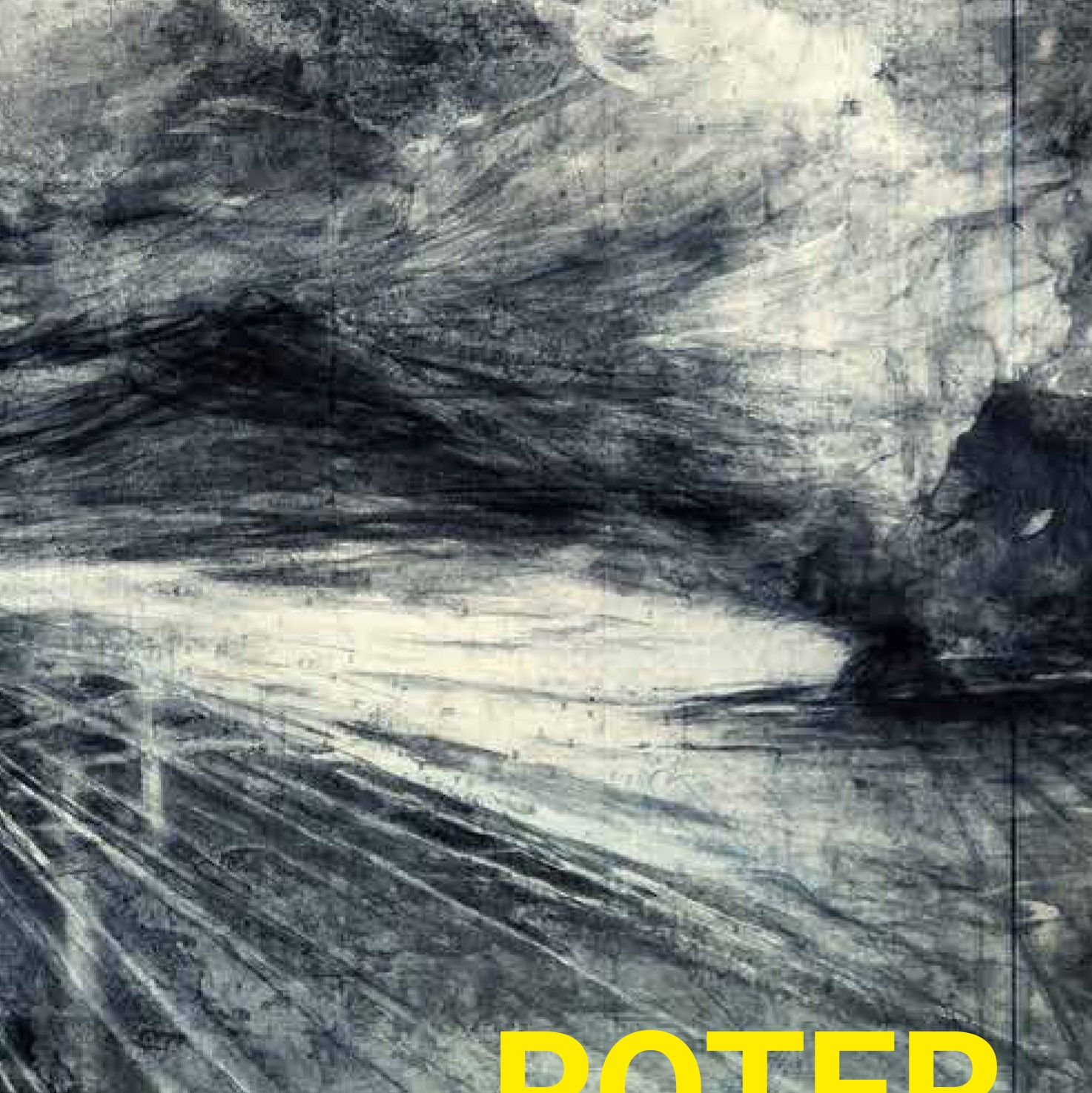
Die Therapeutin macht sich leer und erreicht so leer Roland K. auf einem Hochplateau des Nichts im Eiswind koinzidierender Bewusstlosigkeit. Indem sie sich mit ihm auf eine Stufe stellt, zwingt sie Roland dazu, von seiner Disposition abzusehen. Er kehrt zu seiner Rolle als wandelbarer Sträfling zurück.
mehr

Hollywood war Brechts Weimar ... Der Dramatiker lag wie eine abgetakelte Fregatte im amerikanischen Trockendock. Brecht wäre ohne Hitler als potenten Feind zugrunde gegangen, jedenfalls nicht historisch geworden.
mehr

In der Endphase ihrer Selbständigkeit ließ Oma die Freiflächen vor ihrem Haus asphaltieren, um eine kleine Autobahn für ihre Rollator-Spritztouren zu haben. Sie kämpfte um jeden Tag der Mündigkeit. Erst in der späten Einsicht aller möglichen Endlichkeiten begreife ich ihre Entschlossenheit.
mehr
HM weiß, dass viele Phänomene seiner Gesellschaft keine Chance haben, historisch zu werden. Unsere DDR-Wahrnehmung begnügt sich; während wir die amerikanischen Schichten gründlich voneinander scheiden. Jedes Imperium fordert eine Maßstab bildende Genauigkeit heraus.
mehr

Ins Gebet genommen wird Rodrigues von Inoue. Der Fürst von Chikugo erspart dem Konvertiten keine Demütigung. Der Gefangene siedelt sich als Okada Sanemon in Edo an. Vor seiner Haustür stürzen sich Spottkommandos in das Abenteuer der Verhöhnung eines schwachen Menschen.
mehr

Eine autistische Zikade ist seine einzige Gefährtin. Sie belebt eine Trauermyrte neben der Zelle, in der Fürst Chikugo den portugiesischen Priester Rodrigues festhält. Chikugo hat ihn auch belehrt, so belustigt wie erbittert ...
mehr
Inzwischen kennen wir Weinstein als gebrochenen Rollatorschieber im Epstein'schen Elend. Sein Verfall verdankt sich Type-Riders, die jahrelang nicht aus dem Sattel ihrer Entschlossenheit gekommen sind. Die Gunner des Guten standen vor dem Nichts, als kurz vor Deadline ...
mehr
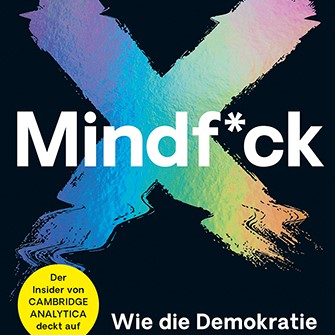
Kann man erst einmal das Verhalten von Millionen Verbrauchern zuverlässig voraussagen, lässt es sich auch steuern. Der Witz dabei: Die Manipulierten erkennen ihre Lage nicht. Sie halten sich für Autonome.
mehr
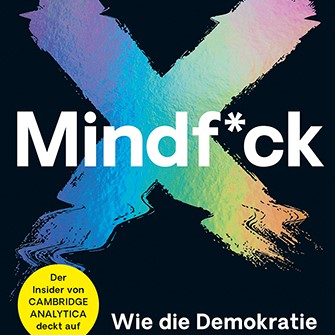
Wylie besucht eine Frau, die Homophobie mit Christentum und Yoga kombiniert. Sie bringt den Analytiker auf Ideen. Sie verwendet eine Reihe von „mentalen Abkürzungen“, die sie in die gesellschaftliche Mitte zurück katapultieren; dahin, wo die Leute vor Fox News auf der Couch ...
mehr
Solange ihn das System deckt, lenkt Weinstein einfach nur den Fluss fremder Bedürfnisse in den Kanal einer perversen Praxis. Sein Nimbus und die Maschine dahinter wirken wie eine Honigfalle. Doch dann dreht sich das Rad und Weinstein verliert seine Unverwundbarkeit.
Was passiert jetzt?
mehr
Jahrzehnte machte sich ein Mächtiger die Karrierehoffnungen junger Frauen zunutze. Harvey Weinstein verwandelte Hotelzimmer in Schreckenskammern. Er baute ein Fallensystem auf, in dem die gnädige Seite der sozialen Evolution, die wie Pilze aus dem Boden schießenden, stets unvorhersehbaren Zukunftschancen ...
mehr
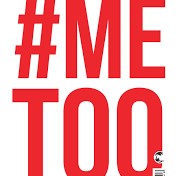
Megan Twohey beobachtet bereits zehn Jahren das Gefälle zwischen dem Wunsch von Weinstein angegangener Frauen, sich zu offenbaren, und Fallrückziehern der Besorgnis, als sich eine Lücke zeigt. Die Investigative stößt auf eine Assistentin aus der Keimzeit von „Miramax“ ...
mehr
Die NYT-Investigativen Jodi Kantor und Megan Twohey waren die Ersten. Vor ihnen interpretierte man den sexistischen Sumpf von Hollywood einfach nur als eine schäbig-normative Kraft, die Elevinnen formte. Die Typewriter-Gunner der New York Times änderten das im harten Einsatz.
mehr

Afrika, das ist nicht nur Wissen, das ist nicht nur die Bibliothek der Bäume und die Kunst, Fallen zu stellen, das ist nicht allein Jungle Move & Fischen mit bloßen Händen, nein, da ist eine größere Kraft im Spiel. Und diese Kraft gelangte mit den Verschleppten nach Amerika. Da nimmt sie eine moderne Gestalt an.
mehr
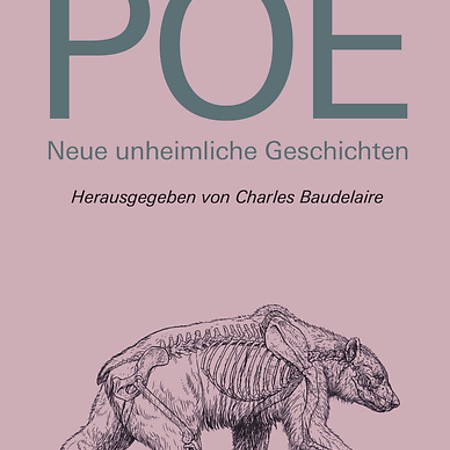
In einer Oktobernacht zuzeiten von Eduard III. (1312 – 1377), dessen Herrschaft, so Edgar Allan Poe, eine galante Angelegenheit war, trieben zwei Matrosen auf Landgang in einem Wirtshaus im Sprengel von St Andrew-by-the-Wardrobe (ein besonders sprechender Name) auf. Die Säuferampel zeigte einen „Lustigen Seebären“ an, aber das Kneipenregime war dezidiert prosaisch.
mehr
Die WerteInitiative ist eine zivilgesellschaftliche jüdische Stimme in Deutschland. Als gemeinnütziger Verein arbeiten wir überparteilich und setzen uns für die Sicherung einer jüdischen Zukunft in Deutschland und Europa ein. Das Mittel dafür ist die Stärkung der Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
mehr
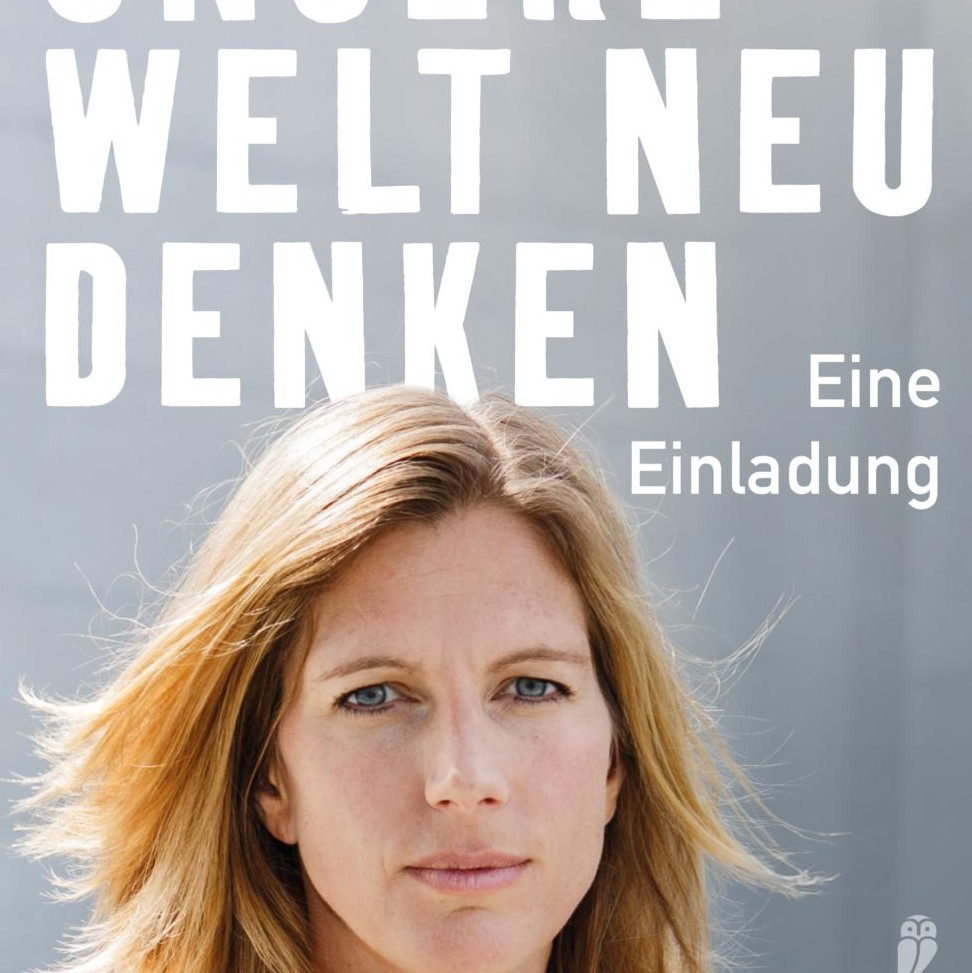
Die Idee vom Organischen als dem harmonischen, auf alles zugreifenden und alles ordnenden Prinzip des Universums gehört zu einem Selbst-Täuschungskomplex. Kein Wirtschaftssystem wächst wie ein Rosenstock: so ermutigt von filigranen Wachstumshilfen. Überhaupt hat Wirtschaft mit Flora & Fauna nichts zu tun.
mehr
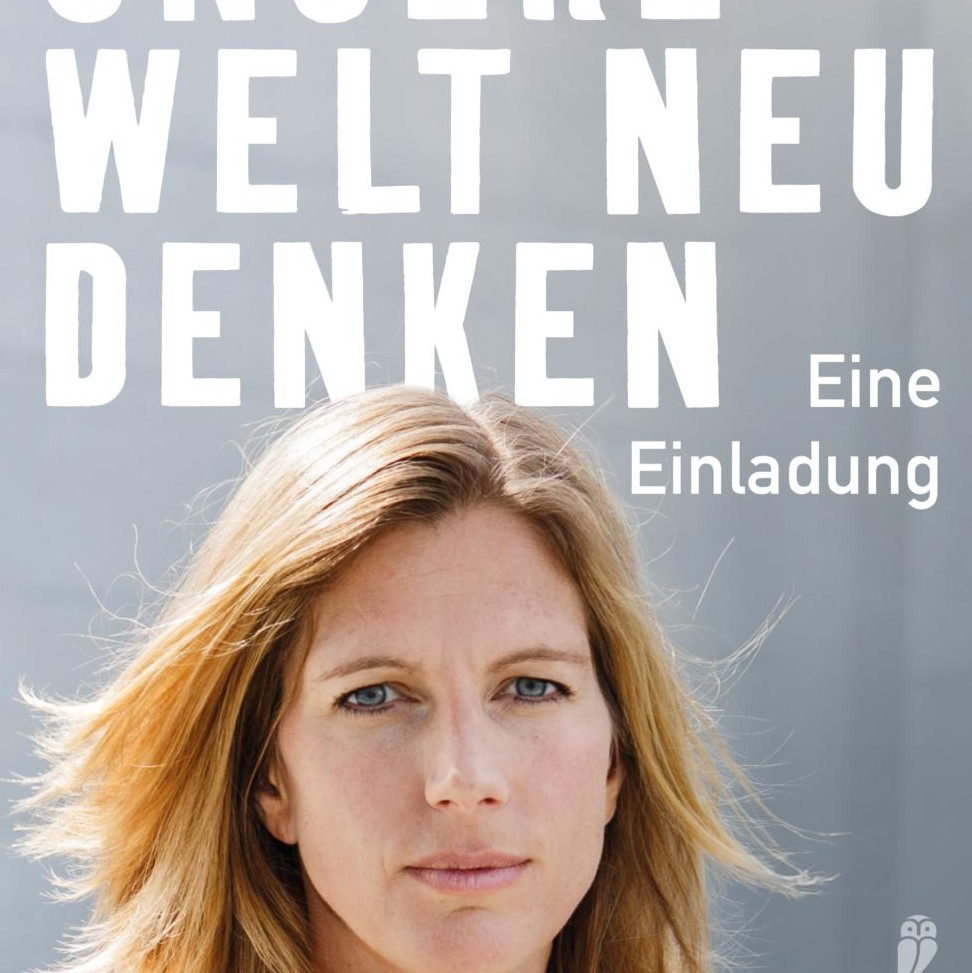
Maja Göpel denkt „das Plastik in den Weltmeeren“ mit „den explodierenden Mieten in den Städten“ zusammen. Zum ökologischen Kollaps kommt der ökonomische. Dystopien bestimmen den Diskurs.
mehr
In seiner Unterlegenheit gelingt es Esau nicht, die ihm von den Vorvätern vorgeschriebene Rolle auszufüllen. Darin erkennt Horvilleur eine Marke auf dem Weg zum Antisemitismus. Zwei Generationen später ...
mehr
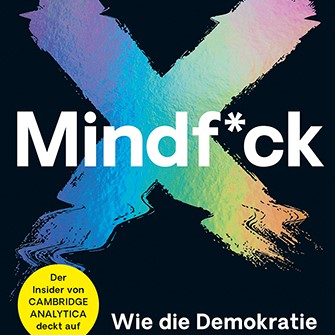
Nie hätte sich Wylie träumen lassen, für ein Militärunternehmen zu arbeiten. Das aber ist die SCL Group (Strategic Communication Laboratories Group). Wikipedia: „SCL war ein britisch-US-amerikanisches Unternehmen für Verhaltensforschung und strategische Kommunikation.“
mehr

Heute gibt es den schönen, „Fleisch ist mein Gemüse“ vorwegnehmenden Titel nur noch antiquarisch. Überhaupt erscheint die MÄRZ-Präsenz im viralen Jetzt schwach im Vergleich zu der Wirkung des Verlags um 1970 …
mehr
Menschliche Werte haben biologische Wurzeln aka genetische Anker. Sie sind Anpassungsprodukte. Mit dieser Feststellung steigt Ian Morris in den Debattenring. Werte stehen in einem funktionalen Zusammenhang mit evolutionären Anforderungen.
mehr
Es ist die Angst all jener, die auch gern möchten, die Schröder begünstigt. Sie werden ihm ihre Feigheit nie verzeihen und ihn mit übler Nachrede verfolgen. Diese Billigächter für einen Groschen intervenieren nur, solange sie für nichts geradestehen müssen.
mehr

Nach einem Gang durch das Gebirge der Kindheit, einem Intermezzo im niedersächsischen Todenmann als „Zonenflüchtling“, einer Lehre zum Buchhändler in Düsseldorf und vielen Nächten in der Gesellschaft ...
mehr

Jörg Schröder liebte seine Arbeit, war trotz seiner Krankheiten immer optimistisch und voller Ideen. Ich habe mehr als mein halbes Leben mit ihm zusammen verbracht und werde ihn sehr vermissen. Es war ein Geschenk, mit ihm vierzig Jahre leben zu dürfen.
mehr

Die Frage lautet: Was verbindet einen Farmer in Norfolk, dessen konservatives Repertoire offensichtlich erscheint, mit einem fashionvisionären Kombattanten im Kulturkampf von Shoreditch ...
mehr
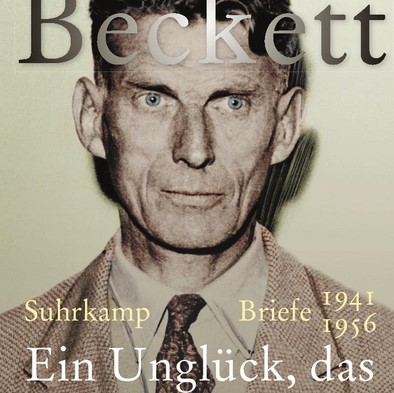
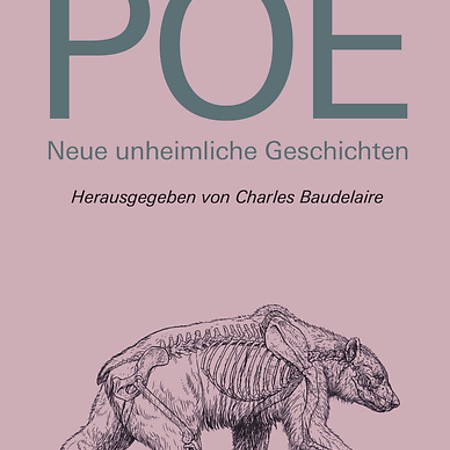
Es beginnt mit Schwindel und endet mit schierer Auflösung. In einem späten Zwischenstadium schießt Blut aus allen Poren. So führt Edgar Allan Poe eine Seuche ein, die verheerender als alle ihre Vorgängerinnen wirkt.
mehr
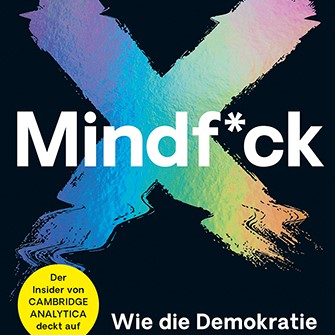
Als Marktforschungsinstitute getarnte Militärdienstleister erledigen für Regierungen die Drecksarbeit. Geschieht dies in Afrika, ergeben sich Beispiele für digitalen Kolonialismus. Korrupte Regimes erlauben die Auswertung über Mobilfunkanbieter und Soziale Medien generierter Daten …
mehr
Die nationalsozialistische Ästhetik ging in der jungen Bundesrepublik unerkannt als Unschuld vom Land unter die Leute und langweilte die künftigen Achtundsechziger*innen mit ihrem Kitsch.
mehr
Aliyah bedeutet im Hebräischen Aufstieg. Elaboriert man den Begriff, bedeutet Aliyah das Ende der Diaspora und die Heimkehr aus der Zerstreuung. Es gab eine vormoderne Aliyah im osmanischen Palästina.
mehr
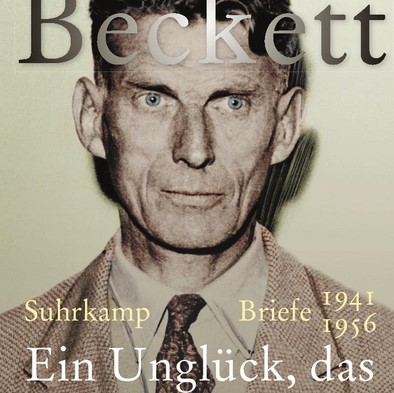
In den Fünfzigerjahren beginnt Samuel Beckett das eigene Werk in seine Muttersprache zu übertragen. Er übersetzt sich selbst aus dem Französischen, so wie er sich in den Zwanzigerjahren ins Französische ...
mehr
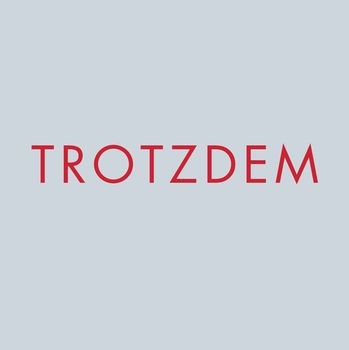
Als die Beulenpest 1348 Florenz erreichte, begann das große Sterben unter Aufsicht eines Schriftstellers. Boccaccio hielt fest, wie man mit dem massenhaften Tod verfuhr. Er protokollierte die Prozesse der Verrohung.
mehr
Die Philosophin Susan Neiman und der Politologe Ivan Krastev verbinden sich aus Berlin und Bulgarien live zu unseren Moderatorinnen auf der Bühne, um einen Raum der Reflektion zu öffnen …
mehr

Mein Smartphone vibriert. Eine Freundin, die gerade noch auf der Sea Watch 3 im Hafen liegt, schreibt aufgeregt: Die Alan Kurdi hat heute um die 150 Menschen aus Seenot gerettet!
mehr
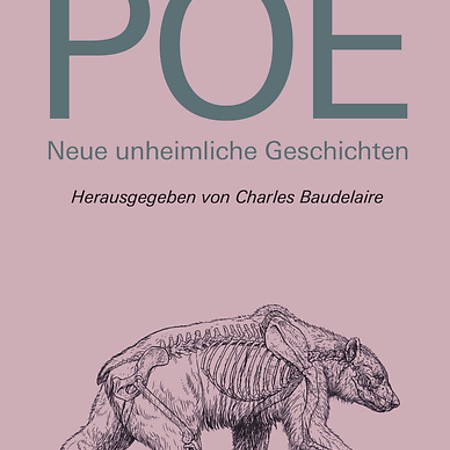
Er gab ihm aber auch Auftrieb und sorgte dafür, dass sich in Wilson die Spannung einer Feder aufbaute, während die Übrigen matt und unbeholfen ihre Hürden nahmen. Ihnen fehlte der Esprit ...
mehr
Was verbindet einen Farmer in Norfolk, dessen konservatives Repertoire offensichtlich erscheint, mit einem fashionvisionären Kombattanten im Kulturkampf von Shoreditch ...
mehr
Christopher Wylie erklärt, wie Facebook-Daten mit Hilfe von "Cambridge Analytica" zu Waffen gemacht wurden; wie Data Mining funktioniert und wie viel psychologische Manipulation hinter der Wahl von Trump ...
mehr

„Hast du dein Ei bereit?“, fragt meine Mutter am Telefon. Ich schaue auf meinen Teller und sehe, dass ich das Ei im Laufe des Gespräches schon gegessen habe. In Polen teilt man traditioneller Weise am Ostersonntag ...
mehr
Als vier Schwarze Mädchen in ihrem Alter bei einem Bombenanschlag ums Leben kommen, ist Diane McWhorter elf. An Dianes Highschool erschöpft sich die Pflichttrauer und Pseudopietät in der Absage einer Theaterprobe …
mehr
Das Schuldfeststellungsverfahren der Entnazifizierung versagte. Versuche, rechtsstaatlich einem Unrechtsregime beizukommen, untergruben sich nach der Logik des Kalten Krieges.
mehr
Die Schuld kann nicht geteilt werden. Sie lässt sich nicht vergleichen. Adorno sagt es so: Hitler zwang den Deutschen „einen neuen kategorischen Imperativ“ auf. Wir dürfen keine Wiederholung und nichts Ähnliches zulassen.
mehr
Irgendwo sagt Heiner Müller, sobald der Ethnologie Genüge getan wurde, stirbt der erforschte Stamm aus. Auf einen ähnlichen Gedanken stoße ich in Angela Bubbas literarischem Essay ...
mehr
Folgt man Neiman, dann nahm das Elend seinen Anfang und strikten Verlauf mit der Reconstruction (1865 – 1877) – einem Strukturprogramm der Washingtoner Zentralgewalt ...
mehr
Die Repression diktiert den Text. Gleichzeitig entsteht ein „Gegendiskurs“ zu einer Pathologisierung der Sexualität, in der die Homosexualität als Anlass zur Verfolgung sichtbar wird.
mehr
Hannah Arendt sieht in Rahel Varnhagen das Gegenmodell zum zur Assimilation entschlossenen „Parvenü“, der mit seinen Anstrengungen den „Paria-Status“ abzustreifen versucht.
mehr
Rahel Varnhagens Salon vergesellschafte den „Augenblick einer sozialen Utopie“. Er endete 1806 mit dem Berliner Auftritt Napoleons. Die Löwin führte ihren Salon schriftlich …
mehr
Die Repression diktiert den Text. Gleichzeitig entsteht ein „Gegendiskurs“ zu einer Pathologisierung der Sexualität, in der die Homosexualität als Anlass zur Verfolgung sichtbar wird.
mehr
„Mein Unglück ist der Gesellschaft anzulasten, die das Ungewöhnliche (meiner Homosexualität) wie ein Verbrechen verdammt.“ Jean Cocteau
mehr
Emanzipation braucht Urbanität und Permissivität. Eribon erinnert an „Transvestiten Bälle in New York“ als Magneten heterosexuellen Schaulust. Er beschreibt Subkulturen als Erben antiker Lebensweisen.
mehr
Eribon untersucht die urbane Melancholie der Familienlosigkeit im historischen Kontext der Homosexualität und entdeckt einen narrativen Niederschlag in Honoré de Balzacs „Vetter Pons“ …
mehr
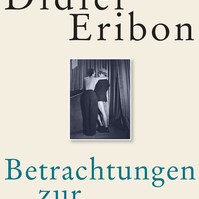
Der Autor diskutiert subkulturelle Strategien des 20. Jahrhunderts. Er analysiert eine mal mehr, mal weniger sichtbare gay culture im Plural ihrer Erscheinungen als Metropolenphänomen.
mehr
Didier Eribon erwähnt in seinen „Betrachtungen zur Schwulenfrage“ „homosexuelle Kodes“ in einem Kreis um Oscar Wilde. Man will sich aussprechen. Die Repression diktiert den Text.
mehr
Ab einer bestimmten Verwerfungsstufe versagt die Konkretion. Dreht man die Einsicht in die andere Richtung, kommt man zu dem KZ-Aufseher-Zynismus: Ihr werdet das hier sowieso nicht überleben. Und wenn, dann wird man euch nicht glauben.
mehr
Ab 1944 sammelt Ferencz als Soldat Beweise für deutsche Kriegsverbrechen. Er ist der erste mit dieser Angelegenheit befasste US-Army-Angehörige. Im Sommer 1945 übernimmt er Aufgaben eines Richters.
mehr
Die Exekutionsbilanzen sind einer Kompilation eingegliedert. „Sie (stehen) scheinbar selbstverständlich neben politischen, ökonomischen, kulturellen und ethnologischen Beobachtungen.“
mehr
Die Akten belegen Massenmorde unter der Befehlsgewalt von SS-Reichsführer Heinrich Himmler und dem Leiter des Reichssicherungshauptamtes Reinhard Heydrich.
mehr
Isabelle Eberhardt gibt ihrer Heldin ein Schicksal, das von einem wahrscheinlichen Verlauf abweicht. Versprochen wird sie dem einäugigen Mohammed Elaour, der Mühe hat, den Brautpreis aufzubringen.
mehr
Wo liegen die Ursprünge antisemitischen Denkens? Was heißt es, jüdisch zu sein, ohne den definierenden Blick des Antisemiten? Und wie hängen Antisemitismus und …
mehr
Die Rolle des Retters übernimmt im „Leoparden“ der Familienhusar Tancredi Falconeri. Seine Mannschaft ist seit tausend Jahren im Spiel. Sie dient der Macht, wer immer sie ...
mehr
Obwohl sowohl die EU als auch die USA Hamas und Hisbollah als Terroragenturen einstufen, nennt Corbyn einzelne Parteigänger*innen der genannten Organisationen „Freunde“.
mehr
Viele fühlten sich aufgerufen, aber nur wenige waren auserwählt. Am 13. September 1964 machten auserwählte Ostberliner (linientreue Protestanten) große Augen.
mehr
1943 werden der niederländisch-jüdische Arzt Eddy de Wind und seine Frau Friedel nach Auschwitz deportiert. Als Häftling mit der Nummer 150822 erlebt Eddy den Terror der …
mehr
Salina wähnt sich nicht im Besitz der besseren Mittel im Vergleich mit der politischen Konkurrenz. Er hält sich lediglich für legitimer im Rahmen der alten Ordnung …
mehr
„Unter dem fordernden Vergrößerungsglas der Erinnerung“ erkennt der Mörder des Volkstribuns Martin Luther King eine trostlos-lächerliche Relation von Anmaßung ...
mehr
Weit davon entfernt ein Draufgänger zu sein, bestand Ray vor allem Abenteuer des Geistes. Er experimentierte mit Hypnose und Autosuggestion und arbeitete erstaunlich effektiv an sich.
mehr

Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, plädierte auf dem Gemeindetag 2019 für einen jüdisch-muslimischen Dialog, „der präventiv wirken soll“.
mehr

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz erklärte auf dem Gemeindetag 2019: „Die Sicherheit der Juden in Deutschland ist Staatsräson.“
mehr
Niemand könnte den Niedergang des Feudalen leuchtender anzeigen, als der priesterschwarz gekleidete Don Calogero. Noch verkörpert er das Bürgertum (die kommende Klasse) in falscher ...
mehr
Als chilenischer Konsul in Paris verhalf Pablo Neruda im spanischen Bürgerkrieg geschlagenen Republikanern zu einer Passage in die Freiheit.
mehr
Im ersten Band der jüdisch-muslimischen Dialogreihe des Zentralrats der Juden in Deutschland „Schalom Aleikum“ berichten fünf jüdische und fünf muslimische Seniorinnen ...
mehr

Im August 1861 erscheint der Kammerdiener des rechtzeitig verstorbenen Königs beider Sizilien beinah als Appendix des leichtsinnigen und schnell schaltenden Fürstenneffen ...
mehr
Der Kammerherr eines nachlassenden Königs sieht die Suprematie der Savoyen kommen. Auf Deutschland übertragen, entspricht Ferdinands Position im Machtgefüge ...
mehr
Zwanzig Jahre moderiert Matt Lauer die NBC Today Show. Der geborene New Yorker ist eine nationale Instanz und ein gern gebuchter Eröffnungsredner von Weltereignissen …
mehr
„Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern.“ Mit dieser Binse bestürmt Tancredi seinen Onkel und Vormund, den Fürsten Salina.
mehr
Walburga Hülk zeigt die größten Geister der Epoche im Morgenmantel ihrer Bedeutung. Flaubert schlägt sich mit Studien zu Madame Bovary herum. Baudelaire ...
mehr
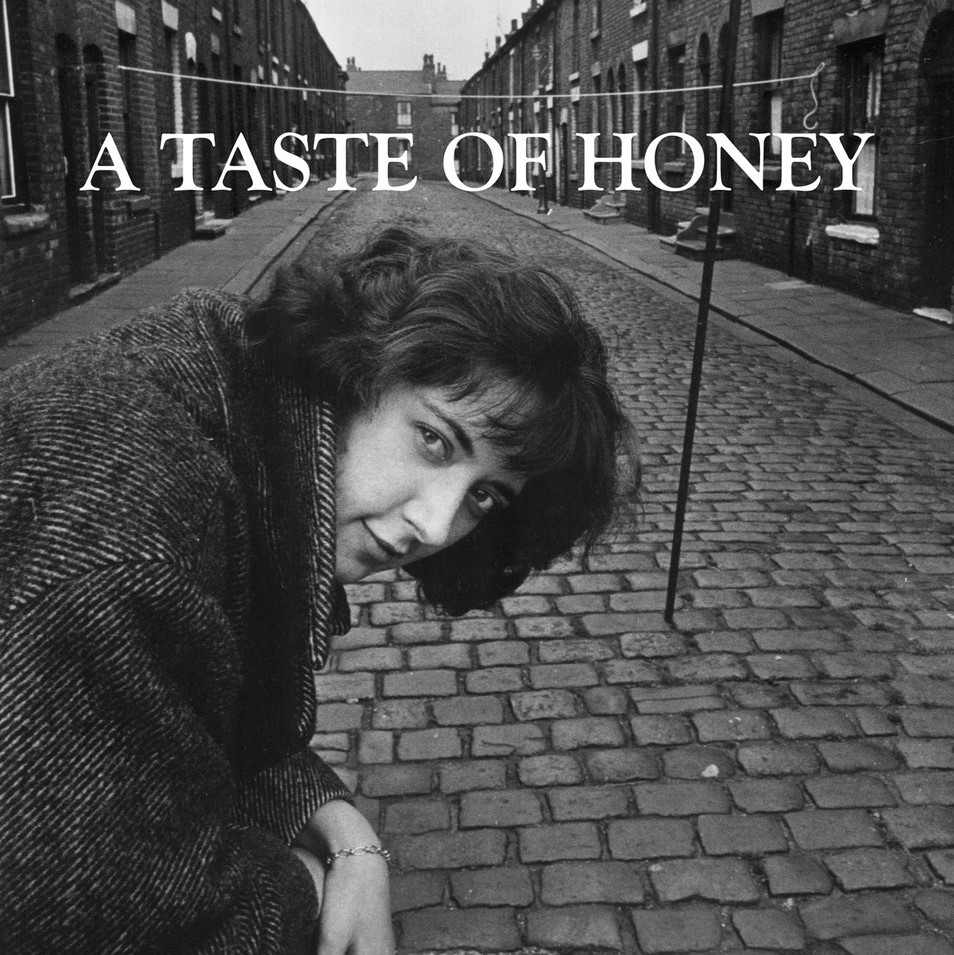
Sie zählte zu den namhaften Angries um John Osborne und Alan Sillitoe. Ihre literaturgeschichtliche Bedeutung oszilliert zwischen Meilenstein und Ikone: Shelagh Delaney ...
mehr

Putin erkennt den westlichen Kanon nicht an. Er hält die Sieger der Geschichte für korrupter und amoralischer als die Heloten des Ostens mit ihrem herausposaunten oder unter den Teppich ...
mehr
Das Regime der Renaissance in der Vielzahl seiner florentinischen und venezianischen Erscheinungen endet gerade: auch im Garten des Fürsten, wo Rosen ...
mehr
Leichtbauweise der Konspiration - Girlfreshman Fox wundert sich ... wie unterkomplex abgedecktes Verhalten ist und wie leicht die toten Briefkästen der Netz-Zeit gebaut sind.
mehr
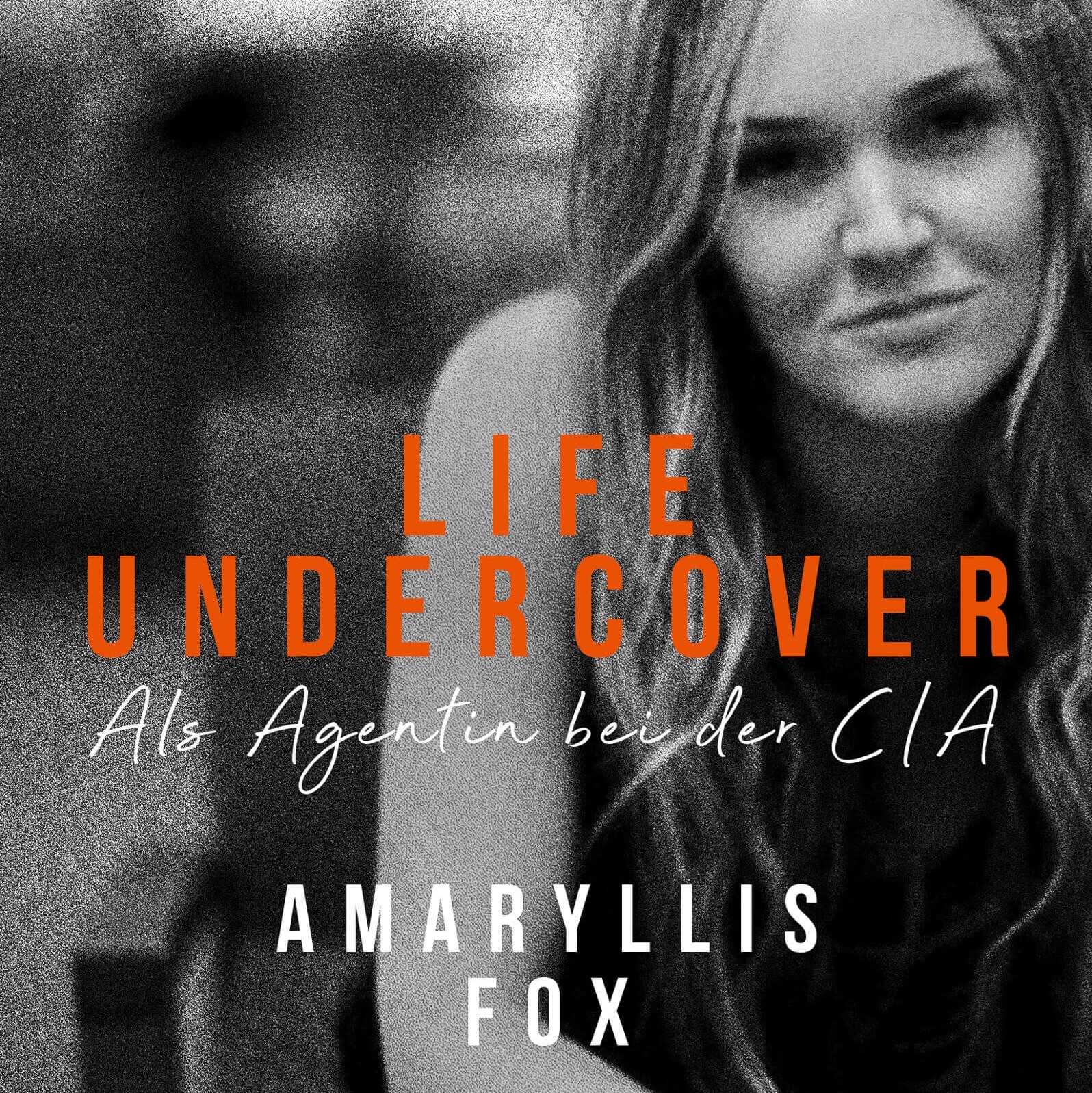
Den ersten Anwerbeversuch unternimmt ein Geheimdienst in Oxford, wo Amaryllis Fox studiert. In der Debütantin paart sich bürgerlicher Ehrgeiz mit Abenteueraltruismus.
mehr
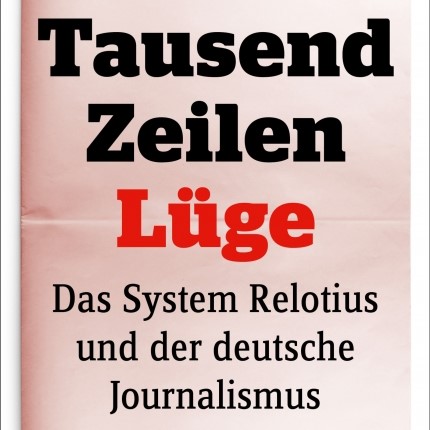
Der Autor wundert sich. Er wundert sich seitenlang über die Ruhe, mit der Claas Relotius dem aufziehenden Sturm begegnet, der ihn wegfegen wird. Juan Moreno spekuliert über die ...
mehr

Für Michael Lentz gehört das Grimm’sche Wörterbuch zur täglichen Arbeit. Vorbildlich findet er Celinés „Reise ans Ende der Nacht“ als „Weltreise durch das Französische“.
mehr

Den letzten Newsletter habe ich im Juli 2018 verschickt, seitdem war Atemlosigkeit. Vor allem wegen der großen Aufmerksamkeit, die meinem Buch "Desintegriert Euch!" ...
mehr
Isabel Allende will jenen eine Stimme geben, die von der männlichen Geschichtsschreibung ignoriert wurden. Dazu zählten die meisten der fünfhunderttausend spanischen Flüchtlinge ...
mehr
Jeder kennt Ewan MacColls Evergreen „Dirty Old Town“. Die Wenigsten wissen, dass das Lied als Hommage an MacColls und eben auch Shelagh Delaneys Geburtsstadt Salford …
mehr
Pablo Neruda wähnte sich für alle Zeit im Gedächtnis der Völker aufgehoben nicht seiner Dichtung wegen. Vielmehr glaubte das chilenische Nationalgenie, den Ehrenplatz verdient zu haben …
mehr
Kein Bild einer Entladung erreicht den tristen Furor eines Meteoritensturms. Im Verlauf ihrer Geschichte wurde die Erde immer wieder bombardiert und jedes Mal kam es zu ...
mehr
»Heimat« wird zurzeit in Großbuchstaben an jede Wand der Republik projiziert. Jedoch nicht im Sinne von Empathie und Solidarität mit den Menschen …
mehr
In ihrem Roman „Nahrs letzter Tanz“ erzählt Susan Abulhawa von der palästinensischen Diaspora in Kuwait vor der irakischen Invasion 1990.
mehr

Karamba Diaby gefällt es, als „Schwarzes Sprachrohr“ das Glück im Winkel deutscher Kleingärten weltweit zu kommunizieren. Der im Senegal geborene und in Halle ...
mehr
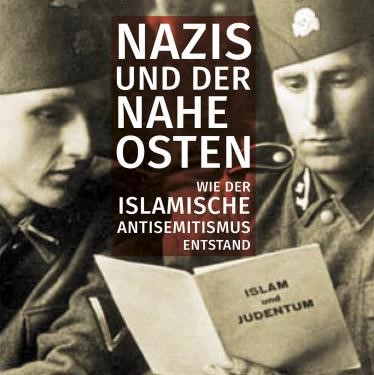
1937 kam mit der Broschüre „Islam und Judentum“ eine neue Form von Judenhass in die Welt: der islamische Antisemitismus. Die Nationalsozialisten taten alles, um ...
mehr
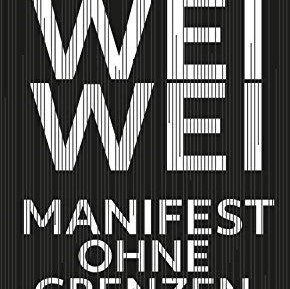
Geprägt von schmerzhaften Erfahrungen des Exils, insbesondere des Zwangsexils seines Vaters, stellte sich bei Ai Weiwei früh das Gefühl des Fremdseins ein.
mehr
Bald nach dem Krieg wird Buchenwald zum „Gegenstand strategischer Geschichtspolitik“. In diesem Kontext betrachtet Ines Geipel dann auch Bruno Apitz‘ „Nackt unter Wölfen“.
mehr
2017 verbrachte er einen Sommer auf Lesbos, um sich „am südlichen Rand Europas“ umzuschauen. Prosser datiert präzise: „Es war das Wochenende des G20-Gipfels.“
mehr
Ayesha Harruna Attah ist die Ururenkelin einer Sklavin. Die Ahne wurde in einer präkolonialen Gesellschaft zwischen Islam und Animismus auf dem Territorium des heutigen Ghana ...
mehr

Die historischen Anleihen an mittelalterliche Jahrmärkte, Kirmes-Zinnober und obsoleten Budenzauber tragen zu einem Straight Edge-Jugendstil bei. Kein Alkohol, keine Drogen ...
mehr

Dem ständig betonten Revolutionscharakter zum Trotz erinnert Extinction Rebellion Environment an Kopenhagener Straßenszenen in den Siebzigerjahren.
mehr
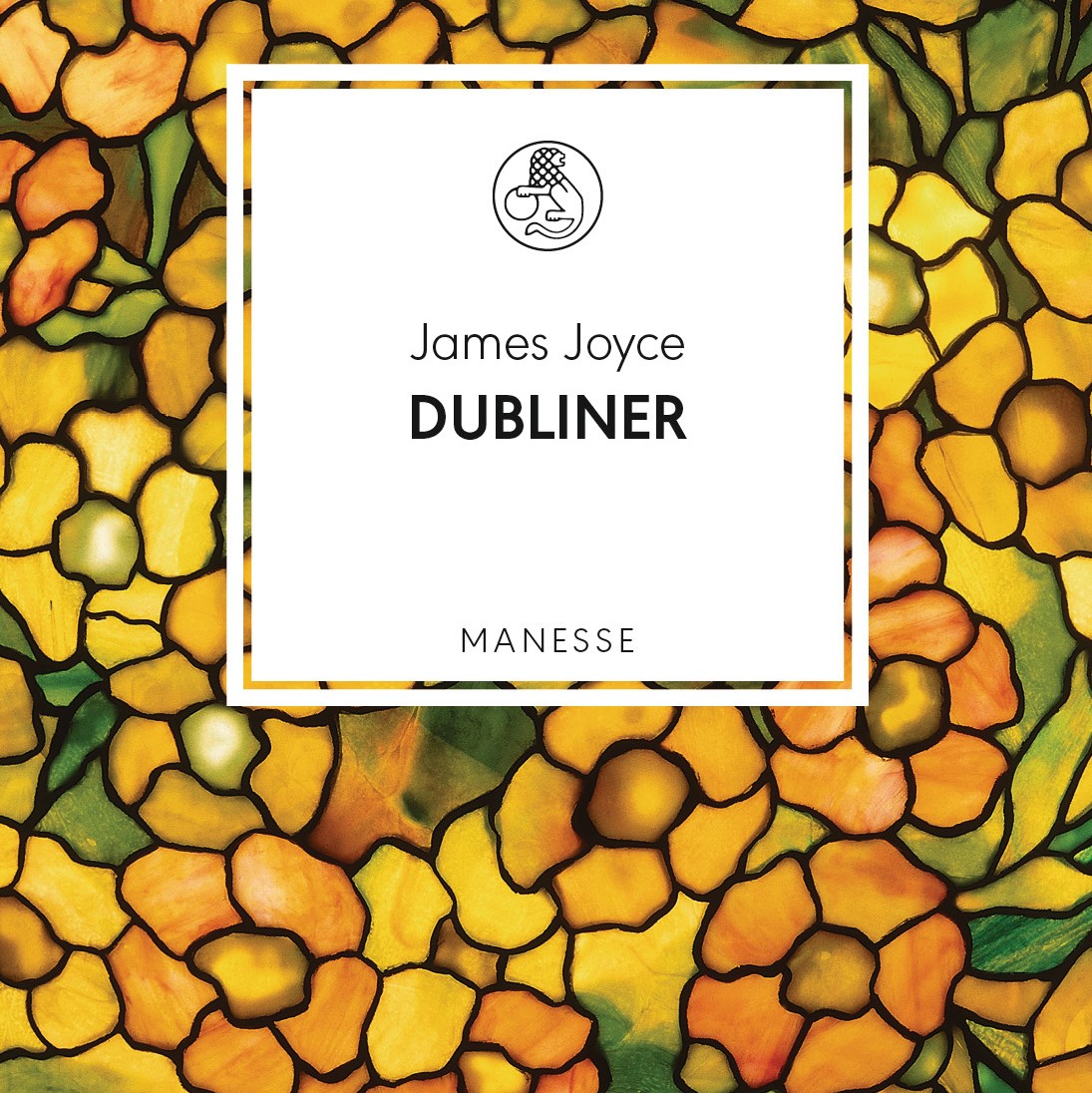
Er ist so eitel, dass er keine Herabsetzung je vergisst, so elitär, dass ihn die Dummheit der anderen schüttelt, und so risikoavers, dass man von ihm besser keine Heldentaten erwartet.
mehr
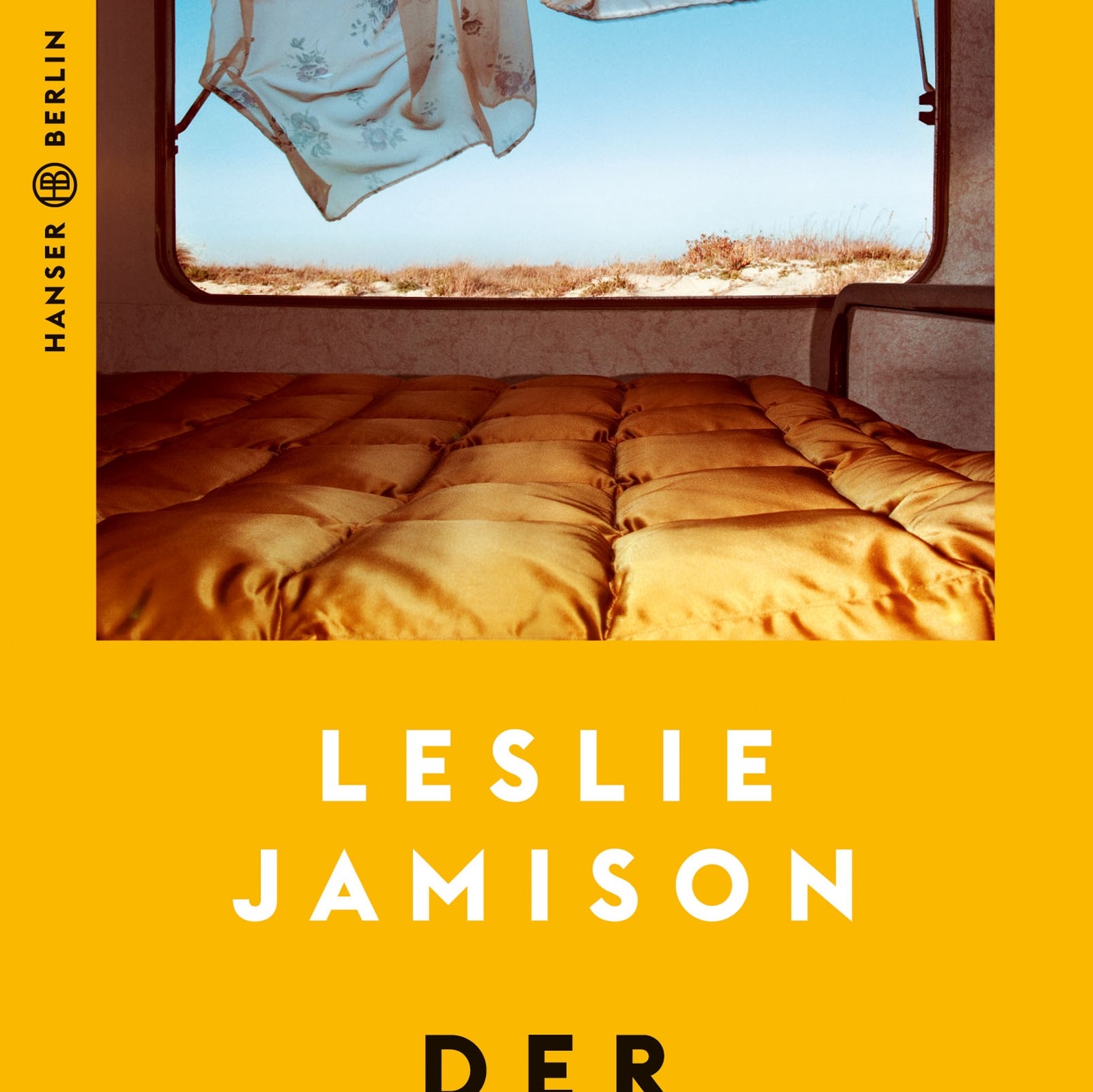
Leslie Jamison geht der Frage nach: Was bedeutet Familie, wenn sie als Wett - und Losgemeinschaft in der Lotterie des Lebens ihre Entscheidungen nach denselben Kriterien trifft wie ein …
mehr
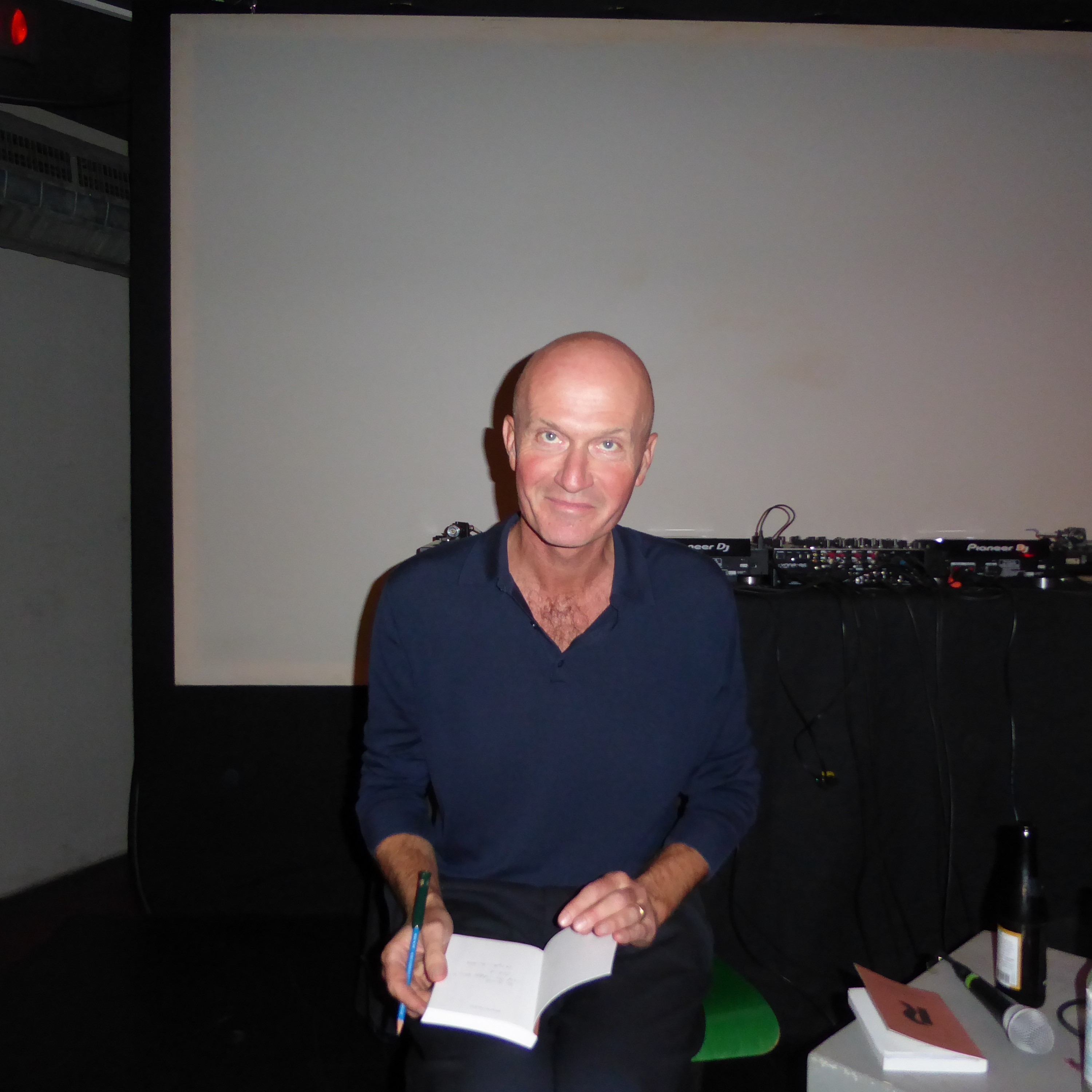
„Die Signatur unserer Gegenwart“ ist der Traum vom Weiterwursteln. Hirsch zitiert Walter Benjamin, der im Jetzt der 1920er Jahre die Katastrophe sah, die andere erst ...
mehr

Rechte Internetpartisanen kombinieren die Gewaltlosigkeitsästhetik des zivilen Ungehorsams mit ihren Perspektiven.
mehr
Unter der Überschrift DE-HEIMATIZE IT! versammelt der 4. Berliner Herbstsalon eine Werkschau bildender Künstler*innen mit einem umfangreichen Theater-, Performance- ...
mehr
Gappah war nach dem erzwungenen Rücktritt des ewigen Staatschefs Robert Mugabe nach Simbabwe zurückgekehrt und hatte sich Emmerson Mnangagwa, dem regierenden Chef ...
mehr
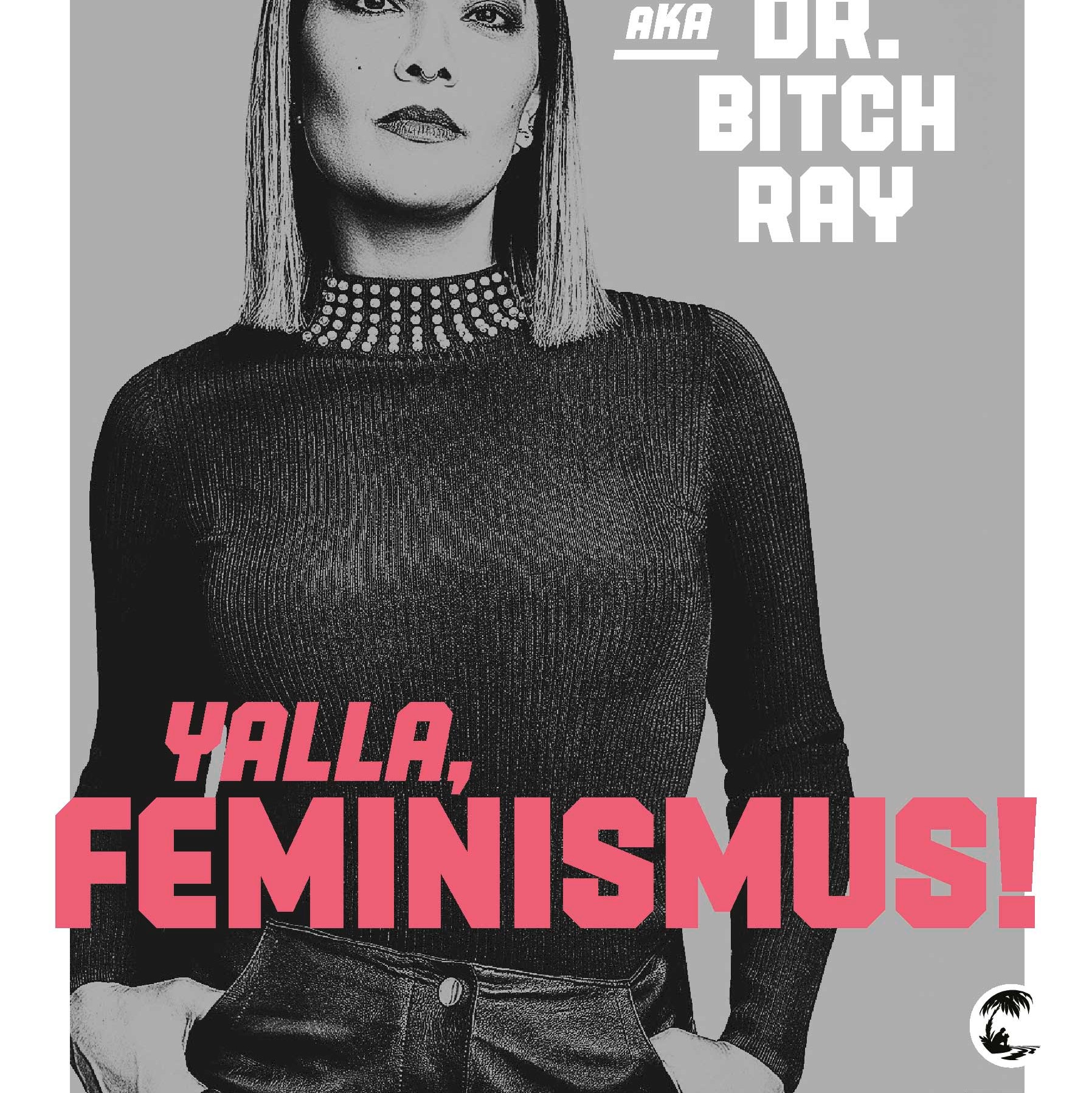
„Es gibt keinen Feminismus, der Rassismus ausklammert. Intersektionalität ist „a way of seeing“; „ein Depot voller ungehörter Geschichten“; eine Kraftquelle und ein Fundus der Gegenrede – backtalk.
mehr

Wer mit Svenja befreundet sein wollte, musste Alice ignorieren. Das waren die Spielregeln in der Grundschule. Nach einem polyglott-privilegierten Superstart in einer Transkontinentalrakete ...
mehr

Alles ist arrangiert, nichts bleibt dem Zufall … überlassen. Ein gemeinsames Merkmal von Zivilisationen babylonisch-pharaonischem Formats ist ihre Geringschätzung des Gefühls.
mehr
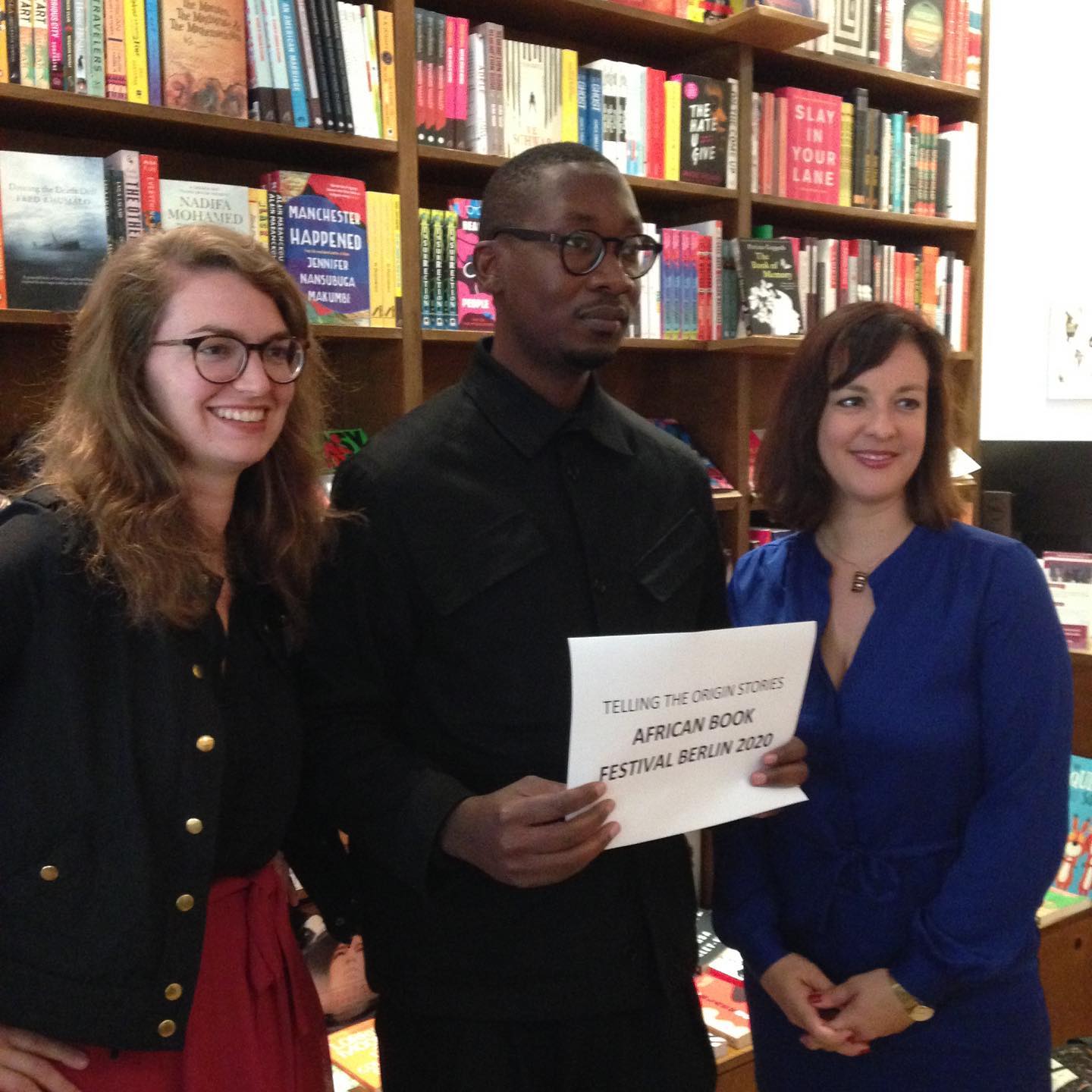
Der Musiker und Autor Kalaf Epalanga wird Kurator des nächsten African Book Festival in Berlin, das vom 17.-19. April 2020 zum dritten Mal die Stars der afrikanischen Literatur ...
mehr
Darum ging es auf der Bühne: Literarische Dramatik versus theatralische Hochhausbegehungen auf einer vom Schauspieler*innenkollektiv erarbeiteten Textbasis.
mehr

Eine Paradoxie der deutschen Nachkriegsgeschichte besteht darin, dass sich das Schweigen der Heimkehrer in einem Erzählgestrüpp verfing und gemeinsam ...
mehr

Man unterscheidet diskursive, kognitive, emotionale und affektive Kontaktpunkte und Reibungsflächen zwischen ethnisch-nichtdiversen Mehrheitsgesellschaftern und ...
mehr
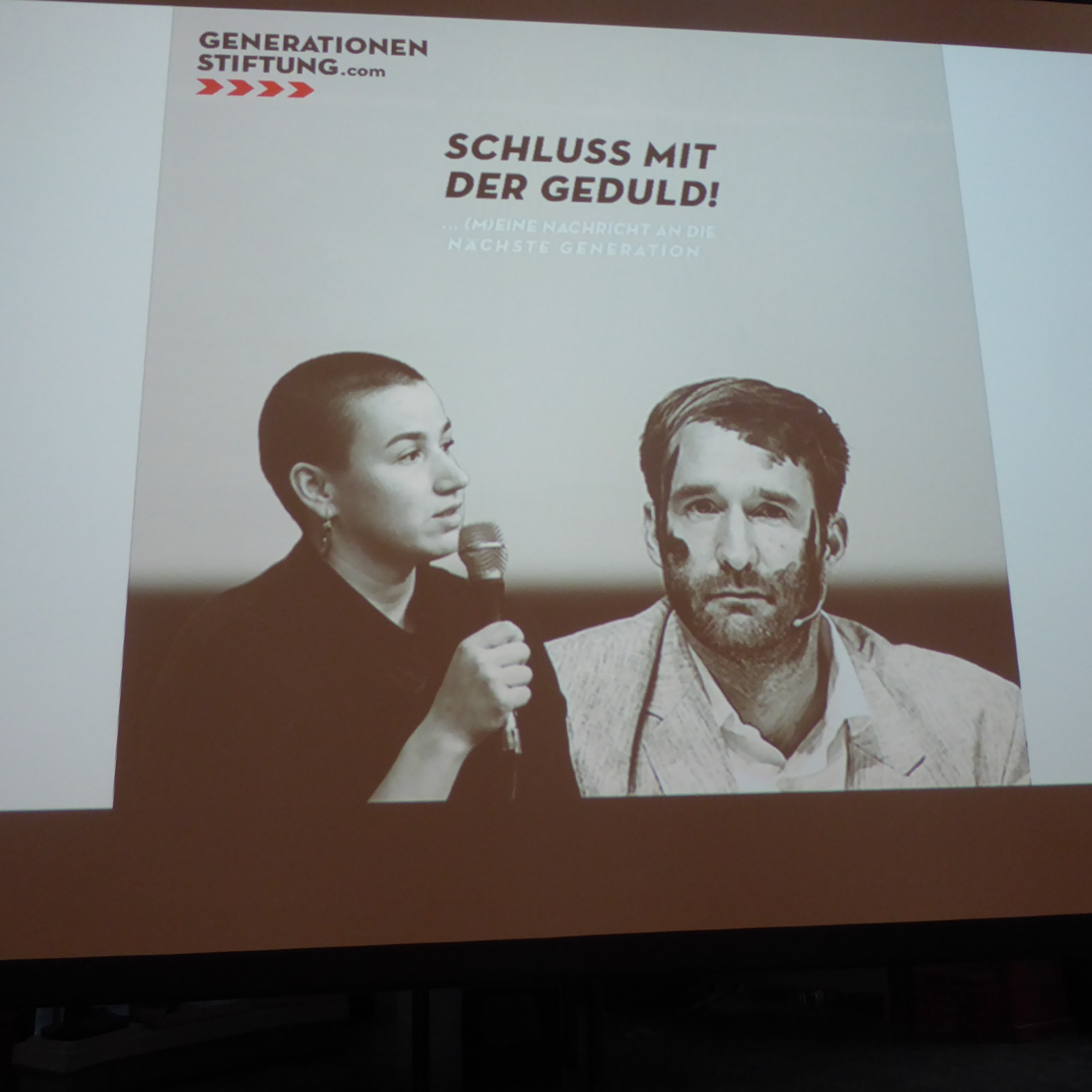
Philipp Ruch, ein „moralischer Hardliner“ nach eigener Angabe sagt: „Ich kann den Abgeordneten zwingen und erpressen. Man muss wissen, wie man das macht.“
mehr

Philipp Ruch konstatiert eine historisch konstante Gleichzeitigkeit. „Gleichzeitig wird (im Mittelmeer) gebadet und gestorben“. Der politische Philosoph kommt auf Voltaire ...
mehr

Philipp Ruch behauptet: „Entweder wir gewinnen in den nächsten sieben Jahren“ den Kampf gegen Rechts oder „wir verlieren ihn“ mit Folgen, die sich die meisten nicht vorstellen können.
mehr

Der linke Antisemitismus sei älter als der Zionismus, entgegnete Rabinovici. In marxistischen Kategorien sind die Juden- und Frauenfragen revolutionshemmende Nebenwidersprüche.
mehr
Morgens holen Vater und Tochter Baguette und kehren im Café du Commerce ein, wo dieser in romanischen Ländern alltägliche Frühstücksstehbetrieb an der Bar besonders einladend ...
mehr

Erinnerung ist ein Modus der Fiktion, Sagt Senthuran Varatharajah.
mehr

Unser Unbewusstes strukturiert die Sprache. Senthuran Varatharajah denkt Jacques Lacan auf der Textland Bühne weiter.
mehr

Die Erneuerung des arabischen Gedichts ging vom Irak aus. Da experimentierten in den … Avantgardisten mit Schismen und Tabubrüchen – im Vorgriff nationaler Befreiungskämpfe.
mehr

Philipp Ruchs aktuelles Buch bringt es auf den Punkt: „Schluss mit der Geduld – Warum jeder etwas bewirken kann – eine Anleitung für wehrhafte Demokratie“.
mehr
Als Sohn eines Maurers aus den Abruzzen verehrte John Fante den Ausnahmeathleten Joe diMaggio mehr als Hemingway. DiMaggios Ruhm überstrahlte alle.
mehr
An einem Salzkristallmorgen in Saintes-Maries-de-la-Mer geht der Erzähler mit seiner Tochter zum Bäcker. Die Strecke zieht sich hin an einem Saum des verröchelnden Gestrüpps ...
mehr
Peter Kurzeck ließ gern den Eindruck entstehen, die Alltagskatastrophen führten ihre finsteren Schwänke allein zu seinem Erstaunen auf.
mehr
Basil sagte: „Die Sprache wurde von Populist*innen vergiftet. Die Literatur ist ein Ort, wo man den Worten wieder ihren eigenen Klang geben kann.“
mehr

Die Jury des 27. open mike ist benannt: Thomas Meinecke, Clemens Meyer und Uljana Wolf werden beim Finale des Wettbewerbs für junge Literatur vom 8. bis 10. November ...
mehr
In der Mühle eines strapaziösen Müßiggangs werden die Tage gemahlen, nachdem sie kopfüber durch den Trichter gepurzelt sind. Gerade war noch gestern, zumindest heller Nachmittag …
mehr

Wir müssen auch laut sein, um für Demokratie und die Veränderbarkeit der Verhältnisse zum Besseren einzustehen. Kann Literatur helfen, die offensichtlichen Polarisierungen ...
mehr
Auf die Frage des Ethiklehrers, „wer von euch glaubt, in den 1930er Jahren immun gegen die nationalsozialistische Propaganda gewesen zu sein?“, hob Beyer den Arm ...
mehr
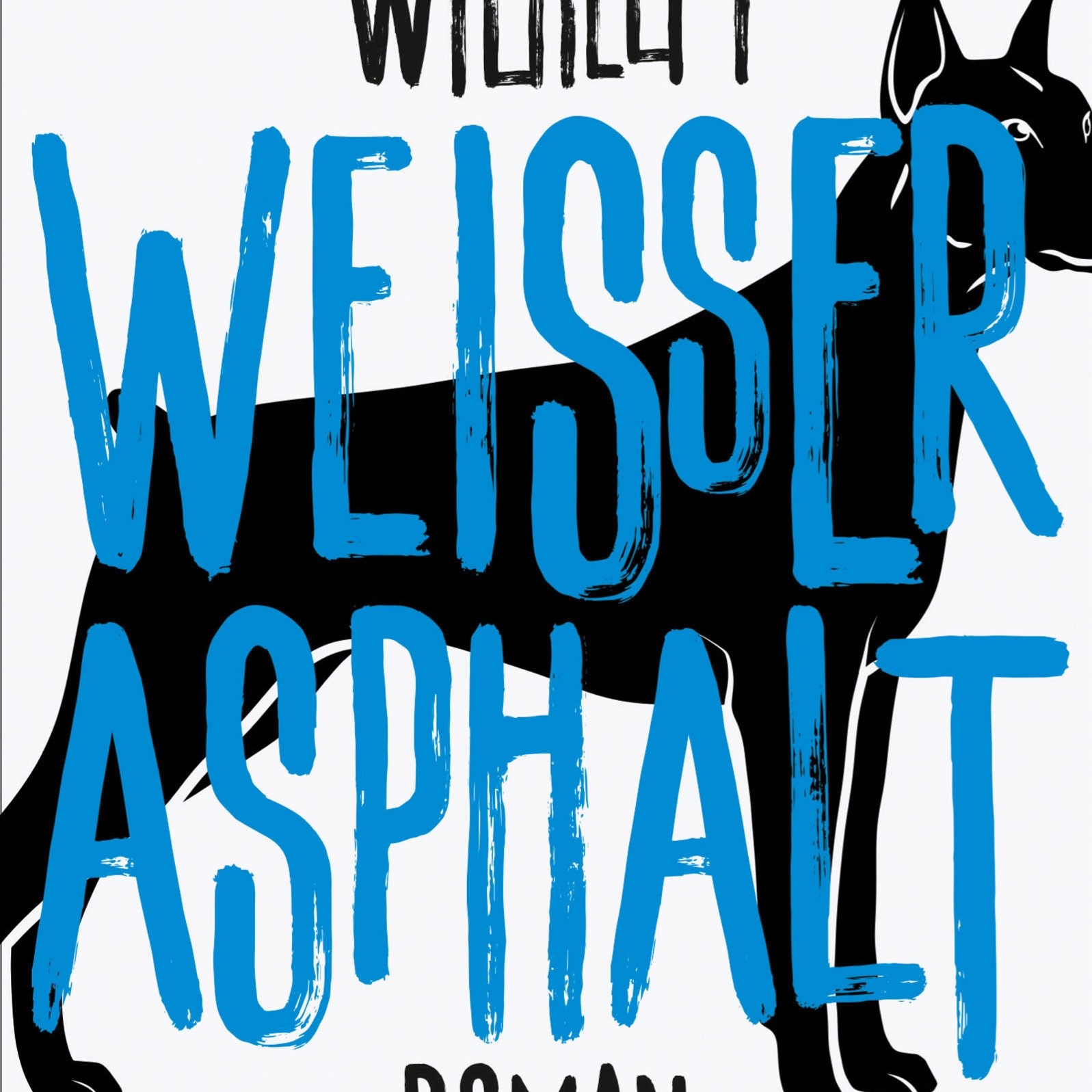
Vor einer Massenschlägerei wird dem Erzähler übel. Ich erlebe seine Übelkeit, so eindringlich ist die Schilderung. Tobias Wilhelm verzichtet auf jede Effekthascherei.
mehr
Während „Exit U.S.“ die sterbliche Leiblichkeit ihrer Klienten komplett verwahrt, lagert man anderenorts nur Köpfe ein; in der Erwartung, sie einmal auf effektivere Datenträger ...
mehr
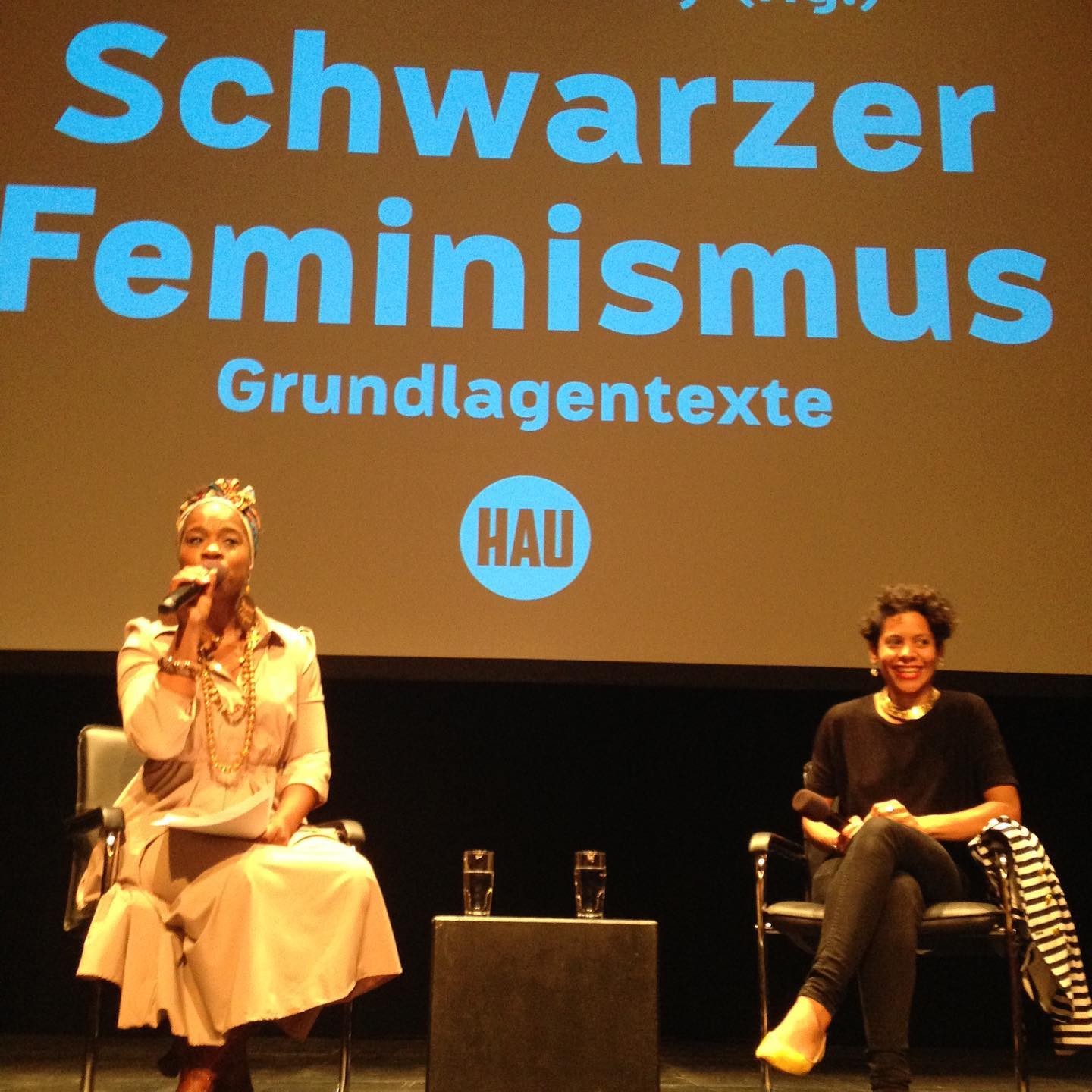
Patricia absolviert eine Kindheit unter härtesten Bedingungen. Sie wird „gehänselt, geschubst, beschimpft, bespuckt“. Wenn sie Glück hat, findet man sie exotisch. Fremde fassen sie ...
mehr
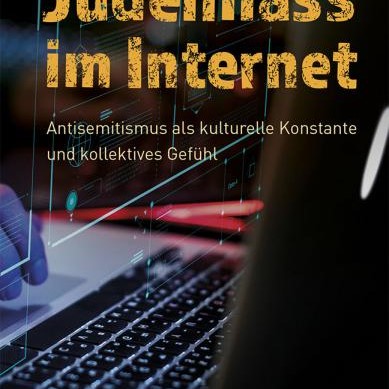
Beschworen wird das angebliche „Tabu, etwas gegen Juden sagen zu dürfen“. In einer Welt voller antisemitischer Bemerkungen entlarvt es sich nicht einfach als das ...
mehr
In einem rotweißen Fahnenmeer erlebt Smechowski einen Gänsehautmoment, bevor der kritische Abstand sich wiedereinstellt. .
mehr
Man kann nie wissen, was aus einem Ungeheuer wird, wenn man es küsst. Mit dieser Einsicht beginnt ein Nachdenken über weibliche Rollen in Mythen und Märchen ...
mehr
Es kommt zu Selbstverstümmelungen aus Angst vor der heilsverwehrenden Begierde. „Freiwillig verschnittene“ Jungfrauen konkurrieren mit barbarisch Amputierten.
mehr
Foucault zeigt, dass die Ökonomisierung der Sexualität, die sich bis in den Regelvollzug fortsetzt, nicht erst vom Christentum ausgelöst wurde, sondern vorher da war.
mehr
Die Opfer der Expansionen und Ausbeutungsfeldzüge des Globalen Nordens tauchen im Text als gleichberechtigte Aktivist*innen von Verheerungen auf.
mehr
Foucault schreibt: Der Priester wird Richter, besser gesagt wäre, er tritt als Gottes Staatsanwalt auf den Plan. Er stellt sich zwischen den Sünder und Gott.
mehr
Chimamanda Ngozi Adichie erklärt Enugu zum Schauplatz einer Geschichte, die insofern vom Kurs ihrer feministischen Großerzählung (im Widerspruch zu der landläufigen ...
mehr
Es gibt nun einen Antisemitismus im Namen der Menschenrechte. Der britische Labour-Chef und Gewerkschaftsfunktionär Jeremy Corbyn nennt ...
mehr

Solange der Erzähler in seiner Geburtsgegend gut aufgehoben ist, rebelliert er gegen die Verhältnisse. Ihn provoziert der konzertierte Abschluss hinter Lebensbäumen und das ...
mehr
In der Hochzeit der Afrika-Expeditionen und der spekulativen Ethnologie befasste sich der Journalist Henry Mayhew (1812 - 1887) mit der Armutsarchaik vor der eigenen Haustür.
mehr
Sie nannten ihn den Irren von Triangel. Bernward Vesper bemühte sich um die Veröffentlichung der Schriften seines NS-Vaters, während er zugleich „Schriftsteller gegen den Atomtod“ ...
mehr

Ich muss Ihnen sagen, ich habe nie an mir gezweifelt. Das Selbstbewusstsein rührt nicht allein von meiner halbgöttlichen Herkunft, über die zu sprechen wir bislang versäumt haben.
mehr

Ich erinnere an Brainfuck von Sibylle Berg: „Wir werden sie aufspüren, ihre Schwachstellen herausfinden und ihnen eine Sekunde schenken, die sie nie vergessen werden.“
mehr

„Hände hoch! Mein entsichertes Jahrzehnt“ – Unter diesem Motto steht die Leistungsschau der Nachwuchsschreibwerkstätten im Berliner Haus für Poesie.
mehr
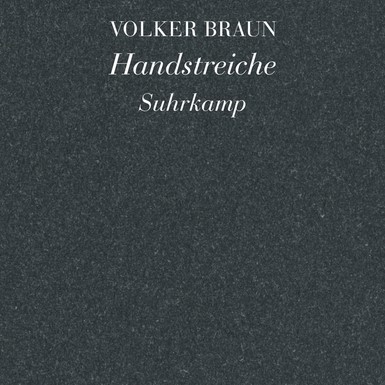
Seine Habseligkeiten behält er im Blick. Er nennt das „die Habsucht der Augen“.
mehr
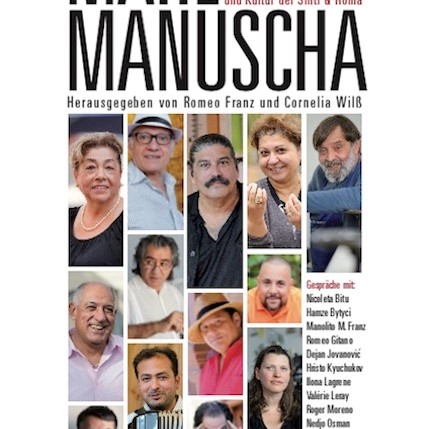
„Die Katastrophe ist für mich nichts Außergewöhnliches, weil ich in einer Katastrophe lebe“, sagt der seit Jahrzehnten in Dachau gegen das Vergessen und neofaschistische Infamien ...
mehr

„Mittelstandskindern mit Hochschulabschlüssen und Jobs“ tragen „den sozialen Krieg, der seit geraumer Zeit an den Rändern des globalen Systems tobt“, auf die Magistralen ...
mehr
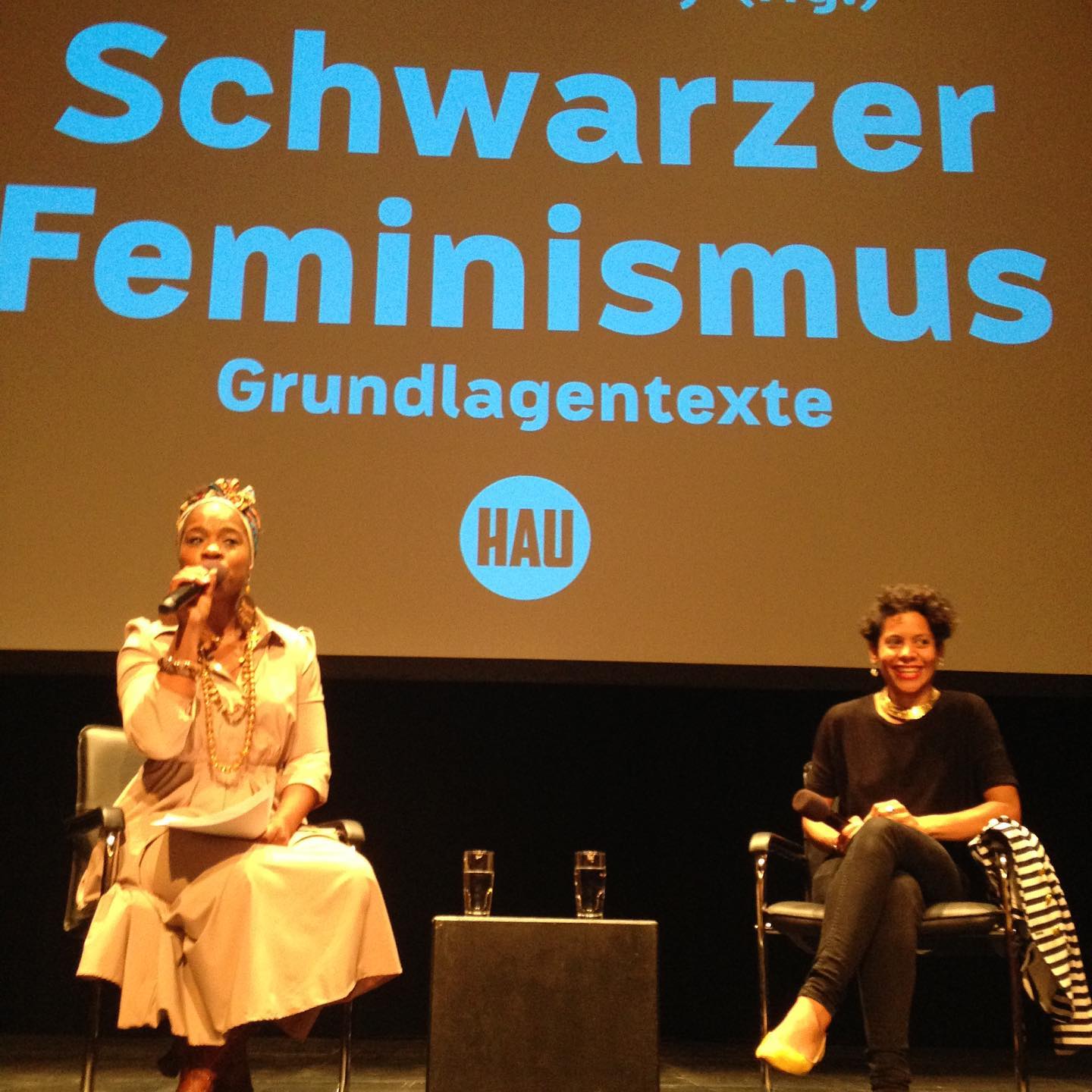
Nach ihr wurde der erste Rover, der 1997 mit der Sonde Pathfinder auf dem Mars landete, benannt. Die Biografie der als Tochter von Sklaven in Unfreiheit geborenen Sojourner Truth ...
mehr
Die Mutter war so, dass Männer ihr zu gefallen suchten. Sie sprach nicht gern, doch fand jedes Wort aus ihrem Mund die größte Aufmerksamkeit. Amos Oz schildert ...
mehr

Wir nannten ihn Fredo nach dem unfähigsten Sohn des großen Don. Selbst die aus Vorsicht höflichen Odalisken in den Tempeln, die sich die Mafia ...
mehr
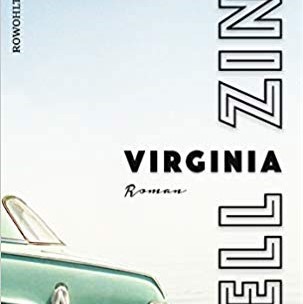
Das Stillwater Mädchen-College ist ein Universum für sich, „so autonom wie eine Militärbasis“. Es liegt außerhalb eines Städtchens gleichen Namens im ländlichsten Virginia ...
mehr
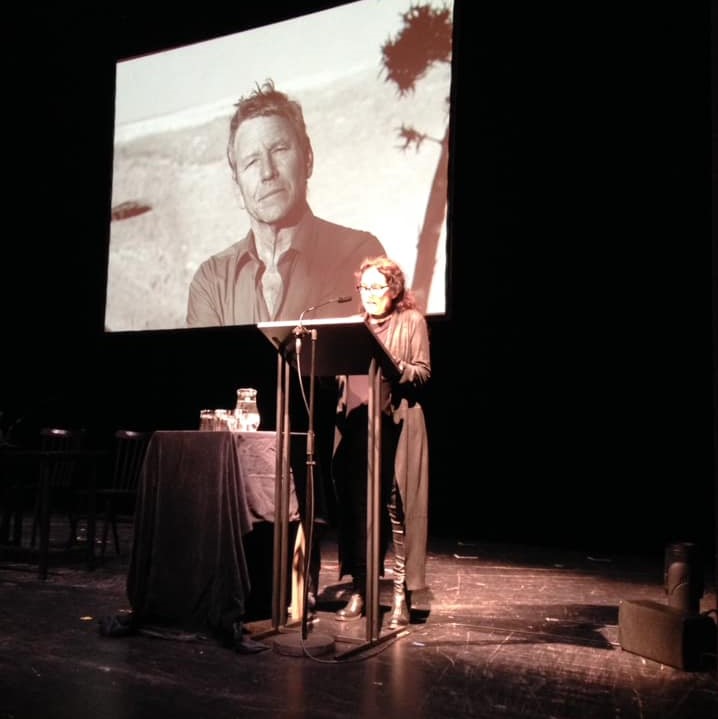
Sie schildert Oz als einen typischen und zugleich überragenden Vertreter der israelischen Aufbaugeneration. Fania Oz erinnert sich an einen ...
mehr

Erdoğan ist die Staat gewordene Selbstermächtigung.
mehr

„Es geht nicht darum, gefangen zu sein. Sondern darum, sich nicht zu ergeben. Nâzım Hikmet
mehr

Im Mondtakt geflutet, teilt ein Priel, der bei Ebbe trockenfällt, eine küstennahe Insel des Lamu-Archipels vor Kenia. Ayaana wächst in der Marsch von Pate vaterlos und einzelgängerisch auf.
mehr
Diskurskuratorin Margarita Tsomou forderte eine große linke Gegenerzählung (als alternatives europäisches Narrativ) zum „Historischen Optimismus“ ...
mehr
In „Feminismus Revisited“ protokolliert Erica Fischer Aussagen junger Aktivistinnen der Generation Netzfeminismus.
mehr
Enzensberger ist der Untreue bei Suhrkamp, der einzige Autor, der von dem „Ski- (wahlweise) Schwimmlehrer“ Unseld nicht in Ketten geschlagen werden kann.
mehr
Zum 20. Poesiefestival Berlin spricht Raimondi in der Akademie der Künste über die Maßlosigkeit des Kapitalismus.
mehr

Lee Fleming spielt das invertierte Enfant terrible und den „Dichter, der uns aufrührt“ à la Rimbaud, bis ihm ...
mehr

Wenn Leute behaupten, ich wirke spaltend, entgegne ich: Was ich zu tun versuche, ist sicherzustellen, dass die Spaltungen, die es gibt, uns nicht davon abhalten …
mehr
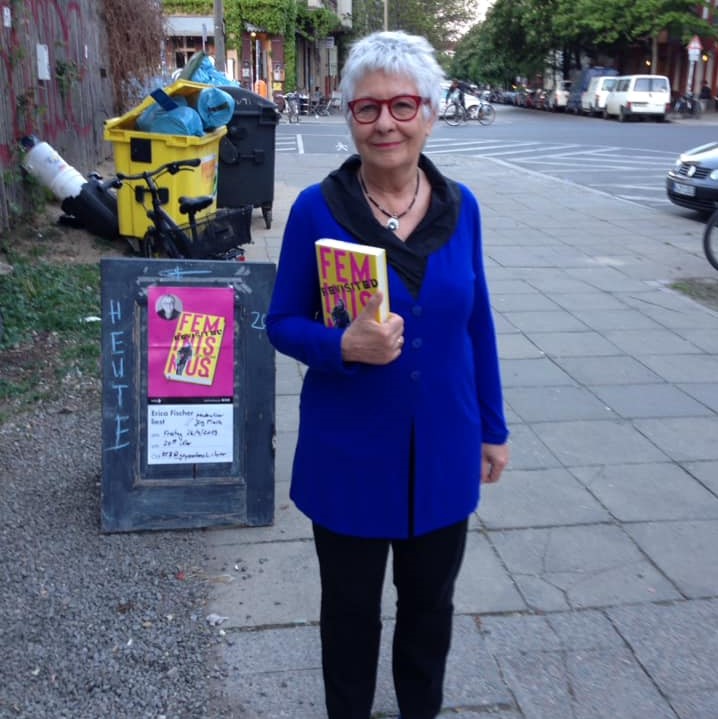
Als nicht-binäre „muslimisch-migrantisch und weiblich gelesene“ Persönlichkeit kann Yaghoobifarah jederzeit einen Kasatschok der Devianz und der Diversität aufführen.
mehr
Jede Rettung ist mit einem Dilemma verbunden. Rettet man die drei direkt vor der Nase oder ...
mehr
Vor 30 Jahren prägte Kimberlé Crenshaw den Begriff „Intersektionalität“, um das Zusammenspiel unterschiedlicher Unterdrückungsformate ...
mehr
Zentral im Werk von Anne Duden ist das Interesse am ikonografischen Drachenkampf. Ihre konsequente Parteinahme für den Drachen ...
mehr

„Stumme Schwäne“ ist ein Schlüsselroman, geschrieben mit den bürgerlichsten Absichten des 18. und 19. Jahrhunderts ...
mehr

„Die Menschheit hat nur aufgrund von Migration überlebt. Mensch zu sein, heißt zu migrieren.
mehr
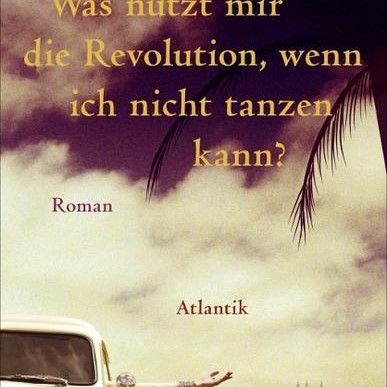
Was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann. Der Titel variiert ein Zitat der russischen Feministin Emma Goldman: If I Can‘t Dance, I Don‘t Want To Be Part of Your Revolution.
mehr
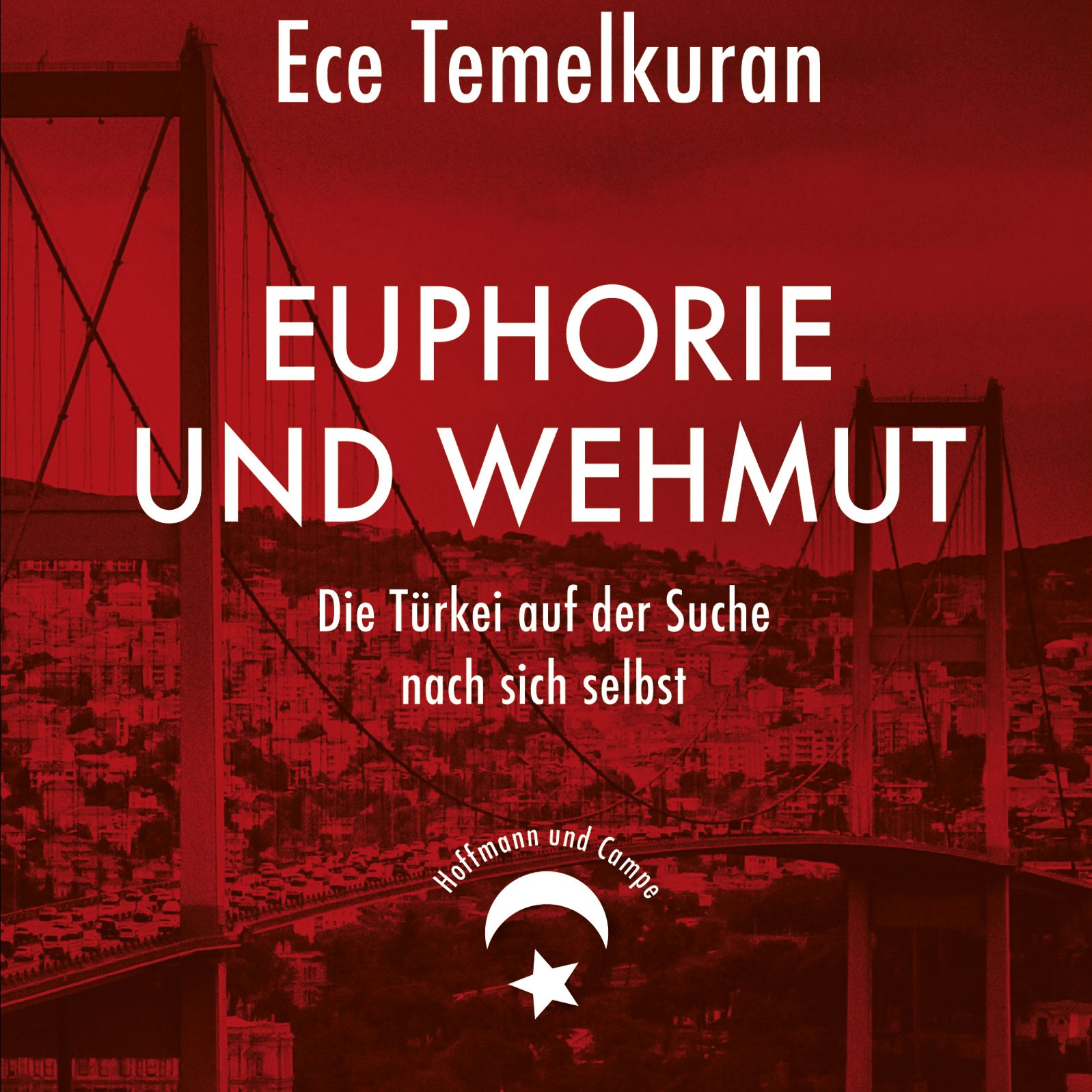
Ece Temelkuran beschreibt in „Euphorie und Wehmut“ einen Untergang der Wirklichkeit in staatsmärchenhaften Darstellungen.
mehr
Auch Zakes Mda hat eine US-amerikanische Anschrift. Er zählt zum südafrikanischen Aktivistenadel, der im Kampf gegen die Apartheid ...
mehr
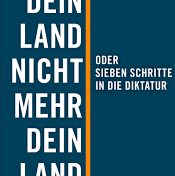
Ece Temelkuran beschreibt Bedingungen, in der eine Demokratie verdirbt.
mehr

Mit einem hochpolitischen Vortrag eröffnete der diesjährige Headliner Ben Okri das African Book Festival 2019.
mehr

Während Serpell in der Migration den Ausgangspunkt ihres Schreibens entdeckt, behauptet Nyathi als Achtjährige aus eigenem Antrieb die Produktion ...
mehr
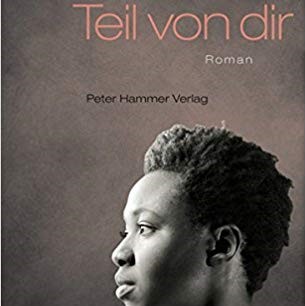
Die Nigerianerin Deola ist 39 und hat viel erreicht. Sie arbeitet in London als Wirtschaftsprüferin internationaler Hilfsorganisationen ...
mehr
Don't know what to read next? Have three experts on literary landscapes inspire you with books that inspired them to ...
mehr
La Bruja ist eine kaum übermenschlich vor den Reduktionen des Alters gefeite Hexe, insofern sie mit vierzig so aussieht als sei sie längst sechzig, und ihr Gedächtnis sie ordinär im Stich lässt.
mehr
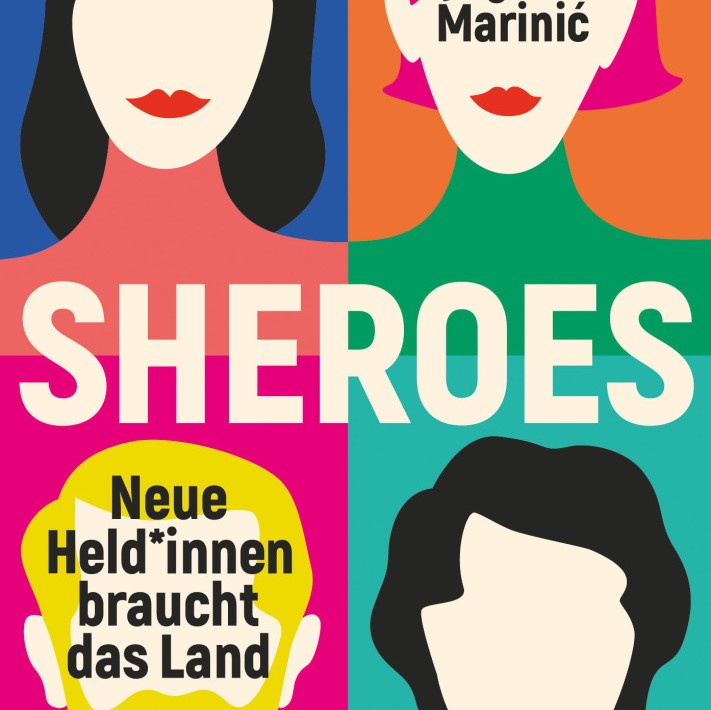
In „Sheroes – neue Held*innen braucht das Land“ verlangt Marinić eine Radikalisierung der deutschen Frauenbewegung.
mehr
In einer Sklavenhaltergesellschaft ohne Sklaven dienten Besatzungskinder dem unnachgiebigen Mahlwerk der Verachtung.
mehr
In ihrem Arrest fertigt die Beobachterin „to-do-listen der Ohnmacht“ an. Sie sucht da „nach alltäglichen beweisen moralischer insolvenz“.
mehr

Jamal Tuschick liest am Donnerstag, den 4. April um 20.00 Uhr aus seinem Roman: Der Maschinenraum des Universums.
mehr
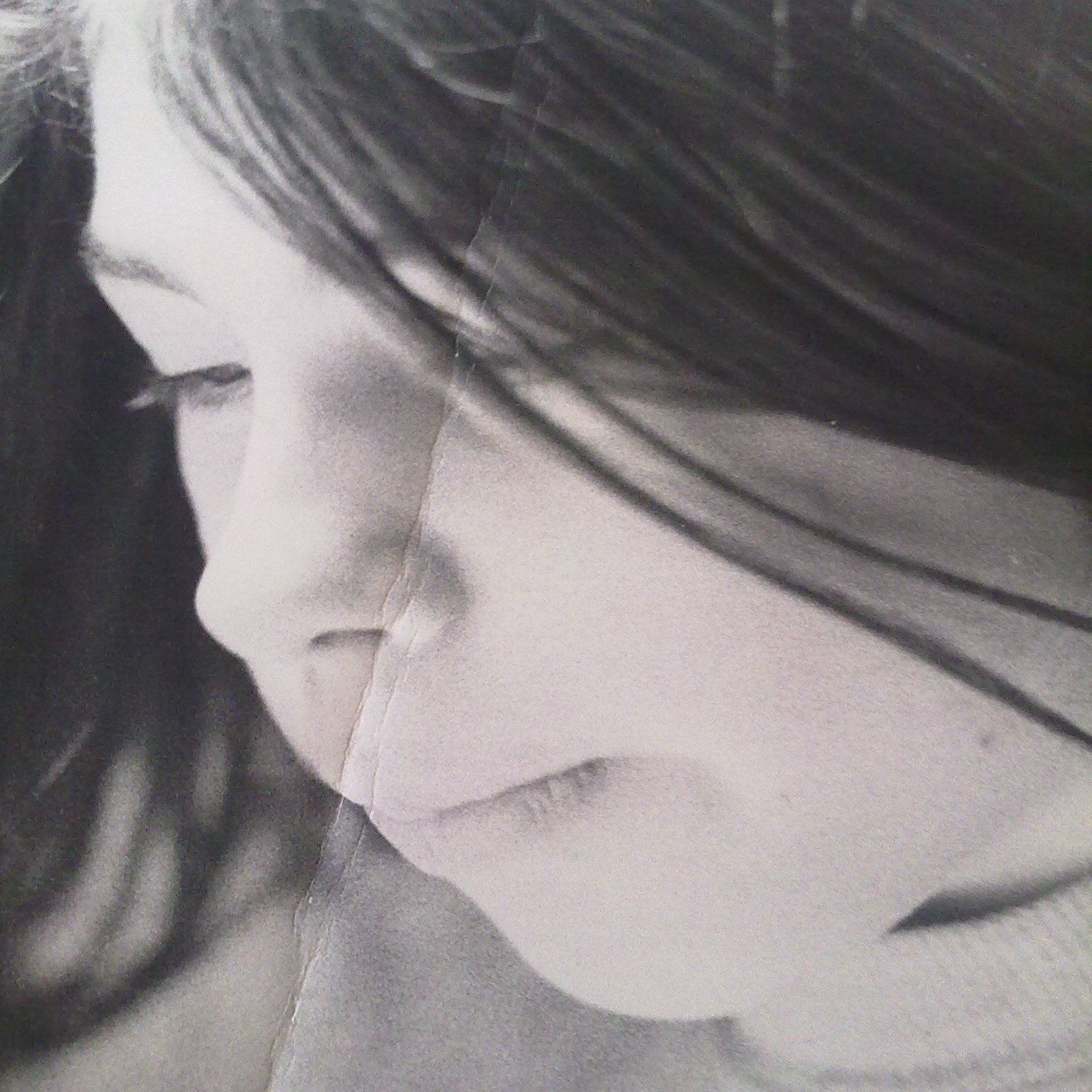
Ich habe vergessen zu sagen, dass Gerda bei den Tennessee Rattlesnakes die Wäscheruffel spielte.
mehr
Jahrzehnte ist die Tochter einer russischen Zwangsarbeiterin, die ihren Vater nie gesehen hat, landfahrerisch unterwegs, eine Nomadin des Unheils …
mehr

Angeregt von einer Dokumentation, vergleicht er die Karrieren von Otto Schily, Hans-Christian Ströbele und Horst Mahler …
mehr
Die Bereitschaft, in wertlosen Zeichen Auszeichnungen zu erkennen, kommt aus der Gewohnheit, Ehrenkränze …
mehr

Kaddor beschwört ihre Kindheit in einer Hochburg des westfälischen Münsterlandes als glücklichen Auftakt. Ihr Vater kam 1975 aus Damaskus …
mehr

Der Kapitalismus wird von der Romantik für das gehasst, was er am erfolgreichsten betreibt … die Bändigung des Trieblebens (in einer Abkehr) von der Ehre.
mehr

Tille wollte Nutella und kriegte Verständnis.
mehr

Für Montaigne ist alle Größe Projektion, schreibt Ruch. Montaigne bewegt sich bereits auf dem postheroischen Grat, den Shakespeare und Machiavelli ...
mehr
Martin verabschiedete sich aus dem Kreis jener, die Rimbaud verehrten und dessen abenteuerlichen Lebensweg ...
mehr
Seine Trainer heißen Vergil und Dante. Von den alten Meistern lernt Liborio, was auf der Straße nicht gelehrt wird.
mehr
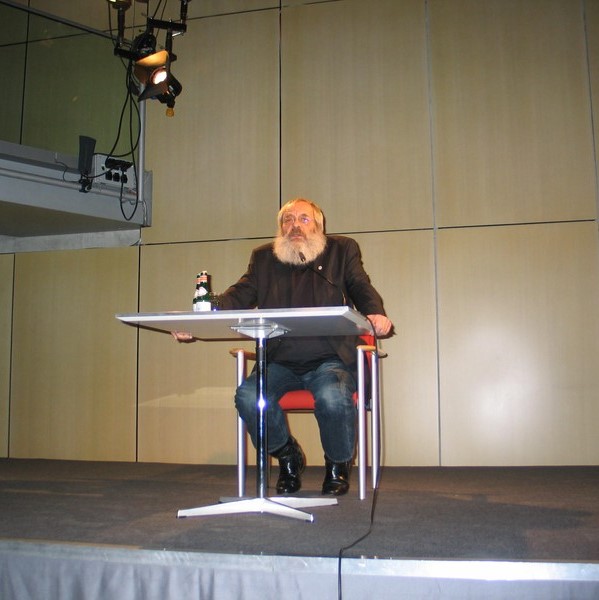
Die Propheten kreierten die nächste Generation des bodenständigen Mittelstandes.
mehr
In der Dokumentation „Am Rande Europas „beschreiben Geflüchtete die Konsequenzen des EU-Türkei-Abkommens ...
mehr
„Ich bin in Deutschland geboren. Mir reicht das, um von hier zu sein.“
mehr

Der Nationalsozialismus war eine Anhaftung der bundesrepublikanischen Demokratie.
mehr

Im (zwanghaften) Streben nach Verbesserung interessierte Iris eine bessere Handhabung der Fetische Jugend und ...
mehr

An den Rändern des Politischen trennen ethnische, soziale und geografische Demarkationslinien die „Anteillosen“ von der Mitte.
mehr

Die IOM diente der systematischen Drosselung der Auswanderungsbereitschaft ...
mehr
Eribon zeigt, dass Literatur jenseits ihres angestammten Platzes in der Wissenschaft lohnende Forschungsfelder bietet.
mehr

Margot wollte die neue Energie (den ökologischen und direktdemokratischen Spirit) in der SPD zu halten. Ihre Bemühungen erinnerten an Handballtorwartparaden.
mehr

Rudi Arndt und Holger Börner verkörperten den sozialdemokratischen Stil der Betonfraktion.
mehr
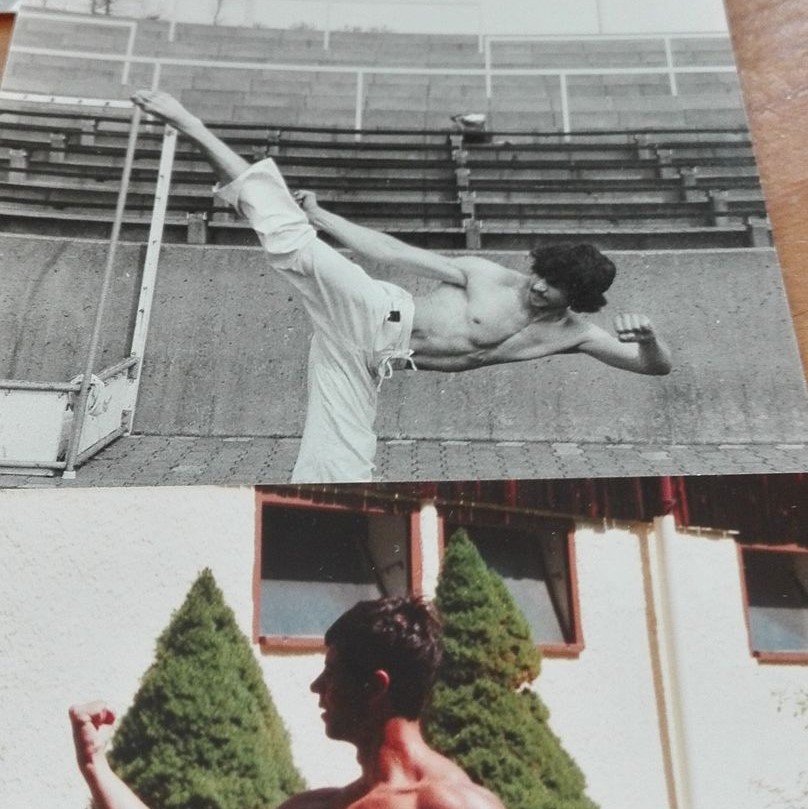
Mein Vater war gegen den NATO-Doppelbeschluss, konnte aber mit der Friedensbewegung ästhetisch nichts anfangen.
mehr
Mit der Wucht eines Wirbelsturms schreibt Fernanda Melchor über die viel zu alltägliche Gewalt gegen Frauen.
mehr

1978 zog die Besatzung eines deutschen Frachters vierhundertfünfzig Vietnamesen aus dem Südchinesischen Meer.
mehr


Die Zukunft meiner Eltern hieß Windsurfen. Die Vitalen des SPD-Ortsvereins, dem mein Vater lange vorgestanden hatte ...
mehr
„Warum wie jeder Depp zwischen vier Betonwänden leben?“
mehr
Erst 1976 inszeniert Fritz Marquardt „Die Umsiedlerin“ als Mumienschanz unter dem Titel „Die Bauern“ an der ...
mehr
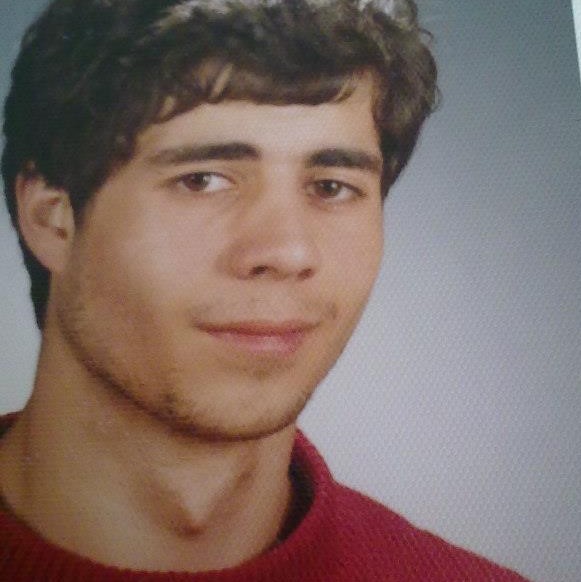
Egon Bahr war ein Schattenmann im kalten Krieg - der Garant für die Unantastbarkeit seines Chefs Willy Brandt ...
mehr

Willy Brandt behauptete am Ende seines Lebens, bloß Egon Bahr zum Freund gehabt zu haben.
mehr
Holger Müller verband Stalin mit Schmidt. Er predigte „Kein Mensch, kein Problem“ (J. Stalin) und „Mein Herz gehört dem Kopf“ (A. Schmidt).
mehr

Gerade fällt mir ein, wie oft gesagt wurde, dein Vater ist mit der SPD verheiratet.
mehr
Der Historiker Niall Ferguson datiert den letzten Weltwandel auf das Jahr 1979. Frank Bösch findet viele Gewährsleute für ...
mehr
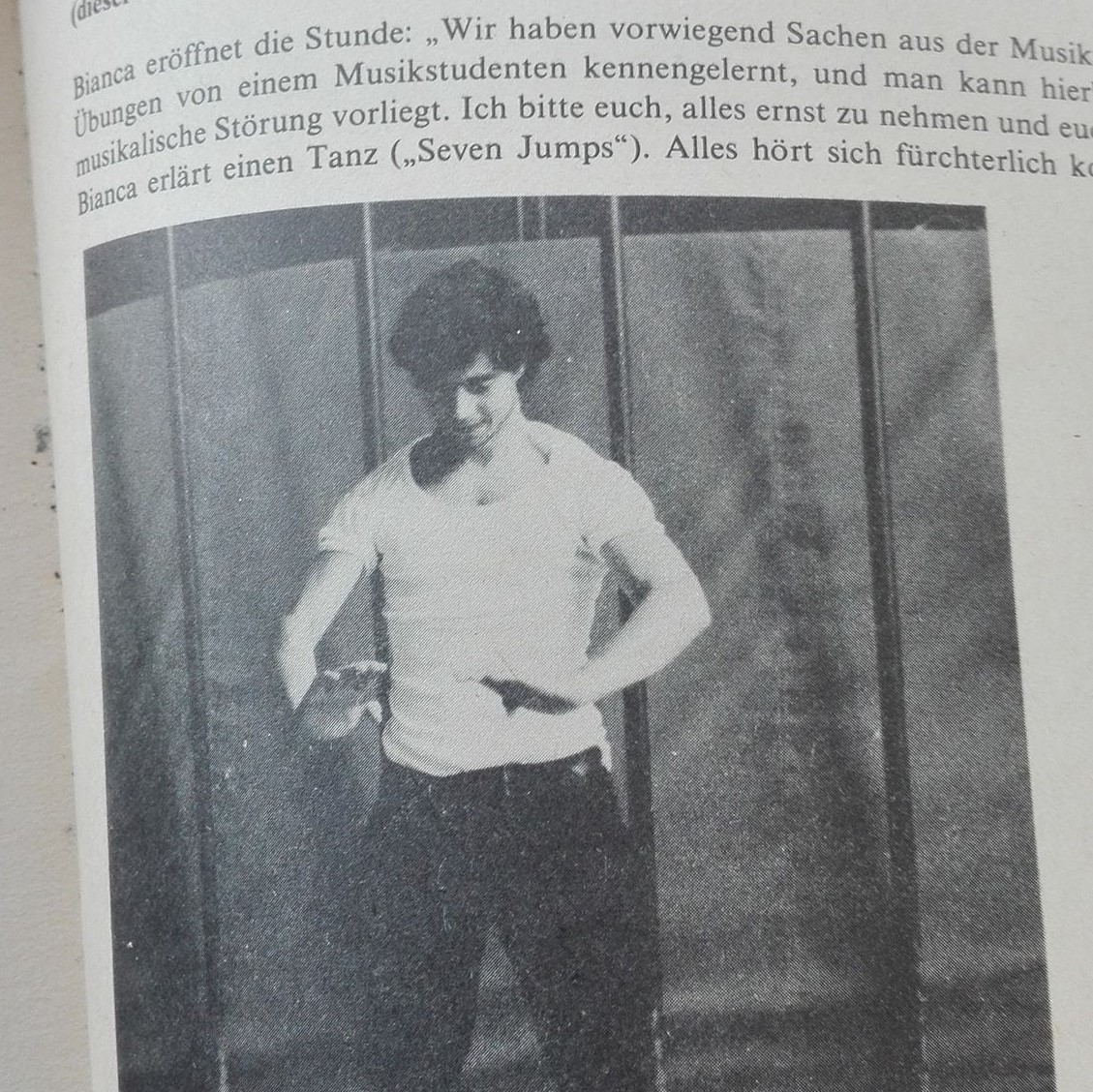
Auch „Draußen vor der Tür“ diente der Verdrängung. Das Stück hatte eine Ventilfunktion. Es wirkte katalysierend.
mehr
Onkels Sprecharie zieht die Matrosen aus dem Meer der Möglichkeiten ins Klein-Paris.
mehr

Lothar Trolle sagt: „Man hat Adressaten. Wenn man die eines Tages nicht mehr spürt, wird es ...
mehr
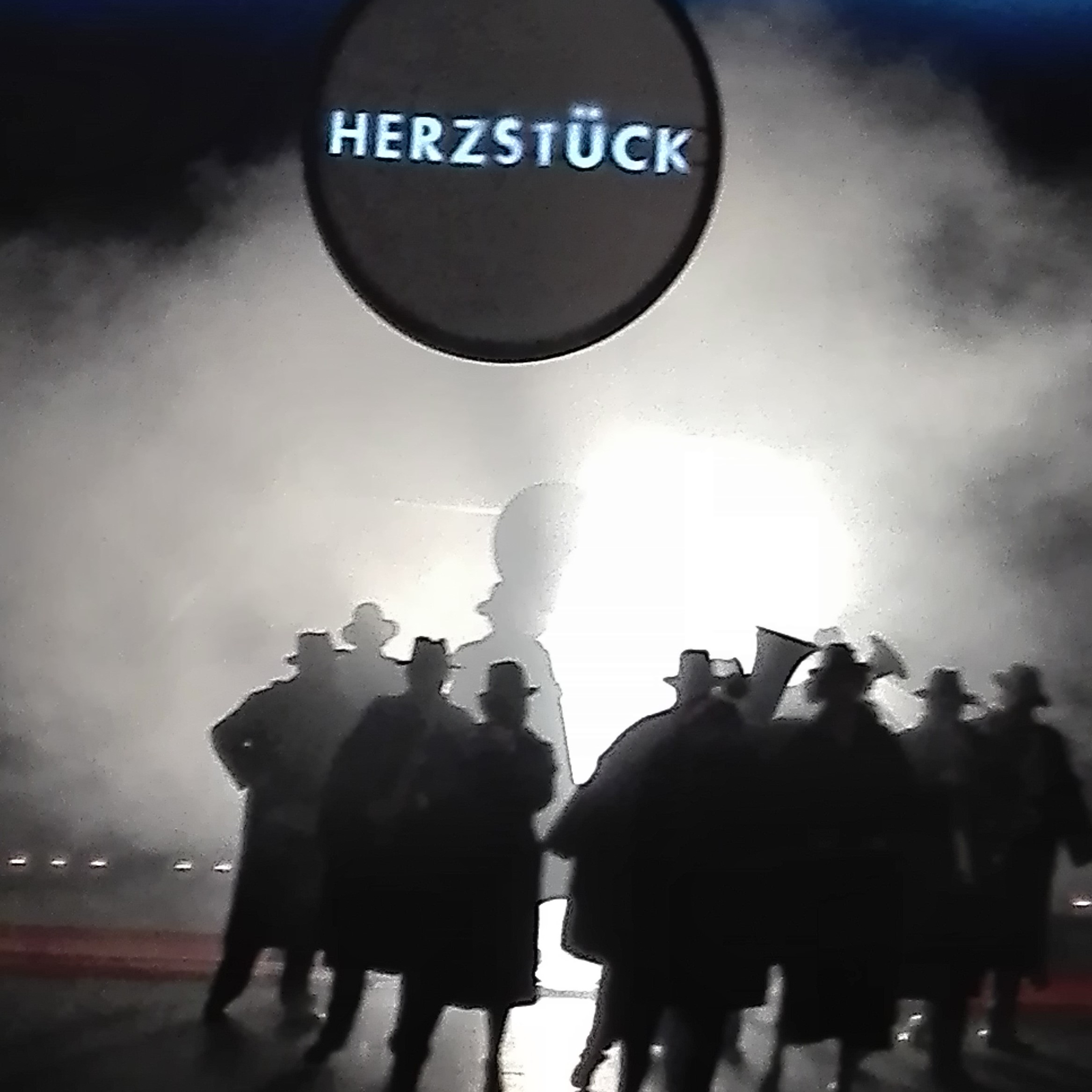
„Das Wesentliche im Universum ist nicht das Organische, sondern die Information“. Heiner Müller
mehr

Alle Jungsozialisten steckten in Second-best Konstellationen, während die Jungsozialistinnen ...
mehr

Günter Grass war die zentrale Figur des sozialdemokratischen Glasperlenspiels. Er saß bis in alle Ewigkeit mit Willy ...
mehr
Auf dem Umweg einer Liebeserklärung an ihre Großmutter gelangte Katja zu den verlorenen Ostgebieten ...
mehr


„Willst du nicht mein Baader sein, lad ich mir nen anderen ein.“
mehr

In meiner sozialdemokratischen Jugend unterschied man zwei Typen. Klare-Kante-Kleingärtner, die in allen Verfassungen ...
mehr

In der linken SPD gab es unterstützende Verbindungen zu den Spontis und RAF-Derivaten. Von der rechten SPD wurden ...
mehr
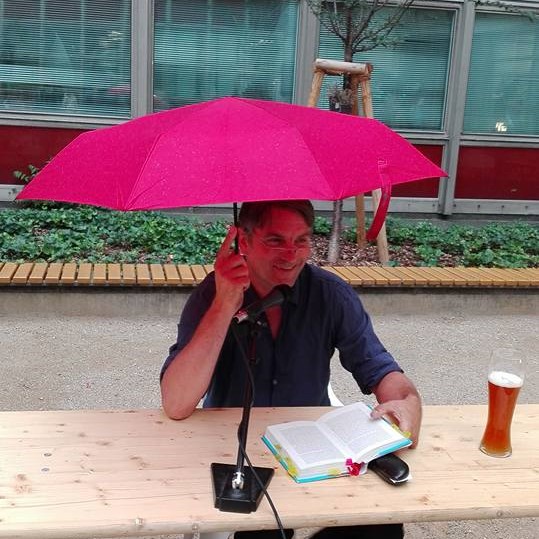
„Frau und Arbeiter haben gemein, Unterdrückte zu sein.“
mehr
Heidi riet zur SPD. Die Schweizerin antizipierte den temporären Niedergang der deutschen Volkspartei und den Aufstieg ...
mehr

Eines Tages tauchte Peter zum ersten Mal mit Kerstin in einer Ortsvereinssitzung auf. Zehn Jahre nach Willi Brandts ...
mehr
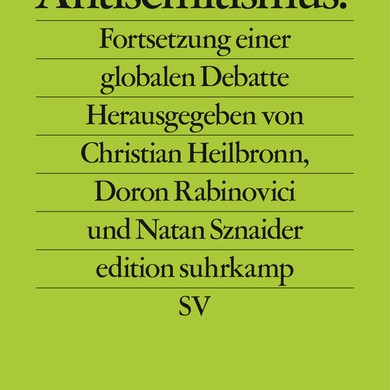
Wo liegt die Grenze zwischen legitimer Kritik an Israel und Antisemitismus?
mehr

Die Kohorten der Außerparlamentarischen Opposition rannten, nicht müde werdend, gegen die Bollwerke des Staates an.
mehr
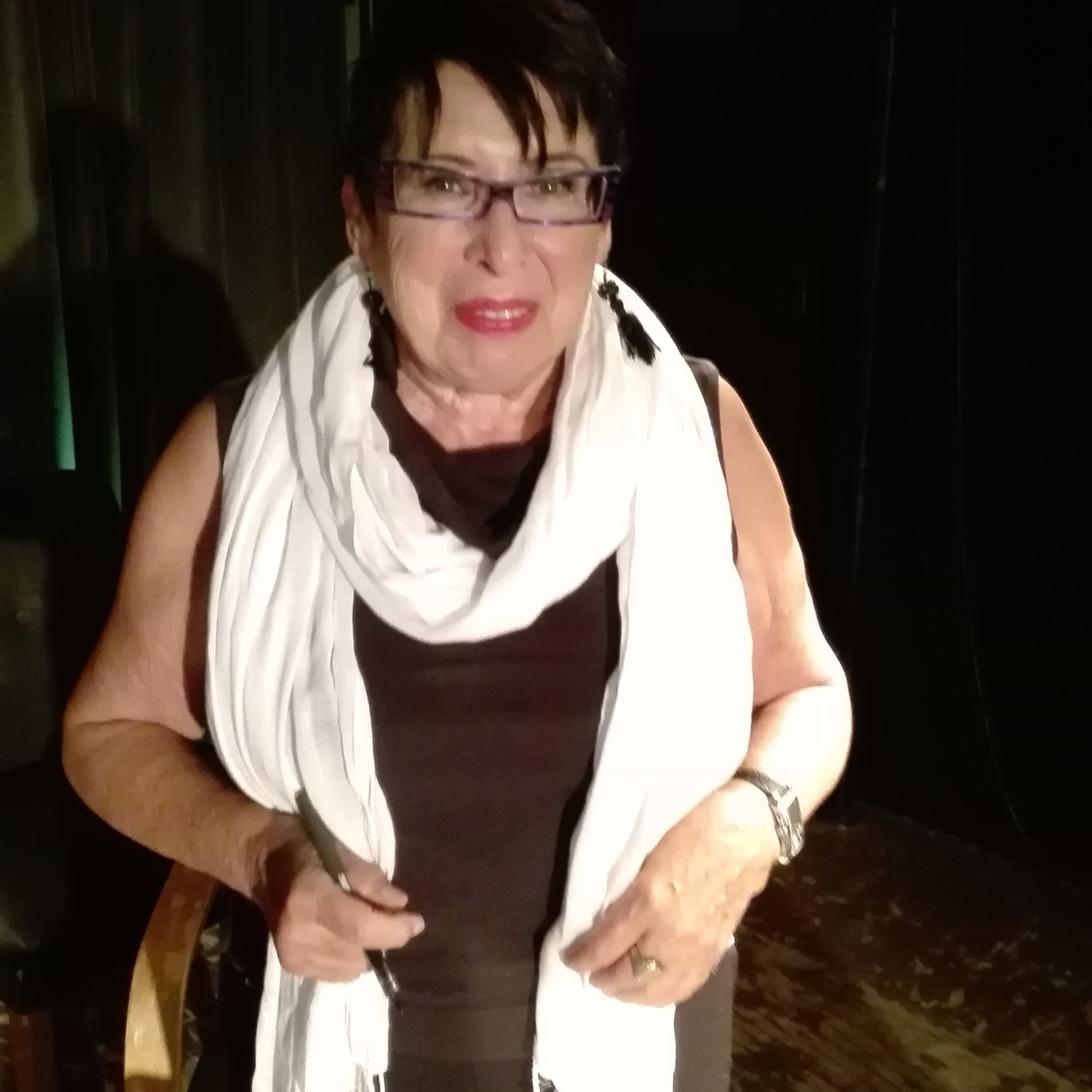
Nur eine schwindsüchtige Sonne stand am Himmel und kämpfte darum, die Eiszapfen zum Weinen zu bringen ...
mehr
Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer war entführt worden so wie die Lufthansamaschine Landshut.
mehr

Der erste Mensch mit Migrationshintergrund im sozialdemokratischen Alltag war kein Chilene, der Allende …
mehr

Etablierte reagieren auf aufsteigende Außenseiter mit der Preisgabe der eigenen Moralstandards an gröbere Formate.
mehr

Die SPD war die Partei der Industriegesellschaft und die Industriegesellschaft war am Ende.
mehr
Shafak analysiert in ihrem Werk eine Türkei, die nicht mehr laizistisch ist. Sie beschreibt Paradoxien einer konservativen Revolution.
mehr
Dem Visionär Brandt war Schmidt im Stil eines VW-Aufsichtsratsgenossen gefolgt. Er feierte die Sachlichkeit ...
mehr

Hiam Abbass ist ein Feuer und eine Welt - israelisch und arabisch.
mehr

Die SPD meiner Kindheit war ein Relikt aus der Zeit vor dem Godesberger Programm. Sie bestand noch aus Arbeitern.
mehr

Robert Walser (1878 - 1956) war seinem Wesen nach ein Alimentierter. Die Geschwister halfen dem Bruder ...
mehr
Vollmann registriert die Begleiterscheinungen von Armut. Er rechnet dazu Krankheiten, Un- und Überfälle.
mehr
In einem Jurtenrondo mit Tee und mongolisch-traditionellem Trallala wird Hedi von der Oma über den Grad der ...
mehr

Eine neue Heimat der osteuropäischen Nomaden sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Emine sitzt in der U2 und ...
mehr

Thaïs rutschte wie Korn durch den Trichter einer absurden Unvermeidlichkeit dem Schicksalsmahlwerk entgegen.
mehr

Thaïs war ein linksradikaler Snob, eine Edelkommunistin mit einem Kühlschrank nur für ihre Kosmetik.
mehr
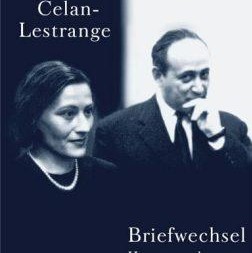
Gisèle, Tochter aus gutem Haus, ist von dem Dichter, der sich als Lehrer an der Ecole Supérieur erhält, bis zur ...
mehr

Aris ist Grieche nach seinem Geburtsland, Deutscher nach seiner Sozialisation und außerdem das Produkt ...
mehr


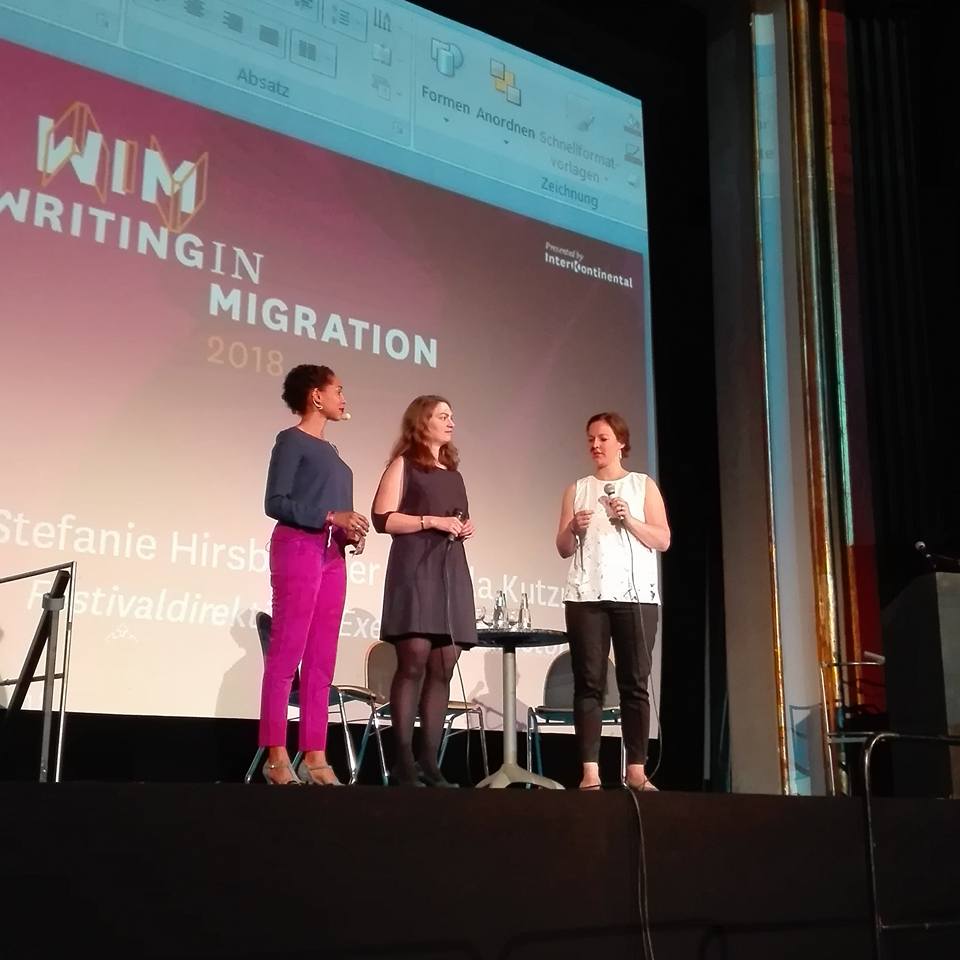
Klassiker wie "Alles zerfällt" von Chinua Achebe und "Dekolonisierung des Denkens" von Ngũgĩ wa Thiong’o ...
mehr

Als Lyrikerin arbeitet man gegen die Zeit.
mehr
Ein Mensch kann überall zustandkommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals.
mehr
„Der Kolonialismus ist Gewalt in ihrem natürlichen Zustand, und er wird nur nachgeben, wenn man ihm ...
mehr

It is not underdevelopment, it is exploitation that plagues Africa.
mehr
Der Rechtsruck kommt aus Rückzugs- und Bewahrungsphantasien und da, wo ihm vorausgedacht wird ...
mehr
„Die meisten Deutschen vermissten nach 1945 ihre deportierten Nachbarn nicht.“
mehr
Können Selbstrepräsentationen Schwarzer Männlichkeiten Räume der Heilung für Schwarze Männer öffnen?
mehr
Era, ein großer Madonna-Fan, lebt mit ihren Eltern in Prishtina, der Hauptstadt des Kosovo ...
mehr

Mein Großvater kam aus dem Nichts absoluter Wohlfahrtsferne.
mehr

„Anstatt zu fragen, was Integration ist, wird vorausgesetzt, dass dieses undefinierte, unklare Konzept ...
mehr
Sie wird täglich beschimpft und bedroht von Leuten, die sie nicht in Deutschland haben wollen.
mehr

Es sind die Elendsverweigerer, die den Druck an Europas Schmerzgrenzen aufbauen.
mehr

Gangbang ist kein Problem, aber man darf kein Eis essen gehen mit der Affäre.
mehr
Max Czollek beschwört das schillernde Potential von Ironie und Rache.
mehr
Die Braut ist heiß auf die Gene der anderen. Sie frisst ihre Liebhaber und trinkt ihr Blut.
mehr

Irgendwas mit Migration und Medien. Hanna macht in Hanau irgendwas mit …
mehr
Das heutige Berlin ist für Menschen aus unterschiedlichsten Ländern ein sicherer Hafen – unter ihnen viele ...
mehr

Die Kurdin war nicht mehr als eine Theatererscheinung, die Istanbul Türkisch sprach.
mehr
„Das zurückgelassene Kind entwickelt Schuldgefühle“, erklärt Gülcin Wilhelm.
mehr

Sie werden ihn heute Abend in der „Drehscheibe“ oder gleich in ihren beheizbaren Nasszellen und maroden Elternhäusern herabsetzen und sich über den Kanaken erheben.
mehr

Ich reagierte auf die zurückhaltende Performance einer Bosnierin oder Tochter von Bosniern mit deutscher Staatsangehörigkeit – passdeutsch, gefühlsbosnisch.
mehr
Mein Bruder Levan war aus dem vollen Lauf der Jugend mit Anfang Zwanzig schlagartig zu einem alten kranken Mann geworden. Er übertraf unseren Vater an Erbärmlichkeit.
mehr
Fast zweihundert Jahre haben sich die Vanilisis in einer türkischen Provinz gefunden und sind da gestorben, nachdem sie ihren Teil ...
mehr
Großvater fischte aus der nächsten Migrantenwelle Vietnamesen und die ersten Spätaussiedler, deren Nachkommen heute den Belegschaftsstamm bilden.
mehr
Von da an belieferten wir einen Betrieb in der Oberschlesischen Industrieregion (polnisch Górnośląski Okręg Przemysłowy) mit thermoplastischem Kautschuk.
mehr

Alima hat in Syrien in einer Agentur für Animationsfilme gearbeitet und ist gemeinsam mit ihrem Mann im Maschinenraum der Fabrik gelandet.
mehr

Es gibt nichts Rechtes ohne Raunen und Runen. Die Wolfsangel als Giebelornament ist so ein Hinweis auf eine germanische Vergangenheitsimagination.
mehr

Ich habe nicht Fußball gespielt und nicht geboxt oder gerungen oder was Asiatisches gelernt so wie die anderen „Türken“.
mehr
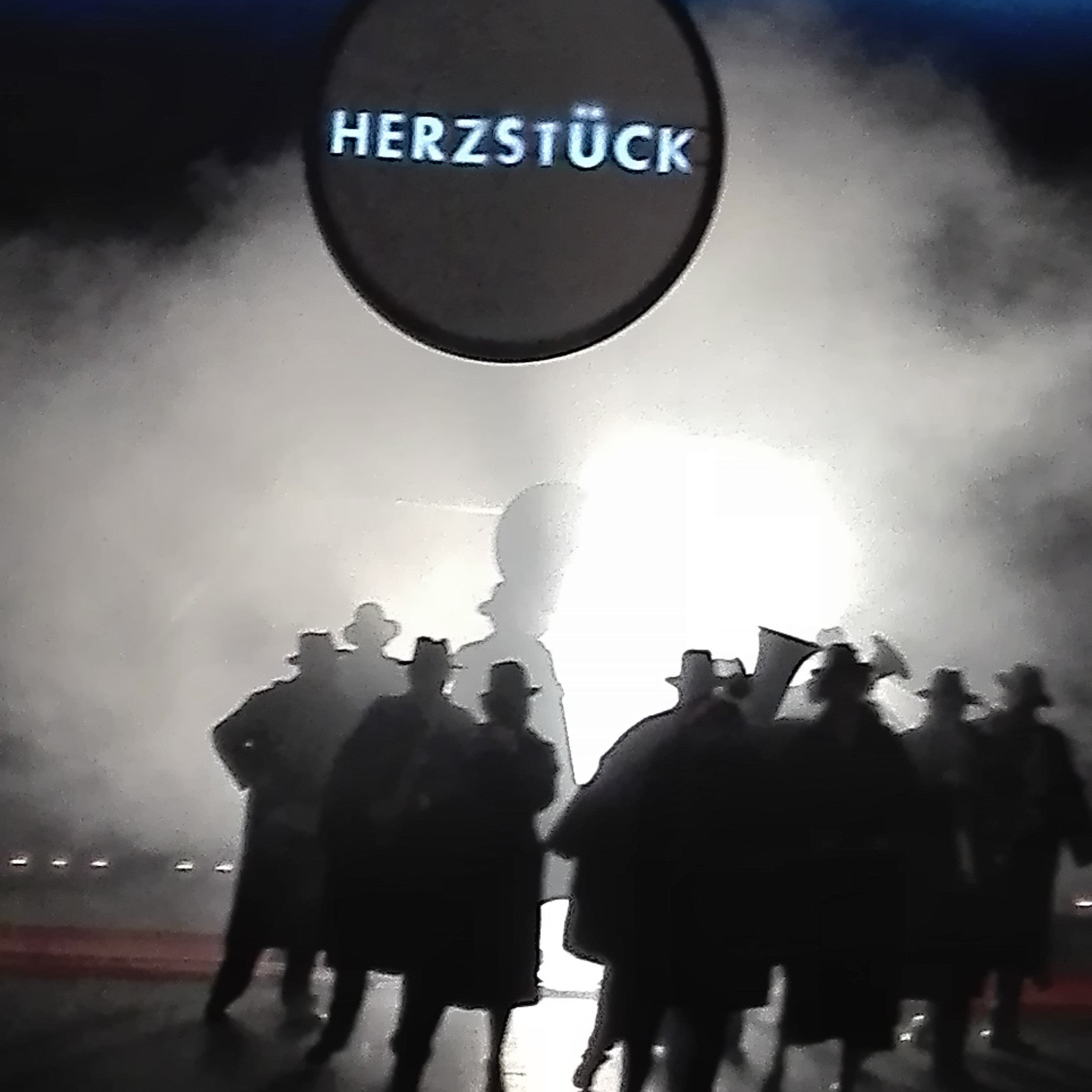
Michail war in der Sowjetunion mit titanischen Bauvorhaben befasst. Als Ingenieur und Spezialist für Katastrophenmanagement gab er sechzig Leuten Anweisungen.
mehr
Ich bin 1988 in Fulda geboren und in Finkenherd aufgewachsen. Trotzdem war ich der erste „Türke“ in Finkenherds einzigem Tennisclub.
mehr

Mir fällt nur ein Roman ein, der eine Unterschicht nach der Jahrtausendwende beschreibt, ohne die Lust am scheinbar Authentischen zu befriedigen.
mehr
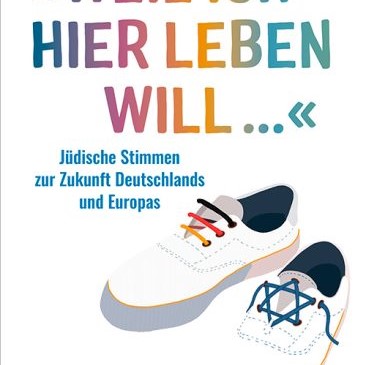
„Der Kampf gegen Antisemitismus (ist kein) Kampf für andere, sondern der Kampf um eine Gesellschaft, in der ich gern leben will.“ Klaus Lederer
mehr

Das Versenden und Empfangen von Nachrichten begreift er als Berufstätigkeit. Ich sehe ihn bei Uslar & Rai, Edgar Rai war mit dem Star bis eben in Frankfurt auf der Messe ...
mehr

Wir sind uns zum ersten Mal auf einer Multi-Level-Marketing-Gala begegnet. Morgan stellte sich als Spezialist für Telefonakquise …
mehr
Wir erleben eine Kulturrevolution, deren Schockwellen längst einen Tsunami der Veränderungen in Gang gesetzt haben. #MeToo hat mehr Männer von der Macht getrennt ...
mehr

Der Israeli Tomer Gardi hat sich dafür entschieden, ein Buch auf Deutsch zu schreiben, im vollen Bewusstsein, dass sein Deutsch sich von dem eines Muttersprachlers unterscheidet.
mehr

Das Etikett Gastarbeiterliteratur hat man Texten aufgeklebt, die wir als authentischen Versuch der Beschreibung einer Lebenswelt wahrgenommen haben …
mehr
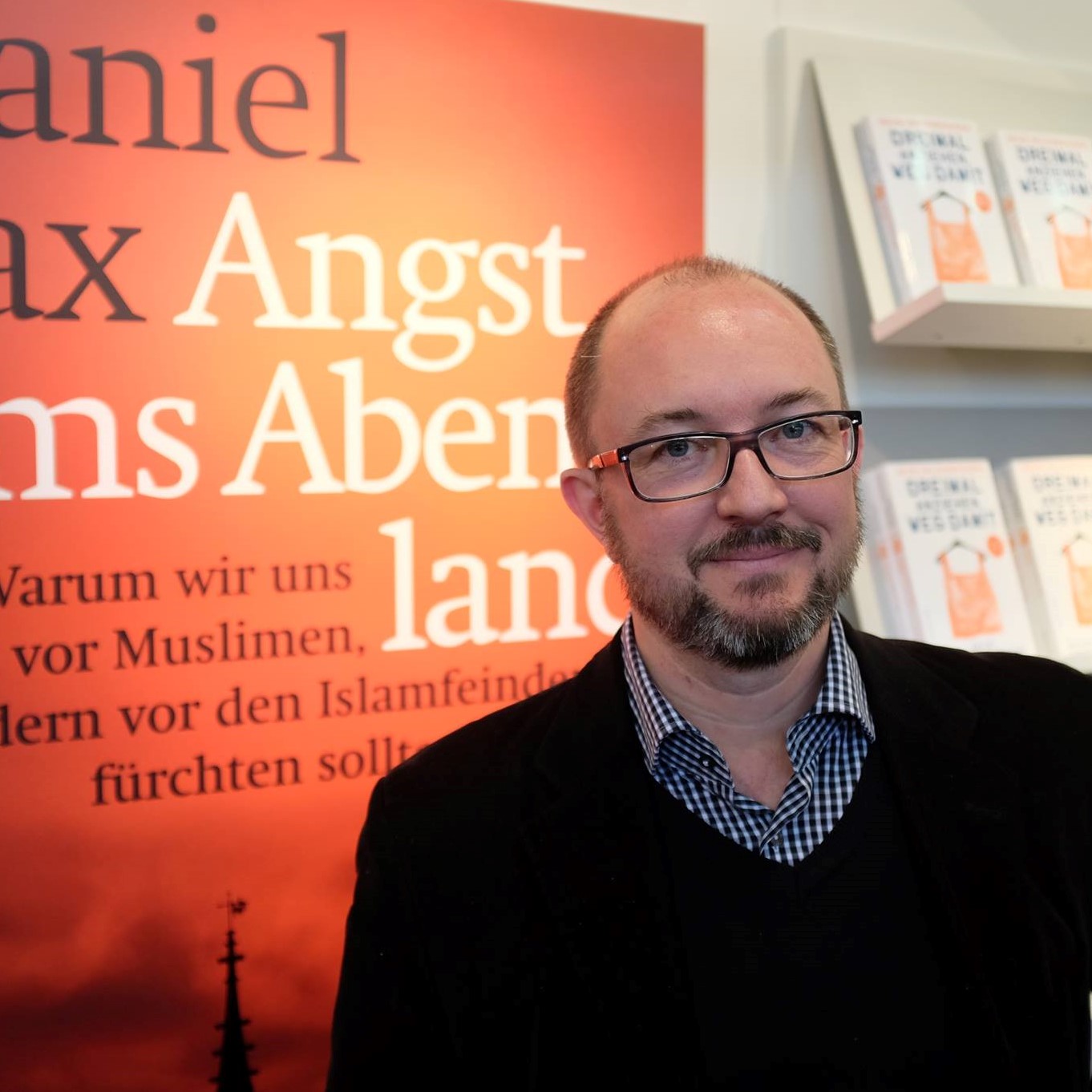
Als wirtschaftsstarkes Land in der Mitte Europas, aber mit einer alternden Bevölkerung, ist Deutschland auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen.
mehr
Der Unternehmer Amiran Vanilisi beschäftigt fast ausschließlich Migranten in seiner Fabrik für Schuhbodenteile.
mehr

Die Walter Benjamin Generation mit ihren säkularisierten Über- und Gründervätern, die vielleicht wirklich eine jüdisch-christliches Abendland vor Augen hatten …
mehr
Die Demonstration beginnt am Alexanderplatz. Ich komme aus dem U-Bahnschacht und kann nicht erkennen, wie viele Leute sich hinter mir formieren.
mehr
Für die Leute hier sind wir Türken, obwohl es keine ethnische Verbindung zwischen meinem Volk und den Türken gibt. Wir sind Lasen …
mehr
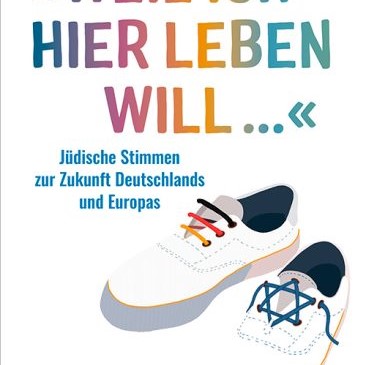
Die jüdische Gemeinschaft steht heute vor vielen Herausforderungen: von außen bedroht sie Antisemitismus …
mehr
Die Migration ist eine kolossale Projektionsfläche für negative Entladungswünsche aus der Mehrheitsgesellschaft.
mehr

Lieber Herr Tuschick,
vielen Dank für Ihren Beitrag, wir waren alle sehr bewegt und berührt.
mehr
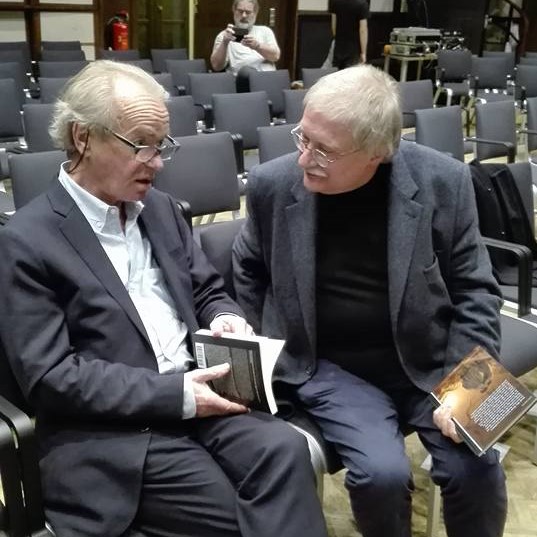
Mich hat Joyce leider vor „Finnigans Wake“ stehenlassen. Ich wäre gern mitgegangen in die narrativen Klangräume, die, so Amis, „aus der dümmsten Art, lustig zu sein“, gemacht sind.
mehr

Seit 1992 veröffentlichte Kertész seine Tagebücher. Sie dokumentierten, so sagte es Esterházy, „wie Hoffnung aus lauter Hoffnungslosigkeit entsteht“.
mehr
Plötzlich verdunkelt sich die Szene. Stromausfall. Der tüchtige Paco organisiert einen Generator, das Licht geht wieder an und die Party geht weiter.
mehr
Sein Gesicht hält dem erdgeschichtlichen Budenzauber stand, der in dem frühen Spätwestern „One Eyed Jack“ („Der Besessene“) 1961 als Kulisse herangezogen wurde.
mehr
Es ist ihr Jahr der Preise – Alida Bremer wurde gestern mit dem Brücke Berlin Theaterpreis geehrt.
mehr

Lange Zeit geschah nichts von Belang. Man aß und unterhielt sich kaum.
mehr
Als Präsidentin des Vereinigten Universums habe ich endlich die Erwerbslosigkeit modernisiert.
mehr

Als Navid Kermani zum ersten Mal in Kairo war, fand er da mehr Beispiele für individuelle Freiheit aka sexuelle Selbstbestimmung als in seiner Geburtsstadt Siegen.
mehr
Wir erleben eine antisemitische Revolution. Die Kombattanten erscheinen wie Spukgestalten in der Geisterbahn.
mehr
In der ZEIT hieß es gestern: Feminismus muss wütend und breitbeinig auftreten. Man soll eine Bitch im positiven Sinne sein.
mehr
Es gab keinen mehr, mit dem sie das Grauen teilen konnte. Hayat war eine Fremde im eigenen Land geworden.
mehr
Hausherr in der Ev. Akademie und Gastgeber Christian Kaufmann sprach vom Verblöden einer Nation im Integrationstheater.
mehr

„Es gibt zwei Lager von Schriftstellern: Jene, die sich ihre Konflikte in der Tagesschau aussuchen …
mehr
Da gab es diese Preisverleihung. Der Laudator vergriff sich im Register und machte einen Text nieder, für den Daniela Dröscher gerade geehrt wurde.
mehr
Lange war Integration, unabhängig von den Voraussetzungen, der staatlich festgelegte Preis der Migration. Das war und bleibt absurd in einer Gesellschaft …
mehr
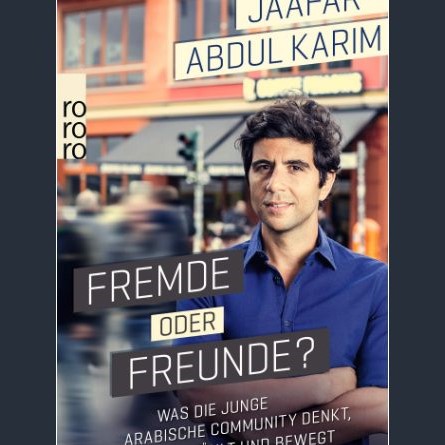
Der Autor porträtiert Frauen, die sich ihrer Fesseln entledigen und die Werkzeuge der Befreiung in Facebook Gemeinschaften austauschen.
mehr
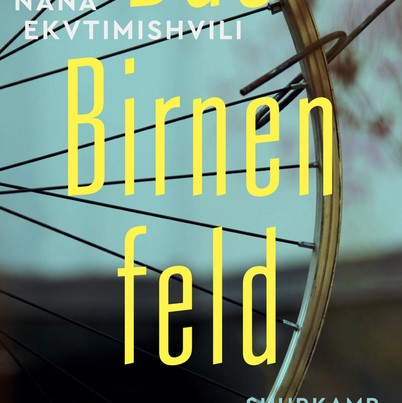
Ekvtimishvilis Sprache entbindet jenes Grauen, das wir mit geschlossenen Anstalten assoziieren. Sie erzählt von Gewalt ...
mehr
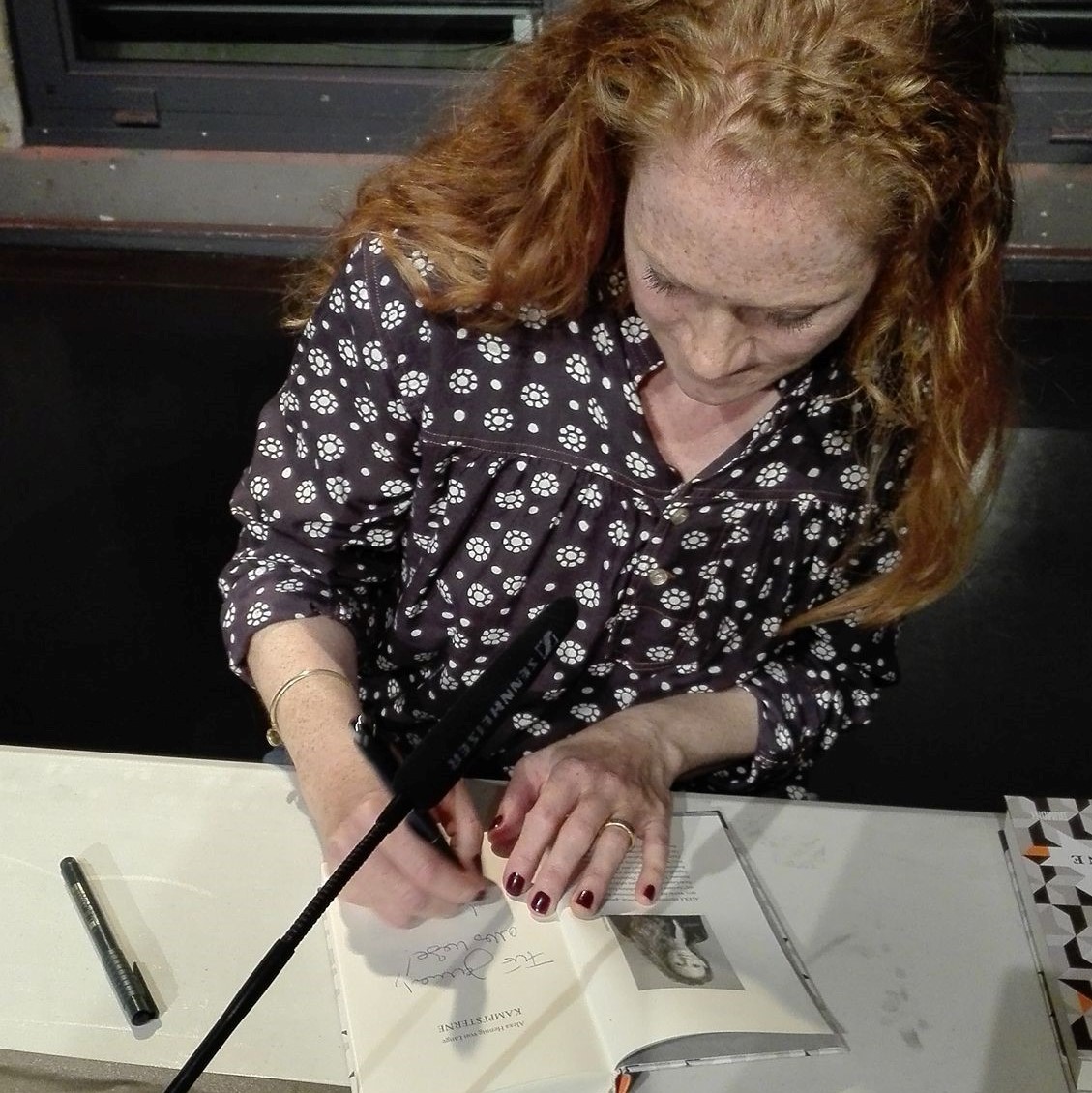
Die Mobilmachung für den Geschlechterkampf begann im Kindergarten. Im Jahr der Kampfsterne war sie zwölf und von einer feministischen Mutter aktivistisch eingenordet.
mehr

Metwo ist ein Weg, Erfahrungen sichtbar zu machen, die sonst in den Medien nicht besprochen werden. Aber auf diesem Weg lauern eben die Ottos …
mehr
#unteilbar - Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung!
mehr

Bulucz' Poesie steckt Büchners Fatalismus der Geschichte in den Zeilen. Ich spreche über eine Fleißarbeit.
mehr

Sich zu diesem cioranesken Wahnsinn zu bekennen, heißt vielleicht, die Muttersprache abzulegen wie eine Staatsbürgerschaft …
mehr

Sie steht „am Laufband Richtung Kasse“, während im Abspann der Assoziationen überall auf der Welt Menschen auf Laufbändern an ihrer Selbstoptimierung feilend scheitern.
mehr
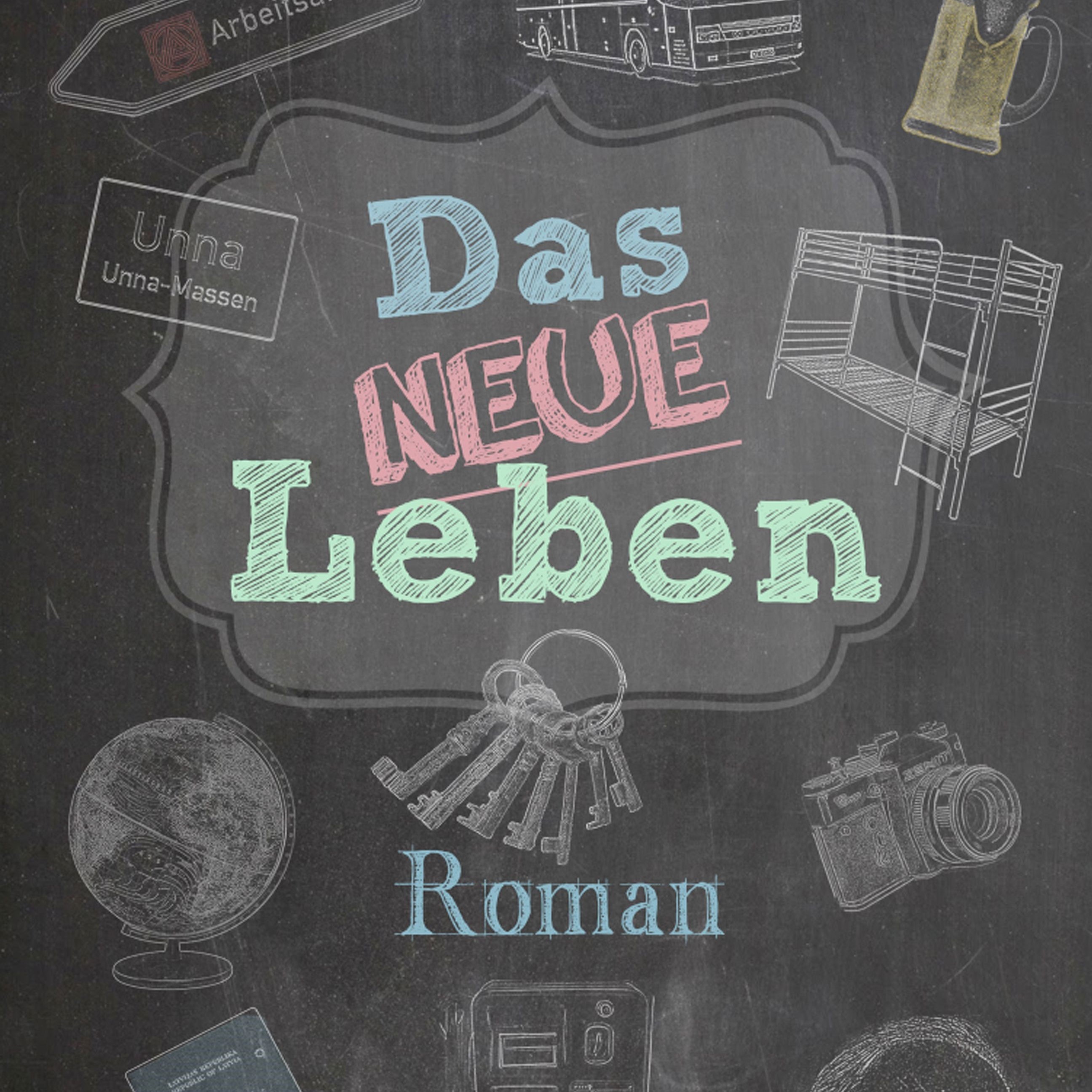
Das Lager hat allerhand zu bieten, zum Beispiel eine Telefonzelle, „von der … man kostenlos ins Ausland telefonieren kann“.
mehr
Meine Großmutter stöhnte und küsste die Dinge, die an Familie und Freunde verschenkt wurden, mein Vater dauergereizt, nein, das können wir nicht mitnehmen ...
mehr

Max Czollek, geboren 1987 in Berlin, versteht sich und seine Freund*innen als „Teil dieses Landes, auch wenn wir uns mit dem neuen deutschen Nationalstolz nicht identifizieren.
mehr
Da hieß es „Negerfahrzeug“ in einem Polizeivermerk. Da wurde bekannt, dass sich Polizeibeamte im Ku-Klux-Klan organisiert hatten.
mehr

Die Menschen haben die Neigung, sich im "Eigenen" wohl zu fühlen und das "Fremde" abzulehnen und zu verspotten.
mehr
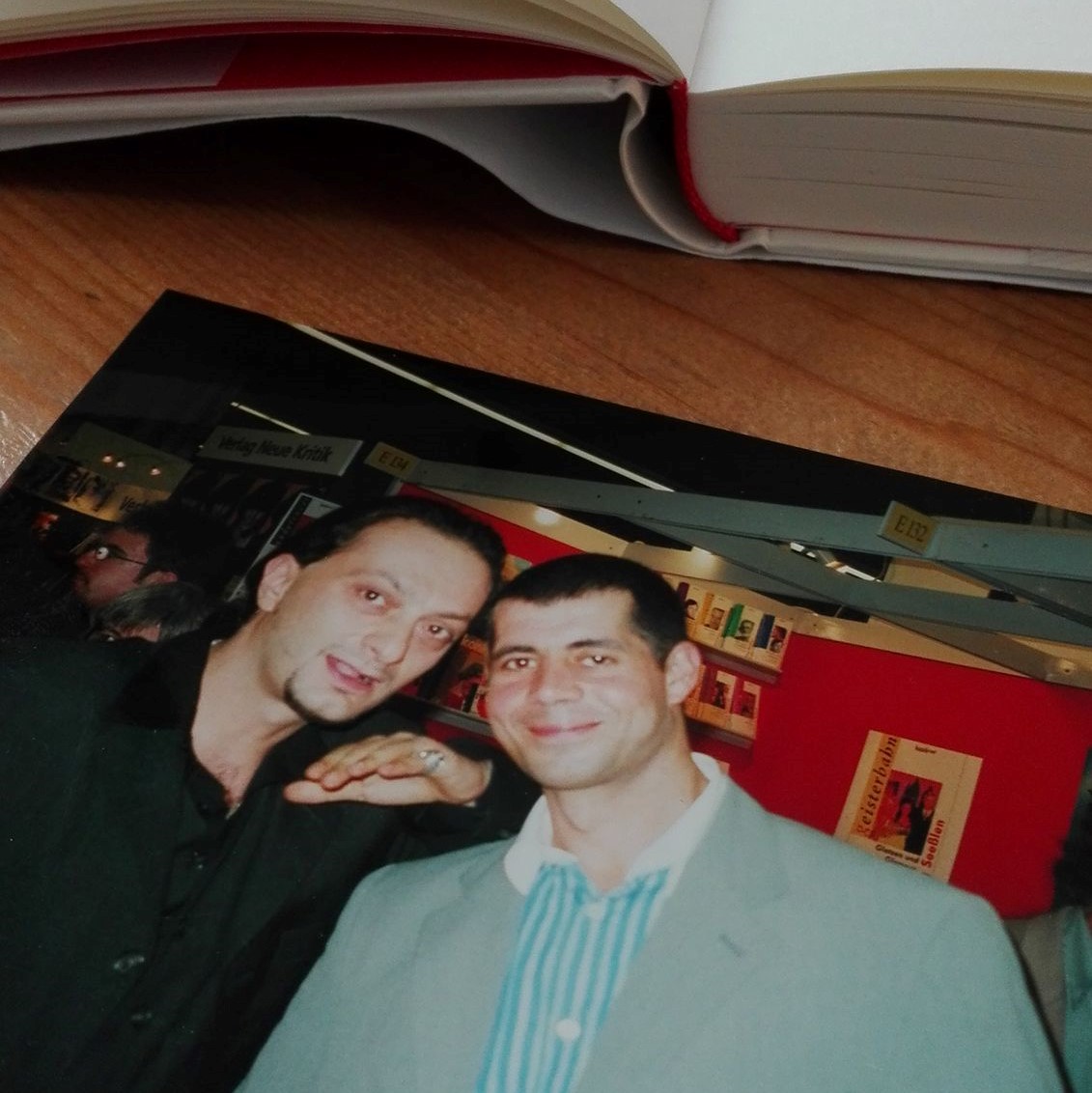
Zaimoglu begrüßte mich brüderlich, eine Szene, die sich bis zu zehn Mal an jedem Messetag wiederholte. Er wollte den Verlag wechseln.
mehr

LAUT DEM GLEICHSTELLUNGSGESETZ BEGINNT DISKRIMINIERUNG BEI
BENACHTEILIGUNG ...
mehr
Die Kritiker zweifelten an dem Schriftsteller Schmidt: „Ist das Werk ein Kunstwerk? Wenn es das ist, mögen die zahllosen Kalauer, Bierwitze, Zoten, abnormen Sexualphantasien …
mehr

Ich war müde an diesem Nachmittag im Tiergarten. Wir hatten uns da verabredet, wo das Brandenburger Tor seinen Schatten auf einen Eingang wirft. Da verfehlten wir uns und als wir uns eine halbe Stunde später zusammentelefoniert hatten, war die Angst mit von der Partie, der Zauber könnte gelitten haben und wir wären nun außerhalb der Gnade.
mehr
Um das Jahr 1200 fixierten Passauer Kleriker auf Mittelhochdeutsch eine Überlieferung, deren Gegenstände siebenhundert Jahre lang mündlich tradiert worden waren ...
mehr
Um das Verhältnis von Aktivismus und Literatur ging es ab 14.30 h im Konferenzraum des Literarischen Colloquiums Berlin.
mehr
„Im Istanbul der 1940er Jahre trugen schwule Männer rote Nelken im Knopfloch, und wer sich noch mehr traute, entschied sich für rote Socken.“
mehr
Varnhagens Handschrift ist kaum zu entziffern. Hannah Arendt analysierte die mit sozialen Bedeutungen geladenen Schlafresultate als Sublimationen ...
mehr
Wir erwarten Befruchtungen von den sozialen, ethnischen und geografischen Rändern. Das Thema rührt an einer humanen Konstante.
mehr
Wolitzer schildert Faith als untergrabene Repräsentantin des weißen Mittelstandsfeminismus mit afroamerikanischem Chapter ...
mehr
Karosh Taha sagt: „Für eine Frau, die sich auslebt, gibt es auch im Deutschen keine positiven Begriffe.“
mehr

Vater kam aus der panarabischen Euphorie des Gamal Abdel Nassers – eines Omar Sharifs unter Weltgestaltern. Er kam aus der Zukunft nach Deutschland. Er war im Aufwind und wurde in dem von den Amerikanern aus pittoresken Motiven nicht bombardierten Heidelberg stark abgebremst. Wie alle kultivierten Ägypter fesselte ihn eine Höflichkeit, die anderen Wesensmerkmalen keine Entfaltung gestattete.
mehr
Am Morgen des 28. Oktober 1982 führt Premierministerin Margaret Thatcher ihren Kollegen Helmut Kohl, der seit vier Wochen Kanzler ist …
mehr

Das Russische ist wie ein Haus, sagt Maryna. Die Malerin sieht überall Architektur.
mehr
ANNA GLAZOVA ist eine russischsprachige Lyrikerin, die seit zwanzig Jahren außerhalb von Russland lebt.
mehr
Schwarz ist hässlich, weiß ist schön, weiß Mohr Monostatos. Er nähert sich trotzdem der Prinzessin Pamina.
mehr

Vielleicht war meine Nase zu lang für eine perfekte Anpassung. Meine Schuluniform unterschied sich von den Uniformen ...
mehr

Der Sindh ist eine pakistanische (vormals indische) Provinz. Dort vermutet man den Ursprung ...
mehr

Mariam Dessaive, 1952 in London als Tochter eines indischen Vaters und einer deutschen Mutter zur Welt gekommen …
mehr

Als Vorsitzende des Landesrates der Roma und Sinti - Romnokher Berlin-Brandenburg - wünscht sich Dotschy Reinhardt …
mehr

„Uns geht es um die Methode. Sie dominiert die Narration”, erklärt Maryna.
mehr
Die alten Römer und wir: Mein Beitrag zu den Fragen der Herkunft. Alida Bremer verstärkt die MAIN LABORant*innen.
mehr

„Pass auf,“ sage ich zum Personenschützer, „ich erzähle dir meine Goldkettengeschichte, dann erzählst du mir deine Reinigungskettengeschichte“. Dann gehe ich in Vorleistung.
mehr

Ich wundere mich / wieso heute alle Menschen lächeln /
sie lächeln in der Innenstadt ...
mehr

Der Offenbacher Poetikstar Safiye Can erscheint im MAIN LABOR
mehr

Die Schriftstellerin Sandra Gugić gehört zu den Expertinnen im MAIN LABOR
mehr

Auch der Psychologe Tobias Kammann nimmt am MAIN LABOR teil.
mehr

Ich muss mich zwingen, Erinnerungen wachzurufen, die dunkel und leise sind, Erinnerungen an den Abschied von meinem Vater, der nach Deutschland ging.
mehr
Arta Ramadani hat eine unmittelbar einleuchtende Art, sich mitzuteilen. Die Schriftstellerin und ZDF-Redakteurin kämpft ...
mehr

Fragt man Tante Khalida, dann fehlt den Deutschen die Weisheit Mesopotamiens. ..
mehr